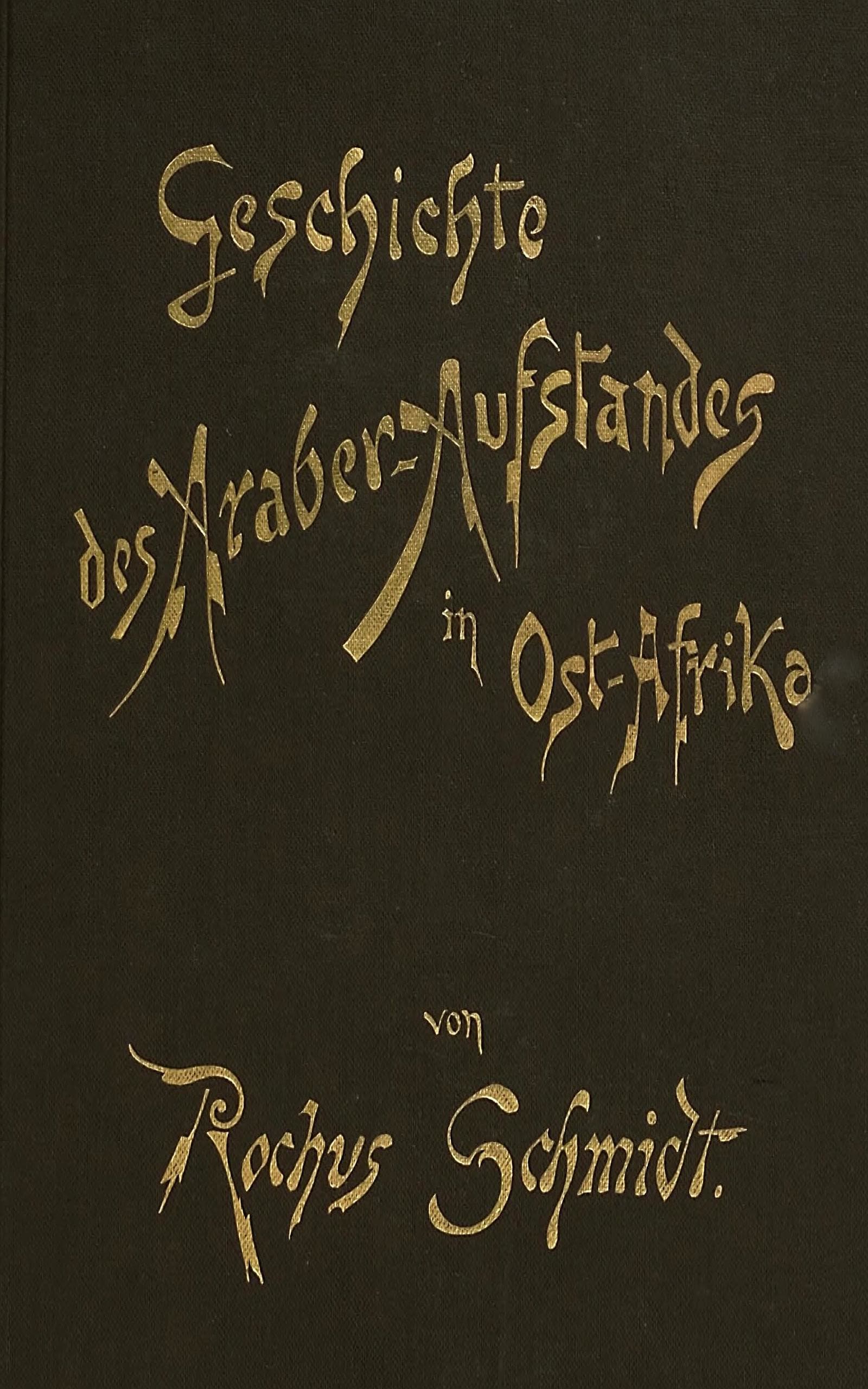
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt; Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler sind stillschweigend korrigiert worden.
Worte in Antiquaschrift sind "kursiv" dargestellt
.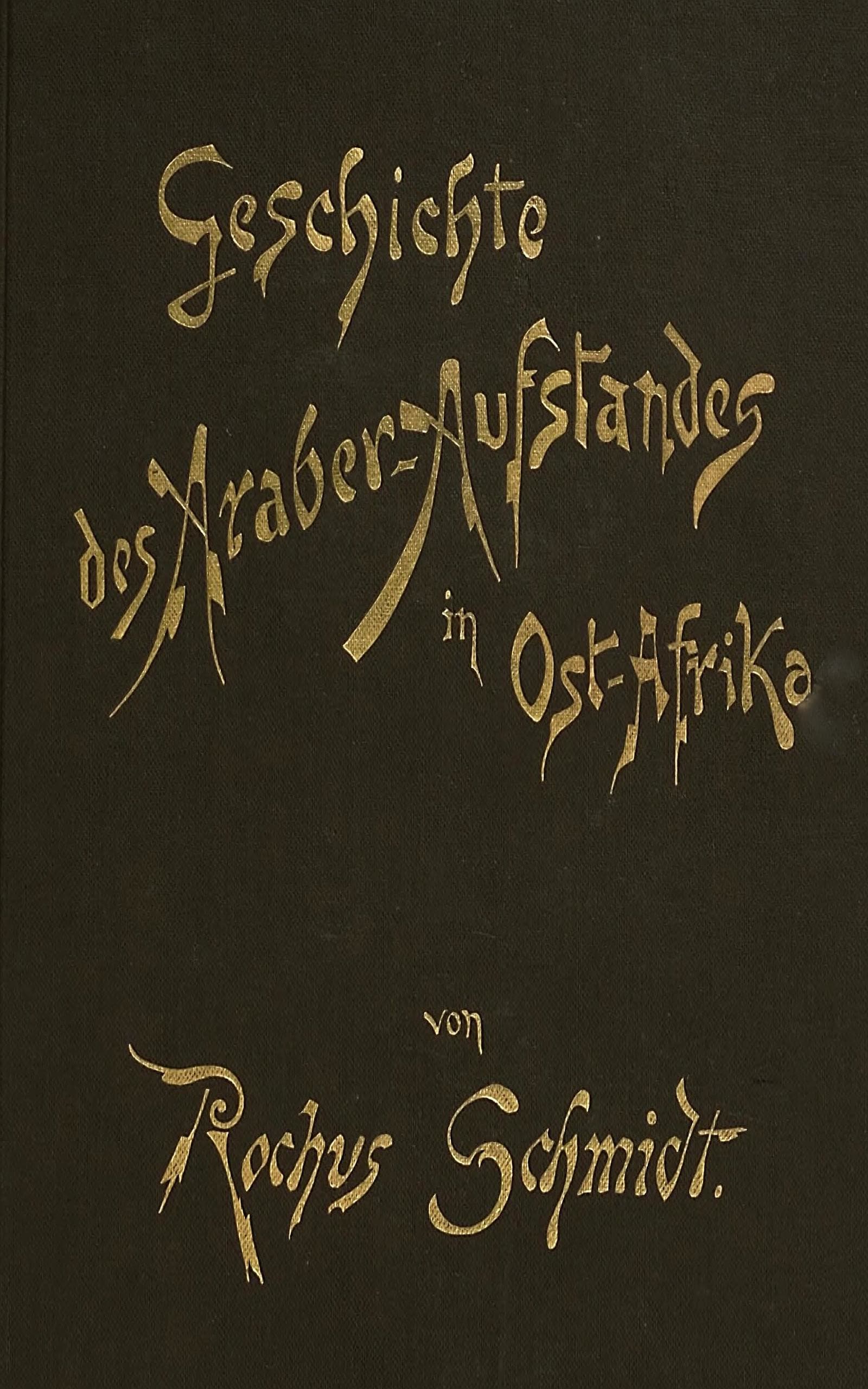
Seine Entstehung,
seine Niederwerfung und seine Folgen.
Von
Rochus Schmidt.

Frankfurt a. Oder.
Verlag der Königlichen Hofbuchdruckerei Trowitzsch & Sohn.
Die große Menge der Afrikawerke, welche in den letzten Jahren auf dem deutschen Büchermarkte erschienen sind, ließ auffallender Weise immer noch eine eigentliche Geschichte des Ostafrikanischen Aufstandes und seiner Niederwerfung vermissen. Eine gesammelte, auf rein historischer Grundlage ruhende und durch mehrjährige persönliche Erfahrung kritisch gesichtete Darstellung der kriegerischen Ereignisse in Ostafrika, ihrer Ursachen und nächsten Folgezustände erschien aber gerade jetzt geeignet.
Die Lage unserer deutschen Kolonie in Ostafrika ist keine glänzende, die Stimmen der Gegner erheben sich von Neuem und drängen zu wenig ehrenvollem Rückzug oder zu Beschränkungen, denen ein solcher Rückzug noch vorzuziehen wäre.
Das vorliegende Buch soll in gedrängter Kürze die Entwickelung des Aufstandes und seine Niederwerfung behandeln, es soll dem Leser die großen Opfer vorführen, welche zu dieser Niederwerfung notwendig waren, es soll aber auch die Begründung versuchen, daß die Sache solche Opfer verdient.
Abenteuer oder farbensatte Schilderungen wird mancher Leser vielleicht vermissen, aber der Verfasser hat sich bemüht, alles zusammenzutragen, was für das vollkommene Verständnis des behandelten Zeitabschnittes nötig ist, kurz eine Geschichte des deutsch-ostafrikanischen Aufstandes zu geben. Ueberall ist dabei der Standpunkt strenger Objektivität gewahrt worden, auch da, wo Personen, Maßnahmen oder Verhältnisse wohl eine herbere, subjektive Kritik hätten herausfordern können. Wo eine Kritik sich findet, beruht sie auf Erfahrung und sorgfältigster Prüfung.
Möge es gelingen, durch das vorliegende Buch der Sache einen Dienst zu leisten.
Berlin, im Juni 1892.
Der Verfasser.
Benutzte Quellen: Brix Förster. — Richelmann. — von Behr. — Paul Reichardt. — Weißbücher. — Kolonialblatt. — Kolonialzeitung. — Koloniale Jahrbücher. — Zeitungsberichte (Militärwochenblatt, Lieut. Heymons, Kreuzzeitung, Dr. Neubaur.).
| Seite | ||
| I. | Kapitel: Einführung | 1-20. |
| II. | Kapitel: Entwickelung des Aufstandes und Errichtung des Reichskommissariats | 21-38. |
| III. | Kapitel: Organisation der Schutztruppe | 39-55. |
| IV. | Kapitel: Die ersten Kämpfe um Bagamoyo, Daressalam, Pangani, Tanga und Sadani | 56-80. |
| V. | Kapitel: Ausbildung des Reichskommissariats | 81-98. |
| VI. | Kapitel: Wißmanns Expedition nach Mpapua | 99-117. |
| VII. | Kapitel: Regelung der Verhältnisse um Mpapua und Marsch mit der Stanleyschen Expedition zur Küste |
118-140. |
| VIII. | Kapitel: Buschiri und die Mafiti | 141-150. |
| IX. | Kapitel: Wißmanns Thätigkeit an der Küste nach der Rückkehr von Mpapua, Buschiris Gefangennahme und die Unterwerfung Bana Heris |
151-184. |
| X. | Kapitel: Die Stationen und der Dienst auf denselben | 185-197. |
| XI. | Kapitel: Die Unterwerfung des Südens | 198-217. |
| XII. | Kapitel: Das Reichskommissariat unter Wißmanns Stellvertreter Dr. Karl Wilhelm Schmidt |
218-238. |
| XIII. | Kapitel: Wißmanns letzte Thätigkeit als Reichskommissar | 239-261. |
| XIV. | Kapitel: Das Deutsch-englische Abkommen | 262-275. |
| XV. | Kapitel: Die wirtschaftlichen Unternehmungen vor, während und nach dem Aufstande |
276-297. |
| XVI. | Kapitel: Ostafrika unter Herrn von Soden | 298-334. |
| XVII. | Kapitel: Die Expedition Emin Paschas | 335-350. |
[S. 1]
Kolonisationsidee in Deutschland. — Erwerbung Deutsch-Ostafrikas. — Verträge in Usegua, Nguru, Usagara und Ukami. — Kaiserlicher Schutzbrief. — Gesellschaft für deutsche Kolonisation. — Gegenbestrebungen des Sultans. — Erste Stationen in Ostafrika. — Expeditionen zu Gebietserwerbungen. — Expedition des Verfassers. — Protest des Sultans Said Bargasch gegen den kaiserlichen Schutzbrief. — Araber in Ostafrika. — Besitzstand des Sultans an der Küste. — Stellung der Walis. — Bismarcks Ultimatum. — Deutsche Flottendemonstration in Sansibar. — Der Sultan erkennt die deutschen Ansprüche an. — Diplomatische Verhandlungen zwischen Deutschland und England. — Londoner Vertrag. — Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. — Der Küstenvertrag mit dem Sultan. — Stationsbestand der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft.
Eine Geschichte des Araberaufstandes in Deutsch-Ostafrika kann nicht gedacht werden ohne eingehende Betrachtung der Verhältnisse, welche diesem Aufstande vorhergingen. Die Erwerbung Deutsch-Ostafrikas, die einzelnen Phasen im Aufbau der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, die rein politischen und handelspolitischen Faktoren, welche im Zusammenwirken mit den Völkerverhältnissen an der Küste Deutsch-Ostafrikas zum Aufstand führten, bilden eine große logische Kette.
Die Entwickelung der Kolonisationsidee in Deutschland braucht nur mit wenigen Worten gestreift zu werden.
Die allgemeinen Ursachen, auf denen sich diese Idee aufbaute, sind selbstverständlich in erster Linie in der außerordentlichen Machtstellung zu suchen, welche Deutschland besonders nach dem französischen Kriege in der Welt sich erworben. Diese Machtstellung brachte dann eine unerwartete Entwicklung der Industrie mit sich und diese wieder trieb ganz von selbst zu der Notwendigkeit[S. 2] neue Absatzgebiete im Ausland zu schaffen. Während von der einen Seite her diese Absatzgebiete lediglich auf dem Handelswege im Ausland oder in den Kolonien anderer Nationen gesucht wurden, verlangte das wiederbelebte Nationalgefühl der Deutschen seinerseits einen Anteil an der Welt in Gestalt von Kolonien, um auf diese Weise die großen wirtschaftlichen Faktoren im eigenen kolonialen Auslande nutzbar verwerten zu können: mit einem Wort, die politische Unabhängigkeit auch auf dem Gebiete des Handels und der Industrie zu erwerben. Gegenüber allen Verdächtigungen feindlicher Kreise muß den ersten Beförderern der Kolonialidee zweifellos der Ruhm zuerkannt werden, den Weg zu einer solchen Unabhängigkeit ehrlich gesucht und auch thatsächlich gefunden zu haben.
Welch außerordentliche Rolle bei diesen Bestrebungen Deutsch-Ostafrika von vornherein gespielt hat und immer spielen wird, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden. Einmal haben wir es mit einem Gebiete zu thun, welches nach dem übereinstimmenden Urteil aller unbefangenen Beobachter und Forscher zweifellos die wertvollsten Teile Afrikas entweder in sich begreift oder handelspolitisch zu beherrschen in der Lage ist. Ferner verfügt gerade unser Gebiet über eine durchaus eigentümliche, im ganzen schwarzen Kontinent sich nicht wiederfindende Entwicklung der Handelsbeziehungen nach dem Innern und vom Innern heraus. Endlich besitzen wir in dem Volksstamm, welcher die Handelswege nach dem tiefsten Innern eröffnet hat und auch gegenwärtig noch als alleiniger Träger dieses Handelsverkehrs aufzufassen ist, in den Arabern nämlich, Handelsvermittler von einer kaufmännischen Begabung und gerade für das in Betracht kommende Land geeigneten Vorbildung, wie sie wenigstens für Afrika nicht besser gedacht werden können.
Abgesehen von der wesentlichen Bedeutung aber, welche das deutsch-ostafrikanische Gebiet für Deutschland selbst besitzt, muß darauf hingewiesen werden, in welch ungewöhnlicher Weise die Erwerbung dieses Gebietes durch eine deutsche Privatgesellschaft zur Kolonisation ganz Afrikas und im weiteren zur Lösung kultureller und zivilisatorischer Aufgaben von höchster Bedeutung mitgewirkt hat. Der[S. 3] Eintritt des deutschen Reiches in die Reihe der Kolonialstaaten, die internationale Verteilung Afrikas zwischen Deutschland, England, Frankreich, Italien und Portugal in den Verträgen des Jahres 1890, die internationale Regelung der Sklavereifrage durch die Brüsseler Konferenz vom Jahre 1889 sind lediglich Folgen der deutschen Erwerbung, und es darf gewiß als ein eigenartiges Wirken der Vorsehung angesehen werden, wenn gerade das jüngste Kolonialvolk den Anstoß zur Regelung von Fragen gegeben hat, welche einen ganzen Erdteil betreffen.
Wenige Worte mögen dem Leser den Gang der Erwerbung ins Gedächtnis zurückrufen.
Einige wenige patriotische Männer vereinigten sich am 3. April 1884 zur Gesellschaft für deutsche Kolonisation. Sie stellten sich auf den Boden der von Dr. Karl Peters vorgeschlagenen Thesen, welche darin gipfelten, daß, bis das Reich sich entschlösse in eine Kolonialpolitik einzutreten, es nötig sei, daß das deutsche Volk selbst mit praktischen Schritten, d. h. in erster Linie mit Gebietserwerbungen in fremden Erdteilen, zunächst in Ostafrika, vorginge. Im November 1884 traf bereits die erste Expedition (Dr. Peters, Dr. Jühlke, Graf Joachim Pfeil und Kaufmann Otto) in Sansibar ein. Am 10. November brach die Expedition nach Überwindung unendlicher Schwierigkeiten nach dem Festlande auf, erwarb innerhalb 6 Wochen durch Verträge in den Landschaften Usegua, Nguru, Usagara und Ukami die Hoheits- und eine Reihe von Privatrechten von 10 eingeborenen Häuptlingen (Jumbes), hißte die deutsche Flagge an den entsprechenden Punkten und bestimmte einige Plätze für die Anlegung von Stationen. Anfang Februar 1885 traf Dr. Peters bereits wieder in Berlin ein und erhielt auf Verwendung Sr. Durchlaucht des Fürsten Bismarck am 27. Februar 1885 den Allerhöchsten Schutzbrief Sr. Maj. des Kaisers Wilhelm I. für die gemachten Erwerbungen. Mit Erlangung dieses Schutzbriefes wurden alle Anfeindungen, welche gegen die völker- und staatsrechtliche Gültigkeit jener Verträge erhoben waren, ohne weiteres niederschlagen, — Anfeindungen, welche nicht nur in Deutschland selbst seitens der Kolonialgegner, sondern besonders durch das auf das[S. 4] höchste betroffene England in Szene gesetzt waren. Die Erlangung dieses Schutzbriefes ist daher als ein außerordentlich wesentliches Zugeständnis des deutschen Reiches und zwar in erster Linie des Fürsten Reichskanzlers anzusehen. Es ist der eigentliche Ausgangspunkt der afrikanischen Kolonialpolitik des deutschen Reiches. Die Gesellschaft für deutsche Kolonisation hatte damit ihren ersten und zweifellos größten Erfolg erreicht, einen Erfolg, welcher jedoch der Gesellschaft selbst große und über den Rahmen ihres eigentlichen Wirkungskreises weit hinausgehende Verpflichtungen auferlegte. Es stellte sich sofort die Notwendigkeit heraus, mit weit größeren Kapitalmitteln als bisher die bereits erworbenen Gebiete in thatsächlichen Besitz zu nehmen, andrerseits aber diesen Erwerbungen, welche ja nur als Kern und Ausgangspunkt gedacht waren, neue in weiterem Umkreise hinzuzufügen und den Kolonialbesitz in Ostafrika abzurunden. Besonders die letztere Aufgabe bedingte die allergrößte Eile. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Peters'schen Erwerbung machten sich sowohl von englischer Seite als auch (und zwar vermutlich auf Betreiben der Engländer) seitens des Sultans von Sansibar Bestrebungen geltend, welche darauf abzielten, den erworbenen Besitz zu isolieren und die umliegenden Landschaften rechtlich für den Sultan von Sansibar in Besitz zu nehmen. In richtiger Erkenntnis der Sachlage wurde daher aus der Mitte der Gesellschaft für deutsche Kolonisation heraus bereits am 2. April 1885 eine Kommanditgesellschaft gegründet, welche unter dem Namen »Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, Karl Peters und Genossen« in das Handelsregister eingetragen wurde und so eine Rechtsform für das weitere Vorgehen darstellte.
Als Zweck der Gesellschaft wurde in die Satzungen aufgenommen »Erwerb, Besitz, Verwaltung und Verwertung von Ländern sowie deutsche Kolonisation im Osten Afrikas«. Dr. Peters erhielt Generalvollmacht und zwar in einer solchen Ausdehnung, daß thatsächlich die ganze Gesellschaft in jeder Beziehung durch ihn allein geleitet wurde.
Für Dr. Peters selbst hatte sich nach seiner Rückreise nach Deutschland die Notwendigkeit eines längeren Aufenthaltes in[S. 5] der Heimat herausstellt, um die schwierigen, dort der Gesellschaft harrenden Aufgaben in Angriff zu nehmen, besonders in den Finanzkreisen Deutschlands die nötigen Kapitalien zu schaffen, ferner die weitere Ausbildung der Gesellschaftsformen herbeizuführen und dieser als Direktor vorzustehen. In Ostafrika standen von den mit Peters ausgezogenen Herren noch Dr. Jühlke und Graf Pfeil zur Verfügung, da der Kaufmann Otto in Usagara einer Krankheit zum Opfer gefallen war. Dem Dr. Jühlke wurde die Vertretung der Gesellschaft in Sansibar und Ostafrika übertragen; während Graf Pfeil als erste Aufgabe die Errichtung der Station Sima in Usagara zugewiesen erhielt.
In Deutschland wurden von Dr. Peters nach der Erteilung des kaiserlichen Schutzbriefes eine Reihe von Persönlichkeiten für den Gesellschaftsdienst engagiert, um zur Erweiterung des Gebietes eine Reihe von Expeditionen zu unternehmen. Einer der engagierten Herren, der Gärtner Schmidt, löste den Grafen Joachim Pfeil auf Sima ab mit dem Auftrag dort eine landwirtschaftliche Station zu gründen. Dadurch wurde Graf Pfeil für Uebernahme weiterer Expeditionen frei und ging zunächst auf der von Bagamoyo nach dem Innern sich hinziehenden Karawanenstraße nach Süden, woselbst er der Gesellschaft durch einen Vertrag Ansprüche auf die Landschaft Kutu sicherte. Hieran schlossen sich folgende weitere Expeditionen:
Die Expedition Jühlke, welcher Premier-Lieutenant Weiß zugeteilt war, gewann Rechtstitel auf die Landschaft Usambara.
Graf Pfeil schloß zusammen mit Premier-Lieutenant Schlüter Verträge in den Landschaften zwischen dem Rufidji und Rovuma.
Die Herren Baumeister Hörnecke und Lieutenant von Anderten waren zu gleichem Zweck am Tana und an der Somaliküste thätig und erwarben Ansprüche, die im Jahre 1886 durch eine Expedition des Dr. Jühlke an der Benadirküste erweitert wurden. Hierbei fiel dieser um die Erwerbung unserer Kolonien hochverdiente Mann den heimtückischen Somali leider zum Opfer.
Der Verfasser selbst sicherte der Gesellschaft durch Verträge Rechte auf die Landschaft Usaramo.
[S. 6]
Es würde zu weit führen, und ist nicht Aufgabe dieses Buches, die erwähnten Expeditionen im Detail zu verfolgen. Doch dürfte es nicht uninteressant sein, eine solche Expedition etwas ausführlicher zu erzählen, um hierdurch ein Bild von den damals in Ostafrika für die Gesellschaft bestehenden Schwierigkeiten zu geben.
Es wird zu diesem Zweck die vom Verfasser selbst ausgeführte Expedition gewählt; nicht etwa als ob dieser ein besonderer Wert zugesprochen werden soll, sondern weil sie naturgemäß dem Verfasser am nächsten liegt.
Mein Auftrag, den ich nach meiner Ankunft in Sansibar vom Generalvertreter der Gesellschaft, Dr. Jühlke, erhielt, bestand darin, in Sansibar zunächst eine Expedition zusammenzustellen und mit dieser von Bagamoyo aus Usaramo zu durchziehen, das Land zwischen dem Kingani und Rufidji der Gesellschaft zu sichern und dann nach Usagara zu gehen, wo mir weitere Befehle von Seiten der Gesellschaftsvertretung zugehen sollten.
Ich suchte dem erhaltenen Befehle gemäß so schnell wie möglich die für die Expedition nötigen Träger anzuwerben, kaufte die im Inlande gangbaren Tauschartikel ein, verpackte sie in Lasten und war 5 Tage nach meiner Ankunft in Sansibar so weit, daß ich nach Bagamoyo, dem Anfangspunkt meiner Expedition auf dem Festland überfahren konnte. Es war für mich notwendig, die Zahl der für die Expedition nötigen Träger auf ein Minimum zu reduzieren, da Said Bargasch, der damalige Sultan von Sansibar, uns die Anwerbung der Leute, wie überhaupt die Expedition in jeder Weise zu erschweren suchte. Ich sah mich genötigt, nachdem es mir gelungen war, 70 Träger anzuwerben, auch unsere eigenen Bedürfnisse sehr zu beschränken und für diese Trägerzahl die Verpackung der nötigsten Lasten einzurichten. Von der sonst bei einer Expedition üblichen Mitnahme von Karawanen-Askari (Soldaten) mußte ich Abstand nehmen, weil mir die Anwerbung solcher, wenn sie einigermaßen zuverlässig sein sollten, unmöglich war. Meiner Expedition war der 3 Monate vor mir in Ostafrika angelangte Kaufmann Söhnge zugeteilt worden. Von den Schwarzen sind zu erwähnen: der Hetmann der Karawane,[S. 7] der Komorenneger Ramassan, ferner 2 sansibaritische Waniampara (Unterführer) — alle drei mit Gewehren bewaffnet. Im übrigen bestand die Expedition außer unseren schwarzen Dienern nur noch aus sansibaritischem Trägerpersonal. Beim Aufbruch war für mich die größte Eile geboten, schon aus dem Grunde um, bevor das Ziel der Reise bekannt geworden war, Aufhetzungen des Sultans in Usaramo vorzubeugen. Der Sultan konnte uns nicht nur in Sansibar an der Anwerbung der Träger und der Zusammenstellung der Expedition aufs äußerste hinderlich sein, sondern auch im Innern. Hier besaß er zwar an den meisten Plätzen nicht eine direkte Macht, aber doch einen großen moralischen Einfluß, wie sich dies bei mehreren deutschen Expeditionen, z. B. in Usambara gezeigt hat, wo von Said Bargasch die entsprechenden Empfehlungen vorausgeschickt wurden. Durch meinen schnellen Aufbruch indes, und da der Sultan über den Zweck meiner Reise sich im Unklaren befand, die Expedition auch so angelegt war, als ob sie direkt nach Usagara marschierte, welches sich ja bereits in deutschem Besitz befand, wurden wir vor Schädigungen bewahrt.
So war es mir möglich, im ganzen 7 Tage nach meiner Ankunft in Sansibar, von Bagamoyo aus abzurücken, von wo ich zunächst südlich nach Bueni marschierte, um von hier aus den kleinen von Pangani nach Kutu führenden Karawanenweg bis an den Kingani nach Dundanguru einzuschlagen. Auch hier war es wieder mein Bestreben, möglichst schnell vorwärts zu kommen, um nach dem Bekanntwerden meiner Route in Bagamoyo und Sansibar durch die Schnelligkeit des Marsches mich dem Einfluß der Küstenmachthaber zu entziehen. In der That wurde auch die Expedition zunächst von den Eingeborenen überall freundlich aufgenommen, die damals trotz der großen Nähe der Küste Europäer noch gar nicht gesehen hatten, weil diese nur in ganz vereinzelten Ausnahmefällen bislang das Land seitlich der großen Karawanenstraße betreten hatten. Es bildete sich fast überall ein ganz friedlicher Verkehr mit der Bevölkerung heraus, und dieselbe war in der Regel leicht dazu zu bewegen, die Verträge, deren Abschließung der alleinige Zweck der Expedition war, mit uns einzugehen. Wie schon[S. 8] ganz im Eingang erwähnt worden, sind ja diese Verträge sowohl in Deutschland wie im Ausland auf das heftigste angegriffen und verspottet worden. Das Letztere vielleicht mit einem gewissen Recht; denn es konnte sich ja niemand verhehlen, daß der faktische Wert derselben gering war, da die eingeborenen Häuptlinge sich sehr selten, obgleich es ihnen auseinander gesetzt wurde, dessen, was sie mit einigen Krähenfüßen unterschrieben, voll bewußt waren und sie zumeist auch gegen reiche Geschenke in der augenblicklichen Laune waren, alles Mögliche was man von ihnen verlangte, abzutreten, ohne an das Bindende solcher Zugeständnisse für die Zukunft zu denken. Andererseits repräsentierte auch die zweite Vertrag schließende Partei, die ostafrikanische Gesellschaft, damals nur eine geringe Macht und bedurfte dringend des Rückhalts an der Reichsregierung.
Nichtsdestoweniger haben die Verträge ihren Zweck vollkommen erfüllt, da infolge der ungeordneten innerafrikanischen Zustände und infolge der zivilisatorischen und humanitären Verpflichtungen, die wir den auf der tiefsten Kulturstufe stehenden Negern gegenüber zu übernehmen willens waren, die staatsrechtliche Grundlage für die spätere Abgrenzung unserer Interessensphäre durch sie gegeben wurde.
Fand ich nun in der ersten Zeit überall eine gute Aufnahme und volles Entgegenkommen seitens der Eingeborenen auf meiner Expedition, so blieb doch die Aufhetzung des Sultans von Sansibar nicht ohne Erfolg. Denn diejenigen in der Expedition, auf die ich am meisten angewiesen war und von denen der Erfolg derselben abhing, die Träger, warteten nur auf die Gelegenheit, mich während des Marsches im Stich zu lassen und thaten dies auch gleich während der ersten Tage nach meinem Aufbruch von der Küste.
Wie sehr der Sultan auf die Träger einzuwirken im Stande gewesen war, konnte ich daraus ersehen, daß dem treu zu mir haltenden Dolmetscher Ramassan öfters von den Sansibariten gedroht wurde, ihn beim Sultan zu denunzieren, weil er auf Kosten der Interessen des Sultans unsere Bestrebungen zu sehr fördere. Ramassan schwebte daher auch in steter Angst vor der Strafe des Sultans.
[S. 9]
Durch das Entgegenkommen der eingeborenen Jumbes oder Pasi, wie sie in Usaramo genannt werden, ist es mir zunächst immer gelungen, die notwendige Zahl von Aushilfeträgern zu erhalten. Doch sah ich mich wegen der steten Zunahme von Desertion der Träger in Dundanguru veranlaßt, zu einem andern Auskunftsmittel zu greifen, da von hier an die Wasaramo nicht mehr willens waren, mir auf meiner nach Süden nach dem Rufidji abbiegenden Route bis an die Grenze der gefürchteten Mahenge zu folgen.
Ich erklärte meinen Trägern, daß, wer nicht weiter mit mir ziehen wollte, die Erlaubnis habe nach Sansibar zurückzukehren, da ich nur solche Leute, die mir freiwillig und gern folgen würden, mit mir zu nehmen wünsche. In Sansibar würde ich die Bestrafung der Davongelaufenen durch Vermittlung des deutschen Konsulats herbeiführen, dagegen die mir während der ganzen Expedition treu bleibenden Träger über meine Verpflichtung hinaus belohnen. So behielt ich nicht ganz 30 Mann bei mir.
Es war mir ganz Unmöglich, mit diesen die Lasten der Karawane weiterzutransportieren. Daher erteilte ich dem Kaufmann Söhnge den Auftrag, am Kingani ein provisorisches Lager zu beziehen und so gut es ging, zu befestigen, während ich selbst mit den für die Dauer eines Monats notwendigen Tauschwaren, die ich in sehr leichte Lasten verpackt hatte, mit 13 Trägern den Marsch nach Süden fortsetzte. Die übrigen Träger ließ ich Herrn Söhnge zur Bewachung und Einrichtung des Lagers.
Ich durchzog nun allein das Land direkt nach Süden bis zum Rufidji verfolgte diesen drei Tagereisen östlich und marschierte dann nach Nordwest zurück, um wieder zum übrigen Teil meiner Expedition am Kingani zu stoßen.
Ich fand bei den Häuptlingen des südlichen Usaramo nicht dasselbe Entgegenkommen wie im nördlichen Teil und wurde überall mißtrauisch aufgenommen; es gelang mir jedoch auch hier, wenn auch nicht mit derselben Leichtigkeit wie vordem, die gewünschten Verträge, 25 an der Zahl, abzuschließen.
Nach meiner Wiedervereinigung mit Söhnge trat ich den weiteren Vormarsch der Expedition nach Usagara an, da es[S. 10] Söhnge gelungen war, sich mit den Parsis der Ortschaften am Kingani zu befreunden und von diesen die für den Weitermarsch nötige Zahl von Trägern anzuwerben. Die große Karawanenstraße von Bagamoyo wurde am Gerengere erreicht und auf dieser der Marsch nach Muini Sagara und von da nach Sima fortgesetzt.
In Sima traf ich den Generalvertreter der Gesellschaft Dr. Jühlke an, welcher die für die weitere Fortsetzung der Expedition oder für Stationsanlagen nötigen Lasten, die ich aus Mangel an Trägern von Sansibar nicht hatte mitnehmen können, mir nachbrachte und ferner den Auftrag des deutschen Generalkonsuls hatte, einen mit dem alten Usagara-Sultan Muini Sagara und einer arabischen Karawane vorgekommenen Streitfall zu untersuchen und zu schlichten. Dieser Auftrag ging in Folge der Erkrankung Jühlkes auf mich über und hielt mich für die nächste Woche noch in Usagara fest.
Endlich im letzten Drittel des Oktober erreichte mich der Befehl nach Sansibar zurückzukehren und dort eine neue Expedition zusammenzustellen, um mit dieser von der Rovuma-Mündung aus zum Zweck weiterer Erwerbungen ins Innere abzumarschieren.
Mein Begleiter Söhnge war bereits vor mir mit den abgeschlossenen Verträgen nach Sansibar zurückgesandt worden, und es schloß sich mir der mit mir zugleich nach Ostafrika gekommene Dr. Hentschel, welcher sich damals ebenfalls in Usagara befand, auf dem Rückmarsche an. Diese Rücktour sollte indes für mich verhängnisvoll werden und einen Strich durch die Ausführung meiner Instruktion machen.
Am 28. Oktober, Morgens, verließen wir unsern Lagerplatz bei Kidete. Die ersten Stunden des Marsches von Kidete aus waren ruhig verlaufen, und wir glaubten, obgleich wir sowohl durch Kidete-Leute, wie auch durch passierende Jäger von den in jener Gegend angesessenen Wakamba des öfteren belästigt worden waren, durchaus nicht an eine ernstere Gefahr, als wir plötzlich etwa um 1/2-12 Mittags von hinten beschossen wurden. Die Karawane bestand damals außer uns beiden Europäern noch aus 20 unbewaffneten Trägern, welche bei diesem Angriffe ebenso wie unsre Boys ihre Lasten fortwarfen[S. 11] und sich schleunigst davonmachten. Wir waren daher auf uns allein angewiesen. Unter dem fortgeworfenen Gepäck befanden sich auch Dr. Hentschels Patronen. Da ich eine größere Anzahl Patronen selbst bei mir trug, half ich hiermit meinem Gefährten aus. Seine Doppelbüchse hatte ein etwas größeres Kaliber als der Büchsenlauf meiner Büchsflinte, weshalb auch seine Schüsse nicht so präzis sein konnten. Wir suchten indes durch schnelle und möglichst gut gezielte Schüsse der uns numerisch überlegenen Bande — es waren etwa 30 an der Zahl — möglichst viel Verluste beizubringen. Die Gegner haben, wie späteren Besuchern der Gegend mitgeteilt wurde, 5 Tote und mehrere Verwundete gehabt. Aber wir selbst wurden beide gleich bei Beginn der Schießerei verwundet. Dr. Hentschel erhielt einen Schuß in die linke Wade und ich einen in den rechten Unterschenkel über dem Knöchel.
Glücklicherweise machten uns unsere Wunden nicht kampfunfähig; wir suchten so gut wie möglich Deckung im Terrain und setzten, obgleich verwundet, das Feuer fort.
Bei den Gegnern wurde dasselbe immer schwächer; doch traf mich eine der letzten gegnerischen Kugeln in die Brust und ging durch meine rechte Lunge hindurch. Das genügte in jenem Augenblick für mich. Die Gegner stellten, wahrscheinlich wegen der verhältnismäßig großen Verluste, die sie hatten, das Feuer ein und verschwanden zu meinem Glück vom Kampfplatz. Dr. Hentschel hielt an meiner Seite aus, bis mich das Bewußtsein verließ, worauf er sich bei seiner ihn am Gehen hindernden Verwundung zum Teil auf allen Vieren nach dem nächsten Dorfe hin fortbewegte, um Hilfe für mich herbeizuschaffen, oder, wenn diese zu spät käme, mich zu beerdigen. Er mußte zu diesem Zweck die davongelaufenen Träger, vor allem Ramassan, wiederbekommen; denn allein konnte er, selbst verwundet, mir nicht helfen. Daher bewog er eine Anzahl Leute im nächsten Dorfe, zu mir zurückzugehen, um mich nach jenem Dorf zu bringen; er gab ihnen als Lohn das einzige, was er gerettet, sein eigenes Gewehr. Die Leute sind indessen nie zu mir gekommen.
Dr. Hentschel selbst kam nicht zurück, weil er hörte, englische Missionare seien etwas weiter vorwärts auf der Straße, aber in[S. 12] der Nähe. Er sah ein, daß das richtigste sei, von diesen ärztliche Hilfe und Medizin zu erbitten, da wir alles verloren hatten. So ließ er sich zu diesen tragen und sandte Ramassan zurück, der indes Angst hatte und erst später zu mir kam. Die englischen Missionare traf Hentschel; dieselben erklärten sich natürlich bereit, auf mich zu warten, während Hentschel sich in Eilmärschen nach Sadani tragen ließ, um von dort nach Sansibar zu fahren und dort den Vorfall zu melden, damit mir ein Arzt und Hilfe entgegengeschickt würde, wenn es auch damals unwahrscheinlich erschien, daß ich am Leben war. Dr. Hentschel hat in dieser Weise durchaus korrekt und besonnen gehandelt; durch seine Handlungsweise hat er wesentlich dazu beigetragen, mir das Leben zu retten, und mich zu Dank verpflichtet.
Nun ein paar Worte über meine Angreifer. Diese bestanden, wie wir später erfuhren, in einer Räuberbande, sogenannten Ruga-Ruga, die es auf Beutemachen und Plünderung Unsrer Sachen abgesehen hatten. Diese Absicht ist nun nicht einmal von ihnen erreicht worden, da die Angreifer nach ihren verhältnismäßig großen Verlusten sich schleunigst empfahlen. Es waren Dritte, denen die Beute zufiel, und zwar Kidete- und Mamboialeute, die, während ich bewußtlos auf dem Kampfplatz lag, alles stahlen und dabei mit großer Gewissenhaftigkeit verfuhren. Bis auf das, was ich persönlich am Leibe trug, ließen sie nichts zurück; doch war ich indessen noch gut daran, daß mir die Ruga-Ruga selbst nicht noch einen Besuch abstatteten, da sie mir sicher das Messer an den Hals gesetzt hätten.
Ich selbst blieb besinnungslos bis zur Zeit der Dämmerung liegen. Da erst, also 6-7 Stunden nach meiner Verwundung, kam ich zum Bewußtsein meiner Hilflosigkeit. Einige Neger befanden sich in meiner Nähe, die, als ich die Augen aufmachte, auf und davon liefen. Brennender Durst peinigte mich. Ich suchte ihn zu stillen, indem ich mir den rechten Stiefel, in dem sich eine Portion Blut, von dem angeschossenen Bein herrührend, angesammelt hatte, auszog und das darin enthaltene Blut begierig trank. Da das Blut aber nachher trocknete und die Wunden überhaupt nur wenig nachbluteten, so gab es für mich bald nichts mehr zu trinken. Die ganze Nacht lag ich[S. 13] bei vollem Bewußtsein da; ich hätte mir gern schleunige Erlösung von meinen Leiden gewünscht. Meine Versuche, aufzustehen, mißlangen. Am nächsten Morgen kaute ich den Thau aus den Gräsern; den Tropenhelm legte ich mir unter den Kopf, um diesen etwas erhöht zu halten, und zog es vor, hierfür mir die glühende Tropensonne auf den Schädel scheinen zu lassen. Die Neger, welche vorbeikamen und mich liegen sahen, hatten kein Mitleid mit mir, verhöhnten mich teilweise noch, ließen mich alle liegen und gaben mir nicht einmal einen Tropfen Wasser zu trinken. Ein altes, fürchterlich häßliches Weib warf mir ein Stück von ihr ausgesogenen Kürbis ins Gesicht mit den Worten »da friß«, während ein Gemütsmensch darunter war, der auf mein Ansuchen, mich von der Stelle zu tragen, nur erwiderte: »Du wirst doch gleich sterben«. So lag ich, bis die Sonne am Himmel reichlich 2 Uhr zeigte, so daß ich also 26-27 Stunden an jener traurigen Stätte zugebracht habe. Da fanden sich endlich zwei hilfsbereite Leute, die mich ins nächste Dorf trugen. Als ich die erste Pfütze passierte, trank ich soviel Wasser, wie meine braven Träger nach ihrer Aussage noch nie einen Menschen hatten trinken sehen.
Ich wurde im nächsten Dorf in der Hütte des Jumbe untergebracht, der mich, so gut er konnte, verpflegte, indem er mich auf eine Negerbettstelle legen ließ und mir aus Matama gemachte Suppe zum Löschen des Durstes gab. Auch kam mein Karawanenführer Ramassan bald nach diesem Dorfe zurück, wusch, nachdem er mir die Sachen, welche über und über voll Blut waren, vom Leibe gezogen hatte, meine Wunden aus, und verklebte den Einschuß an der Brust, den Ausschuß am Rücken und den Einschuß am Bein mit je einem Stück Cigarettenpapier. Das war für die nächste Zeit die einzige Wundbehandlung. Außerdem warb Ramassan zehn Leute in jenem Wasagara-Dorf an mit dem Versprechen, ihnen wenn sie mich an die Küste nach Sadani brächten, reichlichen Lohn auszuzahlen.
Diese zehn trugen mich ununterbrochen die ganze Tageszeit mit Ausnahme einer kurzen Rast während des Mittags in der Hängematte, immer zwei und zwei abwechselnd, nach[S. 14] der Küste zu. Bei diesem Transport wurde in jenem gebirgigen Terrain aber nicht besser als mit einem Stück Waare mit mir umgegangen. Die Aufnahme, welche ich in den nächsten Dörfern während dieser Zeit fand, war eine durchaus hartherzige. In keinem Dorf wurde mir Unterkunft gewährt. Überall mußte ich mit meinen Leuten außerhalb des Dorfes auf einem harten Graslager zubringen. Dabei hatte ich von der während der Nächte verhältnismäßig großen Kälte viel zu leiden, da ich nur mit meinen blutdurchtränkten Kleidern bedeckt war. Nahrung bekam ich nur von meinen eigenen Leuten, und zwar während dieser ganzen Zeit nur eine Matamasuppe. Das Mißgeschick wollte es zudem, daß ich erst nach mehreren Tagen die englischen Missionare erreichte, welche bereits erwähnt sind. Sie hatten mir Boten mit Medizin und Lebensmitteln entgegengeschickt, doch waren diese einen andern Weg gegangen, als ich.
Bei den Missionaren wurde mir nun selbstverständlich alles zu teil, was mir diese Leute bieten konnten. Sie behandelten und verbanden meine Wunden, brachten mich in einem Zelte unter, gaben mir bessere Nahrung und eine bessere Hängematte, in der ich bis zur Küste unter ihrer Obhut getragen wurde. Allerdings war mein Zustand auf diesem Transport ein derartiger, daß man daran zweifelte, ob ich die Küste noch lebend erreichen würde. Am letzten Tage, bevor wir in Sadani ankamen, trafen wir auf dem Marsch den Maler Hellgrewe und Herrn Söhnge, die, nachdem sie von Dr. Hentschel Kunde über mich erhalten hatten, sich sofort aufgemacht hatten, mir Hilfe zu bringen. Sie fuhren an Bord der »Möwe« über die Herr Admiral Knorr auf die empfangene Nachricht hin so gütig war, nach Sadani zu schicken, damit der Arzt der »Möwe«, Herr Dr. Schubert, mir Hilfe leisten könnte. In Ndumi, 2 Stunden von der Küste entfernt, traf mich auch ein kleines Detachement unter Lieutenant Mandt und Dr. Schubert, die für meinen weiteren Transport nach Sansibar auf S. M. S. »Möwe« Sorge trugen. Zur Erinnerung an jene Zeit stiftete mir Hellgrewe später zwei von seiner Meisterhand gemalte Bilder, die gegenwärtig mein Zimmer schmücken. —
[S. 15]
Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der Entwickelung der ostafrikanischen Verhältnisse zurück. Bereits oben ist von den Bestrebungen die Rede gewesen, welche sich seitens des Sultans gegen die Erwerbungen der ostafrikanischen Gesellschaft geltend machten. Diese Bestrebungen nahmen eine greifbare Form an, als der Sultan am 25. April 1885 offizielle Kenntnis von dem kaiserlichen Schutzbrief erhielt. Der Sultan Said Bargasch erhob nunmehr einen formellen Protest gegen diesen Schutzbrief und die deutschen Erwerbungen überhaupt. Dieser telegraphisch nach Berlin übermittelte Protest hatte folgenden Wortlaut: »Wir haben vom Generalkonsul Rohlfs Abschrift von Ew. Majestät Proklamation vom 27. Februar empfangen, wonach Gebiete in Usagara, Nguru und Ukami, von denen es heißt, daß sie westlich von unsern Besitzungen liegen, Eurer Oberhoheit und deutscher Regierung unterstellt sind. Wir protestieren hiergegen, weil diese Gebiete uns gehören und wir dort Militärstationen halten und jene Häuptlinge, welche die Abtretung von Souveränitätsrechten an die Agenten der Gesellschaft anbieten, dazu nicht Befugnis haben: Diese Plätze haben uns gehört seit der Zeit unsrer Väter.« Gleichzeitig sandte Said Bargasch Truppen nach Witu, Dschagga und Usagara, um durch eine thatsächliche Machtentfaltung die Häuptlinge einzuschüchtern und eine Art Besitzrecht auszuüben.
Es dürfte geeignet erscheinen, an dieser Stelle die Stellung der Araber in Sansibar und ihre Beziehungen zu Ostafrika kurz zu skizzieren. Wann die erste Einwanderung derselben in Ostafrika erfolgte, läßt sich mit Sicherheit nicht feststellen. Die zahlreichen Ruinen arabischer Gebäude an der ganzen Küste entlang legen Zeugnis davon ab, daß die arabische Kultur hier bereits in früheren Jahrhunderten in hoher Blüte gestanden haben muß; auf dem Boden der Geschichte erscheinen die Araber jedoch erst mit der portugiesischen Einwanderung. Es ist bekannt, daß das arabische Element durch die Portugiesen im 16. Jahrhundert fast gänzlich vertrieben wurde und daß die arabischen Städte insgesamt in portugiesische Hände fielen. Ebenso darf die spätere Vertreibung der Portugiesen durch die Maskataraber als bekannt[S. 16] voraussetzt werden. Erst seit dem Jahre 1840 ist Sansibar der unbestrittene Hauptort der arabischen Oberherrschaft. In diesem Jahr verlegte der Sultan Said Said seine Residenz von Maskat nach Sansibar. Ihm folgte 1856 Said Madjid, dem 1870 dann Said Bargasch nachfolgte; unter diesem gewann der englische Einfluß in Sansibar vollkommen das Übergewicht über alle andern Nationen. Said Bargasch starb 1888 und hinterließ die Regierung seinem Bruder Said Kalifa.
Die Stellung, welche die Araber in Ostafrika gegenwärtig und zwar seit der Vertreibung der Portugiesen einnehmen, ist eine durchaus eigentümliche, wie sie sich ein zweites Mal kaum irgendwo auf der Welt wiederfinden dürfte. Der eigentliche Mittelpunkt ihrer Herrschaft ist Sansibar selbst; aber von diesem Zentralsitz aus laufen die von Arabern gesponnenen Fäden bis in das tiefste Innere des schwarzen Kontinents hinein. Ihre weitesten Vorposten liegen gegenwärtig weit über den Tanganjika westlich im Congostaat.
Ein faktisches Besitzrecht hatte der Sultan ganz zweifellos am Küstenstreifen von der Tanamündnng bis zum Rovuma. Denn auf diesem ganzen Küstenstreifen unterhielt er in allen Hauptplätzen Walis (Statthalter), zum Teil auch Garnison. Er übte hier also wirkliche Hoheitsrechte aus. Der Machtbezirk der einzelnen Walis war jedoch außerordentlich begrenzt und erstreckte sich im großen und ganzen immer nur auf die nächste Umgebung ihres Wohnsitzes.
Fast unmittelbar hinter dem Küstenstreifen herrschten die eingeborenen Häuptlinge und zwar meist nach patriarchalischem Brauch unumschränkt, so daß von einem Besitztitel des Sultans hier gar keine Rede sein konnte. Die Ansprüche, welche der Sultan für dieses Innere erhob, begründete er mit dem Umstand, daß in einzelnen Plätzen sich von ihm ernannte Walis befänden. Damit kann jedoch von einer thatsächlichen Besitzergreifung seitens des Sultans nicht die Rede sein. Es erklärt sich das vielmehr lediglich aus Folgendem: Die arabischen Kaufleute, welche in den Plätzen des Innern, von denen hier die Rede ist, also z. B. in Tabora, Mamboia und anderen sich ansiedelten, ließen vom Sultan einen Wali[S. 17] ernennen, nur um durch einen solchen Beamten eine größere Autorität unter sich zu schaffen. Hätten sie einen Wali selbständig aus ihrer Mitte erwählt, so würde sich kein einziger der Araber an dessen Richterspruch gekehrt haben; ernannte aber der Sultan den Statthalter, so war demselben immer ein wesentlicher Einfluß gesichert, weil der Sultan die Endfäden des Gewebes in Händen hielt, d. h. weil er die ungehorsamen Araber bei ihrer Rückkehr nach Sansibar bestrafen konnte. Thatsächlich aber haben diese Walis den Eingeborenen gegenüber keine Rechte ausgeübt; diese standen wenigstens im jetzigen deutschen Interessengebiet nach wie vor unter ihren angestammten Häuptlingen.
Der Protest des Sultans wurde daher mit Recht durch den Fürsten Bismarck am 19. Juni 1885 formell abgelehnt, die Ansprüche für unbegründet erklärt und gegen die nachträgliche Besetzung von Gebieten, welche innerhalb des deutschen Schutzgebietes lagen, Einspruch erhoben. Die deutsche Antwort trug den Charakter eines Ultimatum und wurde durch ein deutsches Geschwader, bestehend aus den Schiffen: Bismarck, Prinz Adalbert, Gneisenau, Stosch, Elisabeth, Olga, Möwe nebst zwei Tendern: Adler und Ehrenfels nachdrücklich unterstützt.
Die Sultanstruppen waren bereits am 24. Juni zurückberufen worden und am 14. August erkannte der Sultan rückhaltlos die Schutzherrschaft Deutschlands über die Länder Usagara, Nguru, Usegua, Ukami und über das Gebiet von Witu an. Diese Erklärung des Sultan wurde vom deutschen Reich als vollkommen genügend angesehen und obwohl thatsächlich niemand in Sansibar, weder die Araber noch die Engländer und Franzosen, daran zweifelten, daß das Geschwader lediglich gesandt worden sei, um das Sultanat zu annektieren, wurde seitens Deutschlands, um die freundschaftlichen Beziehungen zu England nicht zu erschüttern, von diesem Schritte abgesehen. Nicht nur die Deutschen, sondern überhaupt alle Einwohner bis zum Sklaven herunter faßten dies nicht anders, denn als einen Mißerfolg Deutschlands auf. Die gewaltige Flottenentfaltung war gänzlich ohne Resultat, ja die Araber betrachteten sogar die vom Sultan gegebene Erklärung lediglich[S. 18] als ein durch die Not erzwungenes, diplomatisches Auskunftsmittel.
Für die europäischen Mächte bildete jedoch diese diplomatische Korrespondenz die Grundlage für weitere Verhandlungen. England hatte richtig erkannt, wie nahe die Gefahr einer Annexion des ganzen Sultanats gelegen hatte. Um für die Zukunft eine solche Möglichkeit auszuschließen, ging das englische Bestreben jetzt dahin, Deutschland zum Beitritt zu dem englisch-französischen Vertrage vom Jahr 1862 zu bringen, in welchem die Unabhängigkeit des Sultans von Sansibar anerkannt wurde. Die Verhandlungen über die ostafrikanische Frage begannen zwischen England und Deutschland im Dezember 1885 und fanden ihren Abschluß in dem internationalen Abkommen zu London am 1. November 1886.
Das Londoner Abkommen erkannte dem Sultan die Souveränität über Sansibar, Pemba, Lamu und Mafia zu, sowie einen Besitz an der Küste in einer Tiefe von 10 Seemeilen vom Rovuma bis Kipini. Um jedoch der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft einen Zugang zur See zu verschaffen, ohne welchen der Besitz des Innern ja gänzlich wertlos gewesen wäre, machte England im Londoner Abkommen sich anheischig, im Einverständnis mit Deutschland beim Sultan auf die Verpachtung der Zölle in den Häfen von Daressalam und Pangani an die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft hinzuwirken, nachdem bereits im September 1885 die Mitbenutzung Daressalams zugestanden worden war. Gleichzeitig kamen beide Mächte überein, eine Abgrenzung ihrer gegenseitigen Interessensphäre in diesem Teile des ostafrikanischen Festlandes vorzunehmen. Der letztgenannte Punkt bildet die Grundlage des deutsch-englischen Abkommens von 1890.
Mit dem Londoner Vertrage war nunmehr endlich eine politische, internationale Grundlage für die deutsche Kolonisation Ostafrikas geschaffen. Die erste günstige Wirkung derselben war die Erkenntnis, daß nicht wie bisher durch verhältnismäßig geringfügige Kapitalbeteiligung ein Erfolg zu erzielen sei. Das Großkapital sollte und mußte herangezogen werden und die Gesellschaft selbst verlangte eine Neuorganisation.
[S. 19]
Im Februar 1887 verwandelte sich die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft, die Leitung wurde in die Hände eines Verwaltungsrats gelegt und Dr. Peters zum Generalvertreter in Sansibar ernannt.
In der That gelang es Peters schon im Jahre 1887, den Sultan Said Bargasch zu einer Abtretung der Zölle zu bringen, aber die Ratifikation des Vertrages durch die Direktoren der Gesellschaft verzögerte sich so lange, daß Said Bargasch darüber hinstarb und erst unter Said Kalifa im April 1888 der überaus wichtige Küstenvertrag zu Stande kam, durch welchen die gesamten Festlandszölle, so weit sie die Ausfuhr betrafen, an die Gesellschaft abgetreten wurden. Da dieser Küstenvertrag die eigentliche Grundlage und Ursache des Aufstandes bildet, so mögen seine Bestimmungen hier Platz finden:
»Dem Sultan sollen keine Verbindlichkeiten erwachsen weder aus den Kosten der Besitzergreifung der Küste durch die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, noch auch aus den daraus etwa entstehenden Kriegszuständen. Dagegen willigt er ein, alle Akte und Handlungen, welche erforderlich sind, um die Bestimmungen des Vertrags zur Ausführung zu bringen, vorzunehmen und der Gesellschaft mit seiner ganzen Autorität und Macht zu helfen.«
»Im ersten Jahre liefert die Gesellschaft den ganzen Betrag der erhobenen Ein- und Ausfuhrzölle an den Sultan ab, abzüglich der Geschäftsunkosten (nicht über 272000 M.) und einer Kommissionsgebühr von 5 Prozent. Auf Grund der im ersten Jahre gemachten Erfahrungen soll die Durchschnittssumme der jährlich zu zahlenden Pacht festgestellt werden.«
»Die Gesellschaft wird ermächtigt, Beamte einzusetzen, Gesetze zu erlassen, Gerichtshöfe einzurichten, Verträge mit Häuptlingen zu schließen; alles noch nicht in Besitz genommene Land zu erwerben, Steuern, Abgaben und Zölle zu erheben, Vorschriften für den Handel und Verkehr zu erlassen, die Einfuhr von Waaren, Waffen und Munition und allen andern Gütern, welche nach ihrer Ansicht der öffentlichen Ordnung schädlich sind, zu verhindern; alle Häfen in Besitz zu nehmen und von den Schiffen Abgaben zu erheben.«
[S. 20]
»Die Verwaltung soll im Namen des Sultans und unter seiner Flagge, sowie unter Wahrung seiner Souveränitätsrechte geführt werden. Der Sultan erhält eine nach einem Jahr festzustellende Pachtsumme, ferner 50 Prozent des Reineinkommens, welches aus den Zollabgaben der Häfen fließen wird; endlich die Dividende von zwanzig Anteilscheinen der Gesellschaft à 10000 M., nachdem Zinsen in der Höhe von 8 Prozent auf das eingezahlte Kapital der Anteilscheinbesitzer bezahlt worden sind.«
Zur Zeit dieses Vertragsabschlusses besaß die Ostafrikanische Gesellschaft in Deutsch-Ostafrika folgende 18 Stationen:
Auf Sansibar selbst: die Hauptstation Sansibar;
in Usaramo: Bagamoyo, Daressalam, Dunda, Madimola, Usungula;
in Usambara: Pangani, Korogwe, Mafi;
im Süden zwischen Rufidji und Rovuma: Kilwa, Lindi, Mikindani;
in Usagara: Sima und Kiora;
weiter westlich in Ugogo: Mpapua;
in Usegua: Mbusini (Petershöhe);
am Kilimandscharo: Moschi und Aruscha.
Von diesen waren nur Kilwa, Lindi und Mikindani Zollstationen. Im übrigen wurden die Zölle in Sansibar selbst erhoben, da der gesamte Verkehr von der Nordküste sich über Sansibar bewegte. Die Stationen im Innern waren vor der Hand als Stützpunkte für Erwerbungen oder eventuelle spätere wirtschaftliche Ausnutzung anzusehen. Den Beamten der Gesellschaft, welche die betreffenden Stationen inne hatten, blieb es je nach ihrer Befähigung und Initiative überlassen, daraus zu machen, was sie konnten oder wollten.
[S. 21]
Hoheitsrechte der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. — Übernahme der Küste, Schwierigkeiten bei Ausübung der Souveränität. — Widerstand der Araber und Inder. — Unzufriedenheit der Küstenbevölkerung. — Machtlosigkeit der Gesellschaft. — Sultanssoldaten im Dienst der Gesellschaft. — Einfluß des Sultans auf dieselben. — Verhalten der Gesellschaftsbeamten. — Weigerung des Wali von Pangani, die Gesellschaftsflagge zu hissen. — Eingreifen der Möwe und Carola. — Ausweisung des Wali. — Erneute Unruhen in Pangani. — Einschreiten des Generals Matthews. — Zurückziehung der Gesellschaftsbeamten. — Unruhen in Tanga. — Zustände in Bagamoyo. — Wühlereien der Bagamoyo-Jumbes. — Angriffe auf das Gesellschaftsgebäude. — Versuch, den Admiral abzufangen. — Besetzung Bagamoyos durch die Marine. — Streifzüge Gravenreuths. — Erstes Eingreifen Buschiris. — Buschiri landet mit 800 Mann in Sadani. — Vorrücken auf Bagamoyo. — Befestigung dieser Station durch Zelewski. — Angriffe auf Bagamoyo. — Stellung der Katholischen Mission. — Verhältnisse um Daressalam. — Angriff auf die katholische Mission in Pugu. — Ermordung der Missionare. — Verhältnisse im Süden. — Aufgabe von Lindi und Mikindani. — Ermordung der Gesellschaftsbeamten in Kilwa. — Wirkung dieser Nachrichten in Deutschland. — Blokade-Erklärung. — Antisklaverei-Antrag des Dr. Windthorst. — Errichtung des Kommissariats.
Durch den Vertrag der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft mit Said Kalifa ging außer der Verwaltung der Zölle auch die Ausübung der Hoheitsrechte des Sultans (Verwaltung und Gerichtsbarkeit) an die Gesellschaft über. Als äußeres Zeichen dafür sollte überall, wo Stationen der Gesellschaft im Sultansgebiet sich befanden, zugleich mit der Sultansflagge die Flagge der Gesellschaft gehißt werden. Jedoch schon bald nach der Uebernahme der Küste wiesen erfahrene Gesellschaftsbeamte[S. 22] wie von Zelewski und Freiherr von Eberstein in ihren Berichten an den Generalvertreter darauf hin, daß die der Gesellschaft vertragsmäßig zu teil gewordenen Hoheitsrechte auf die Dauer von den Beamten nicht würden ausgeübt werden können; die nächste Zeit hat gezeigt, wie berechtigt diese Befürchtungen waren.
Es waren zwar die Eingeborenen und alle Bewohner des Küstendistrikts durchaus geneigt, der Gesellschaft die üblichen Zölle zu zahlen, da sie in der Uebertragung derselben an die Gesellschaft eine einfache Verpachtung sahen, wie eine solche auch schon früher von Seiten des Sultans an andere Personen besonders Inder, stattgefunden hatte, und es hätte diese Zollerhebung seitens der Gesellschaft ohne den geringsten Machtaufwand ungestört überall stattfanden können, — wenn nur nicht damit eine Ausübung der Souveränität verbunden gewesen wäre.
Bei dem überaus conservativen Charakter der arabischen Bevölkerung, bei ihrer Eigenart, vom kleinsten Gemeinwesen hinauf bis zum Staat patriarchalische Organisationen zu schaffen, für welche das Religionsgesetz den Nahmen gab, mußte ein solcher Versuch um so schwerere Bedenken erregen, als gar keine wirkliche Macht dahinter stand. — Den Fremden, den Ungläubigen, deren Persönlichkeiten ihnen noch dazu meist gänzlich fremd waren und von den ihnen unbekannt war, ob sie ihre Sitten respektieren würden, mochten die Araber sich nicht fügen. Sie sahen die Ausübung der Souveränität im Namen des Sultans von Seiten der Gesellschaftsbeamten nur als Anfang zu gänzlicher Unterwerfung unter die deutsche Herrschaft an; sie fürchteten durch zu hartes Vorgehen der neuen Beamten in der Sklavenfrage eine Schädigung ihrer Interessen und glaubten ihre gesamte Existenz aufs äußerste bedroht, da sie befürchteten, daß sie auch in ihrem rein kaufmännischen Gewerbe beeinträchtigt werden würden. Das letztere Moment hatte sich übrigens schon früher in Tabora geltend gemacht, wo die Araber mit allen Mitteln gegen die europäische Konkurrenz zuerst die eines Franzosen und dann der großen Hamburger Elfenbeinfirma Meyer, ankämpften. Ein Angestellter der Firma, Herr Giesecke, wurde im Jahre 1887 von den Arabern mit[S. 23] Erlaubnis des Häuptlings Sikke von Unianiembe — aus Geschäftsrücksichten — ermordet.
Die Furcht vor dieser kaufmännischen Konkurrenz einerseits, sowie das Faktum einer im Lauf der Zeit eingetretenen großen Abhängigkeit der Araber von den Indern war übrigens auch für letztere ein Grund, sich bei Ausbruch des Aufstandes den Rebellen gegenüber sympathisch zu verhalten. Sie traten uns natürlich nicht mit den Waffen in der Hand entgegen, leisteten aber doch durch Lieferung von Waffen und Munition sowie durch Spionage den Aufständischen Vorschub.
Ein weiterer Grund zur Unzufriedenheit war der, daß vielen Küsten-Leuten und zwar Arabern wie Negern ein sehr bequemes Einkommen, welches sie bis dahin gehabt hatten, der Natur der Verhältnisse nach mit der Neuordnung genommen wurde. Es bezieht sich dies auf die Walis, Akidas und Jumbes in den Hauptküstenplätzen Bagamoyo, Pangani, Kilwa und Lindi. Hier war überall von den genannten Personen unter allen möglichen Vorwänden und Titeln den Karawanen Tribut abgenommen worden. Daß die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft einem derartigen Unfug sofort ein Ende machen mußte, war selbstverständlich; aber ebenso selbstverständlich war es, daß die geschädigten Mrimaleute solche Maßregeln als ganz unerlaubten Eingriff in ihre Rechte betrachteten.
Dennoch würden alle diese Gründe zusammen nie den Ausbruch eines allgemeinen Aufstandes herbeigeführt haben, wenn die Gesellschaft in der Lage gewesen wäre, bei Uebernahme der Verwaltung den Arabern und Küstenbewohnern einen nachhaltigen Respekt durch Entfaltung von Machtmitteln einzuflößen. Hierzu langten aber die Mittel nicht, und die deutsche Reichsregierung zeigte sich damals noch nicht geneigt, mit Nachdruck für die Gesellschaft einzutreten. — Die einzigen militärischen Kräfte, welche die Gesellschaft hinter sich hatte, waren die unter den Walis und Akidas der Küstenplätze bisher beschäftigten Sultanssoldaten, die ihrerseits aber von jeher in engem Kontakt mit der Bevölkerung gestanden hatten und da sie Geschenke von dieser empfingen, auch von ihr abhängig waren. Sie haben den Beamten nur geschadet, indem sie meist zu den Rebellen übertraten und offen gegen die deutsche Herrschaft[S. 24] ankämpften. Dazu kam, daß der Sultan von vornherein kaum gesonnen war, den abgeschlossenen Vertrag wirklich zu halten, sondern seinen Organen an der Küste geheime Instruktionen zugehen ließ, nach Möglichkeit Schwierigkeiten zu machen. So trug er selbst zum Ausbruch des Aufstandes bei, bis schließlich, als er ein Interesse daran hatte, die Unruhen zu ersticken, ihm seine sogenannten Unterthanen nicht mehr folgsam waren.
Nur wenige Leute unter den früheren Sultansbeamten haben wirklich, nachdem sie in deutsche Dienste getreten waren, ehrlich zu den Deutschen gehalten und an ihrer Seite auch zur Zeit des Unglücks ausgeharrt, so z. B. Schech Amer, Said Magram in Bagamoyo und Mohammed ben Seliman in Daressalam.
Als einen wesentlichen Grund zum Aufstande beliebte man damals daheim wie in Sansibar von gegnerischer Seite das Benehmen der Gesellschaftsbeamten den Eingeborenen gegenüber anzugeben. Es ist dies völlig unzutreffend, und es sind im Gegenteil aus dem Gesellschaftsdienst diejenigen Leute hervorgegangen, welche durch ihre Kenntnis der Verhältnisse und nicht zum mindesten dadurch, daß sie die Leute zu behandeln gelernt hatten, dem Reichskommissar später am meisten genützt haben. Wenn auch hier und da einmal Ausnahmen von der Regel vorgekommen sind, so stehen jene wenigen Ausnahmen absolut nicht in ursächlichem Zusammenhang mit dem Ausbruch des Aufstandes. Ebenso falsch ist es, wenn der Aufstand als ein von den Muhamedanern als solchen gegen uns Christen angefachter Krieg hingestellt wird. Es ist allerdings von geschickten Führern das religiöse Moment später mit hereingezogen worden, aber nur künstlich, um durch ein allgemein verständliches Motiv die Massen mehr in die Hand zu bekommen. Wenn wir auf den erbeuteten Fahnen vielfach religiöse Inschriften fanden, so sind dies Koransprüche, wie sie der Sitte gemäß von den Krieg führenden Muhamedanern auf allen ihren Fahnen angebracht werden; keineswegs sind sie aus besonderem Fanatismus gegen uns verwendet worden.
Die im Vorstehenden aufgeführten Gründe zur Unzufriedenheit der Küstenbevölkerung wurden damals weder von der[S. 25] Leitung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft noch von der Vertretung der Reichsregierung in Sansibar genügend erkannt und gewürdigt; man ließ sich an der papiernen Macht des Küstenvertrages genügen und installierte zunächst ohne wesentliche Schwierigkeiten je zwei Beamte in den Küstenstationen Tanga, Pangani, Bagamoyo, Daressalam, Lindi und Mikindani. Bald aber gewann die Gährung an der Küste einen greifbaren Ausdruck.
Die ersten unbefriedigenden Nachrichten kamen aus Pangani. Der dortige Bezirkschef der Gesellschaft, Herr von Zelewski berichtete, daß der Wali von Pangani dem ihm vom Sultan erteilten Befehl, sich dem Bezirkschef zu fügen, nicht nachkäme und daß er gegen die Hissung der Gesellschaftsflagge protestiere. Es wurde in Folge dieses Berichtes der Kreuzer »Möwe« am 17. August 1888 nach Pangani abgesandt. Sein Erscheinen bewirkte, daß der Wali versprach, den Bezirkschef als seinen Vorgesetzten anzuerkennen und seinen Befehlen in jeder Beziehung nachzukommen. Daraufhin dampfte die Möwe wieder von Pangani ab, eine Macht wurde nicht zurückgelassen; man ließ es darauf ankommen, ob die Sache gut gehen werde oder nicht. Kaum aber war das Schiff außer Sicht, da verweigerte der Wali wiederum den Gehorsam, und dasselbe thaten auf sein Anstiften hin die in den Dienst der Gesellschaft übergetretenen Sultanssoldaten. Als darauf am 18. August die Carola bei Pangani vorbeikam, um sich nach der inzwischen erfolgten Entwicklung der Verhältnisse zu erkundigen, entsandte auf Antrag des Herrn von Zelewski der Kommandant des Schiffes am 19. ein Landungscorps, dessen Erscheinen die aufrührerische Bevölkerung einschüchterte. Die Abteilung der Marine drang bis zum Hause des Wali vor, um diesen dort gefangen zu nehmen, fand aber das Haus leer — der Wali war nach Sansibar geflohen. Man begnügte sich, die Sultanstruppen zu entwaffnen und ließ auf Antrag des Bezirkschefs 2 Unteroffiziere und 16 Matrosen als Wache im Stationsgebäude zurück. Die Carola verließ hierauf die Rhede, und am 23. erschien statt ihrer die Möwe, um die Wache wieder abzuholen.
Unbegreiflicherweise gab man sich damals trotz der soeben gemachten Erfahrungen einem derartigen Optimismus hin, daß[S. 26] man es nun schon wieder darauf ankommen ließ, ob die Sache weiterhin gut gehen würde oder nicht. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft that das einzige, was sie thun konnte; sie verfügte die Ausweisung des Wali von Pangani aus dem Küstengebiet und der Generalkonsul begnügte sich mit dieser Maßregel, weil durch diese Ausweisung der Wali für die Beamten der Gesellschaft unschädlich geworden war.
Die Folgen dieser Vertrauensseligkeit zeigten sich fast augenblicklich. Als der Bezirkschef von Pangani bei der Ankunft von 1000 Faß Pulver auf einer Dhau auf dem Pangani-Fluß das Landen dieser Menge von Munition verbot und verfügte, daß die Dhau nach Sansibar zurückkehren sollte, bildete diese an sich selbstverständliche Maßregel die Veranlassung zum Ausbruch wirklicher Unruhen. Der größte Teil der Bevölkerung rottete sich zusammen, zog vor das Haus der Gesellschaft und setzte die Beamten gefangen. Das Haus wurde verschlossen, eine Wache davor gesetzt und den Gefangenen jeder Verkehr nach außen untersagt.
Zufälligerweise war der General-Vertreter der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Konsul Vohsen, in begreiflicher Sorge um die Sicherheit seiner Beamten, gerade an diesem Tage auf dem Sultansdampfer Barawa nach Pangani unterwegs, um sich persönlich nach der Entwicklung der Verhältnisse zu erkundigen.
Obwohl er schon im Boot erfuhr, daß in Pangani Krieg sei und ihm von Wohlmeinenden dringend geraten wurde, nicht an Land zu gehen, setzte er die Fahrt fort, wurde indes durch die sein Boot beschießenden Rebellen zur Umkehr gezwungen. Die Barawa kehrte am nächsten Tage nach Sansibar zurück, und auf die Intervention des deutschen Generalkonsuls und des Konsuls Vohsen schickte nun der Sultan, nachdem die Barawa mit Vohsen an Bord wieder nach Pangani zurückgegangen war, seinen General Matthews mit Truppen nach Pangani, um die Beamten zu befreien. Die Befreiung derselben ist dem General nur mit Not und Mühe und unter eigener Lebensgefahr gelungen, ein Beweis dafür, daß die ohnehin schwache Autorität des Sultans ganz aufgehört hatte.
[S. 27]
In dem nördlichen Platze Tanga waren die beiden Gesellschaftsbeamten (v. Frankenberg und Klenze) gleichfalls in ihrem Stationshause am 5. September gefangen gesetzt worden, wurden aber am 6. September durch das Einschreiten der vor Tanga erscheinenden Möwe mit Waffengewalt befreit. Aus Pflichtgefühl lehnten die Beamten die ihnen angebotene Rückkehr auf der Möwe nach Sansibar ab und verblieben auf ihrem Posten. Die Möwe selbst überbrachte Meldung von dem Vorgefallenen nach Sansibar.
Die hierauf vor Tanga erscheinenden Kriegsschiffe Leipzig, Olga und wiederum Möwe schickten dann in der Nacht vom 7. zum 8. ein Landungscorps aus und machten den Versuch, den Wali gefangen zu nehmen, der jedoch auch hier mißlang. Die Beamten wurden auf Befehl der Generalvertretung von der Leipzig nach Sansibar gebracht.
In Bagamoyo als dem Hauptplatz der Küste hatte am 16. August unter besonderen Feierlichkeiten die Flaggenhissung und die Übergabe an die Gesellschaft im Beisein des General-Vertreters stattgefunden. Der Wali hatte sich bereit erklärt, in den Dienst der Gesellschaft überzutreten und hatte nur in einem Punkte Schwierigkeiten gemacht, nämlich als von ihm die Entfernung der Sultansflagge von seinem Hause gefordert wurde. Doch gelang es in den darauf mit ihm geführten Verhandlungen, diese Schwierigkeit zu beseitigen, indem auch auf seinem Hause die Sultansflagge neben der Gesellschaftsflagge weiterhin gehißt wurde. Aber auch hier erwiesen sich bald die Verhältnisse als unhaltbar. Grade in Bagamoyo fühlten sich die Jumbes Makanda, Bomboma und Simbambili in ihren Interessen bedroht und scharten eine große Masse Unzufriedener um sich. Bis zum 22. September hatte die Sache immerhin noch einen so friedlichen Anstrich, daß der Bezirkschef, Frhr. v. Gravenreuth, an Feindseligkeiten nicht dachte und am frühen Morgen jenes Tages mit dem Geschwaderchef, Admiral Deinhard auf einem Boot der Leipzig zur Flußpferdjagd in den Kingani fuhr. Als die Herren unterwegs waren, wurde den übrigen Gesellschaftsbeamten vom Wali mitgeteilt, daß er der Bewegung nicht mehr Herr werden könne, die Rebellen wollten gegen das Gesellschaftsgebäude vorgehen und es sei[S. 28] Gefahr im Anzuge. Die Beamten vereinigten ihre Askaris im Hause der Gesellschaft und hielten die Rebellenschar durch das in der Station befindliche 4,7 cm-Geschütz, welches der Stationsbeamte Rühle mit großer Bravour unter dem Feuer der Aufständischen bediente, von derselben fern. Die Rebellen wagten die Station selbst nicht zu stürmen, sondern zogen nach dem Strande, um das Gesellschaftsboot zu zerstören, wurden aber von einer Abteilung der Askaris, geführt von den Beamten, in der Richtung auf die französische Mission hin vertrieben. Zu gleicher Zeit war die Leipzig durch Signale von dem Angriff benachrichtigt worden und sandte ein Landungscorps nach der Stadt, das die Rebellen noch über die französische Mission hinaus verfolgte. Die geschlagenen Aufrührer haben dann noch den Versuch gemacht, den deutschen Admiral und den Bezirkschef im Kingani gefangen zu nehmen. Sie trafen das Boot mit genannten Herren an einer seichten Stelle des Flusses bei abfließendem Wasser festgefahren und suchten sie an das Ufer zu locken. Doch waren glücklicherweise die Herren durch einen Boten des Arabers Said Magram gewarnt und warteten im Fluß das Steigen des Wassers ab, um so am Abend an Bord der Leipzig zurückzukehren, wo der Admiral von den Vorfällen des Tages in Kenntnis gesetzt wurde.
Die persönliche Gefahr, welcher der Admiral durch das wackere Benehmen Said Magrams entronnen war, ließ nun plötzlich die Bedeutung des Aufruhrs in einem ganz anderen Lichte erscheinen, als man sie bisher zu betrachten gewohnt war. Daß mit bloßen Verhandlungen hier nichts zu erreichen war, lag auf der Hand.
Herr v. Gravenreuth, welcher vor Begierde brannte, die Aufrührer aus der nächsten Umgebung von Bagamoyo zu vertreiben, unterbreitete dem Admiral seine Pläne und nachdem dieser bereitwilligst in das Stationsgebäude zu Bagamoyo eine Abteilung der Marine unter dem Kommando eines Marineoffiziers gelegt hatte, war Gravenreuth in der Lage, mit den Gesellschaftsbeamten und den von ihm eingedrillten Stationssoldaten offensiv gegen die Rebellen vorzugehen. Er machte, in Bagamoyo angekommen, einen Streifzug in die Umgegend, schlug die Rebellen zurück und wiederholte diese Streifzüge[S. 29] mehrfach in nächster Zeit. So blieb er Herr der Situation und führte sogar eine auf dem Wege nach Bagamoyo befindliche Waniamuesi-Karawane, welche von den Rebellen abgefangen werden sollte, in die Stadt hinein. Eine andere große Waniamuesi-Karawane hingegen wurde nach der Straße von Daressalam abgedrängt.
Aber auch die Erfolge Gravenreuths konnten den andrängenden Strom nur für kurze Zeit eindämmen. Der Aufruhr wuchs in riesigem Maße, die einzelnen Herde desselben flossen in einander und bald erschien die Person des Führers auf dem Schauplatze, dessen organisatorischem Talente und dessen Energie die Massen sich unterordneten.
Dies war der Halbaraber Buschiri, der sich bereits früher unter Said Madjid im Innern durch seine Anteilnahme an den Kämpfen gegen Mirambo ausgezeichnet hatte. Dann hatte er sich, an die Küste gekommen, am Panganifluß auf einer Schamba niedergelassen. Als Said Bargasch zur Regierung kam, wurde er von diesem wiederholt vor Gericht gefordert wegen beträchtlicher gegen ihn schwebender Geldforderungen. Er entzog sich jedoch dem Richterspruch des Sultans und leistete auch, da er sich bei seiner Schamba durch Anlegung einer starken Buschboma befestigt hatte, den Soldaten Said Bargaschs erfolgreichen Widerstand, so daß letzterer es schließlich vorzog, ihn nicht mehr weiter zu behelligen.
So hatte Buschiri unter der Küstenbevölkerung und den Arabern sich ein gewisses Renommee erworben; tatsächlichen größeren Einfluß wußte er erst unter geschickter Benutzung der Verhältnisse bei Ausbruch des Aufstandes gegen die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft zu erlangen.
Buschiri schiffte sich in Pangani mit 800 Mann ein und landete dieselben in Sadani, wo er den Machthaber Useguas, Bana Heri zum Aufstand anreizte, ohne daß es ihm jedoch damals glückte, eine Verbindung mit demselben zu erlangen. Von Sadani zog Buschiri über Land nach Bagamoyo und übernahm hier die Führung der vereinigten Bagamoyo-Jumbes und ihrer Horden. Seine Hauptstütze, gewissermaßen sein Generalstabschef, war der Komorenser Jehasi, der früher als Artillerist im Congostaat gedient hatte und dementsprechend[S. 30] auch bei Buschiri seine Hauptverwendung in der Bedienung der der Gesellschaft abgenommenen Geschütze fand.
Mit dem Erscheinen Buschiris und der Vermehrung der Rebellenkräfte um Bagamoyo verschlimmerte sich daselbst die Lage der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft auf das äußerste.
Von einem Verwaltungsdienst oder gar von Zollerhebung seitens der Beamten konnte naturgemäß nicht mehr die Rede sein. Schon jetzt kamen lediglich militärische Gesichtspunkte in Betracht, vor allem die Behauptung der Stadt Bagamoyo selbst.
Herr von Gravenreuth war um diese Zeit durch schwere Fieberanfälle genötigt worden, nach Deutschland zurückzukehren und hier Heilung zu suchen. Das Kommando der Station und die Verteidigung der Stadt übernahm Herr v. Zelewski, der bereits als Bezirkschef von Pangani Erwähnung fand. Er sah ein, daß den stark überlegenen Kräften bei der geringen Zahl der Gesellschaftsaskaris nicht mehr nach dem Gravenreuthschen System der Offensive durch Ausfälle aus der Station beizukommen sei, zumal die Hilfe der Marine ausschließlich für die Besetzung und Verteidigung der Station bestimmt war. Zelewski, aufs Eifrigste unterstützt von Wilkens, befestigte infolgedessen das Wohnhaus der Gesellschaft, indem er es mit einer Mauer umgab, diese zur Verteidigung durch die Askaris und Europäer einrichtete und das Land in der nächsten Umgebung der Station frei legte, um ein hinreichendes Schußfeld gegen die nunmehr öfters gemachten Angriffe der Rebellen zu haben. Alle Europäer, die damals unter Zelewskis Kommando die Station hielten, schreiben es seiner Umsicht und seinem Verdienst zu, daß es ihm und seinem Nachfolger ermöglicht wurde, den Platz bis zum Eingreifen der Schutztruppe zu halten.
Im Dezember 1888 mußte auch Zelewski, nachdem er 3 Jahre in Ostafrika ausgehalten hatte, wegen seines Gesundheitszustandes die Heimat aufsuchen und das Kommando der Station ging nun an Herrn v. Eberstein über, der den weiteren Ausbau und die Verteidigung im Sinne Zelewskis leitete.
Die im Dezember, Januar und Februar von Buschiri unternommenen Angriffe wurden stets zurückgeschlagen; doch[S. 31] konnte nicht verhindert werden, daß die Stadt Bagamoyo von ihm zum großen Teil gebrandschatzt und zerstört wurde.
Der letzte Angriff auf die Station fand am 3. März 1889 statt; die Rebellen wurden abermals zurückgeschlagen, und es wurde durch die Herren Lieutenant Meyer mit der Marinebesatzung und Ostermann, von Medem und Illich das eine der von Buschiri der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft abgenommenen 4,7 cm-Geschütze zurückerobert. Buschiri bezog hierauf ein befestigtes Lager beim Dorf Kaule.
Der einzige Ort, welcher während aller dieser Kämpfe in Bagamoyo seine völlige Neutralität zu bewahren verstand, und von den Eingeborenen als sichere Zufluchtsstätte betrachtet wurde, war die katholische Mission. Ihr kluges Verhalten und die den Arabern wie Eingeborenen stets entgegengebrachte Humanität sicherten ihr diese merkwürdige Ausnahmestellung und verschaffte gleichzeitig uns Deutschen wesentliche Vorteile.
Von der Mission aus wurden die bedrängten Deutschen stets mit Nachrichten über die Bewegungen und die Absichten der Rebellen versehen, Nachrichten, die in erster Linie der in den weitesten Kreisen bekannte Bruder Oskar oft mit eigener Gefahr persönlich den Deutschen übermittelte, wenn er nicht, was auch geschah, in wenigen Zeilen auf einem Zettel oft recht drastischen Inhalts (wie: »Passen Sie auf! die Schweinehunde kommen morgen um 10«) uns Nachrichten zukommen ließ.
Derjenige Platz, welcher unter dem Aufstande zunächst am wenigsten zu leiden hatte, war Daressalam. Es erklärt sich dies zwar teilweise aus der geringen Bedeutung dieses Platzes für den Karawanenverkehr, der geringen Einwohnerzahl und der unkriegerischen Gesinnung der umwohnenden Wasaramo, zum wesentlichen Teil aber verdankte Daressalam seinen friedlichen Zustand dem Geschick und der Energie des Stationschefs Leue, der vor Ausbruch des Aufstandes bereits Gelegenheit gehabt hatte, sich dort vollkommen einzuleben und in Respekt bei den Arabern und Eingeborenen zu setzen, — seit seiner Ankunft in Afrika im Jahre 1887 war er einzig und allein an diesem Platze thätig gewesen. Leues Hauptstütze war unter der Bevölkerung der uns durchaus ergebene Akida Mohammed ben Seliman.
[S. 32]
Erst im Dezember erreichte der Aufstand Daressalam, und zwar hauptsächlich infolge des Umstandes, daß eine große Zahl befreiter Sklaven auf der Missionsstation daselbst untergebracht wurde. Der Araber Seliman ben Sef organisierte jetzt seinen Anhang von Arabern, Belutschen und früheren Sultanssoldaten und verband sich mit der Partei des Negers Schindu, welche bisher gegen Leues Autorität offen anzutreten nicht gewagt hatte. Schließlich kam es auch in Daressalam so weit, daß sich sowohl der Bezirkschef Leue wie auch sein Nachfolger auf jenem Stationsposten, Herr v. Bülow (auch Leue mußte wegen perniziösen Fiebers Ostafrika verlassen) nur mit Hilfe eines im Hafen von Daressalam stationierten Kriegsschiffes und einer in das Stationsgebäude gelegten Marinebesatzung halten konnten.
Ende Dezember 1888 und Januar 1889 erfolgten Angriffe seitens der Rebellen, die ihre sämtlichen Kräfte dicht bei Daressalam vereinigt hatten und diesen Ort selbst unsicher machten. Die Angriffe wurden stets durch die Geschosse des Kriegsschiffes — es lagen abwechselnd Möwe, Sophie, Carola dort vor Anker — und die wenigen wohlgedrillten Askaris unter Herrn von Bülow, zurückgeschlagen.
Leider blieben die in und um Daressalam thätigen Missionsgesellschaften nicht vor der Wut der Rebellen verschont. So wurde am 10. Januar die dortige evangelische Missionsstation angegriffen. Ihr Leiter, der Missionar Greiner, welcher mit seiner Frau und Nichte die Station bewohnte, hatte auf die von der Marine und der Gesellschaft gemachten Vorstellungen (ein Angriff wurde erwartet) in übertriebenem Glaubenseifer nicht hören wollen. Nur mit Mühe und Not konnte er sich mit den Seinigen und einigen Missionskindern in ein Boot retten, nachdem er vorher mit der Flinte in der Hand Widerstand geleistet und nachdem einige Geschosse von der Möwe bei der Flucht in das Boot die folgenden Rebellen verscheucht hatten. Hierbei riß allerdings eine Revolvergranate der Nichte Greiners zwei Finger ab.
Schlimmer erging es den katholischen Missionaren von Pugu. Nach dieser Station hatten sich Herr v. Bülow, Herr Küsel und einige Askari, als der Aufstand schon im Ausbruch[S. 33] begriffen war, begeben in der Absicht, die Missionare zu warnen und dieselben nach Daressalam zurückzubringen. Doch auch hier wollten die Missionare nicht hören. Sie glaubten, den Rebellen gegenüber durch ihr früheres Wirken eine derartige Stellung einzunehmen, daß sie nichts von der Wut derselben zu fürchten hätten und wollten deshalb auf ihrem Posten ausharren.
Doch auch sie wurden im Januar eines Tages, als sie sich gerade zum Mittagessen anschickten, von eindringenden Rebellen angegriffen und drei der Missionsangehörigen durch Schüsse und Stiche niedergemacht. Es waren dies der Bruder Petrus, der Bruder Benedict und die Schwester Martha. Letztere wurde vielfach verstümmelt, der Leib von Araberdolchen aufgeschlitzt, liegengelassen. Die Schwester Benedicta, welche krank zu Bett lag, sollte ebenfalls niedergestochen werden, als einige Araber einschritten und die Neger von diesen Grausamkeiten zurückhielten. Die Kranke und drei Brüder wurden gefangen genommen und nach Kondutschi gebracht. Durch Vermittlung der französischen Mission wurden dann diese vier Gefangenen gegen ein hohes Lösegeld ausgeliefert. Die übrigen Missionsangehörigen waren durch die Flucht nach Daressalam entkommen.
Die Stationen Dunda, Madimola und Usungula fielen, nachdem die Beamten von der Gesellschaftsvertretung nach der Küste zurückgerufen worden waren, zum Teil mit den Geschützen und Gewehren, die man nicht mehr hatte fortschaffen können, in die Hände der Rebellen.
Die übrigen Stationen im Innern waren bereits früher aufgegeben worden bis auf die Station Mpapua, mit der die Verbindung unterbrochen war und die auch zunächst durch den Aufstand nicht behelligt wurde.
Besonders schwierig lagen die Verhältnisse in unserm südlichen Küstengebiet. War dort schon die Herrschaft des Sultans von Sansibar eine höchst fragwürdige, so hatten Europäer bis dahin jene Gebiete nur vereinzelt als Reisende betreten und waren außerdem durch das übereilte Vorgehen der Engländer besonders an der Lindi- und Mikindani-Küste bei Arabern und Eingeborenen verhaßt. Die genannten Stationen sollten von[S. 34] teilweise in Afrika erfahrenen Leuten besetzt werden, aber man verlangte von ihnen, daß sie die von der Gesellschaft ihnen aufgegebenen Pflichten ohne jede Aufwendung von Macht erfüllten. Die Unmöglichkeit, dieser Aufgabe gerecht zu werden, braucht nicht bewiesen zu werden. Der Zusammenbruch der Verhältnisse war so in kurzer Zeit zu erwarten.
Vom 21. Dezember datiert der Beginn der Feindseligkeiten im Süden. In Lindi und Mikindani gelang es den dortigen Beamten, in Mikindani den Herren v. Bülow und Pfrank, in Lindi den Herren v. Eberstein und Küsel, sich noch im letzten Augenblick mit Hilfe einiger Wohlgesinnter zu retten, nachdem sie so lange wie möglich auf ihrem Posten ausgeharrt hatten. In Kilwa hingegen, dem 3. Punkt im Süden, wurden die beiden Gesellschaftsbeamten Krieger und Hessel ein Opfer der Situation. Nachdem auch hier von Seiten des Wali sowohl als der Bevölkerung Kilwas den Beamten schon von Anfang an die größten Schwierigkeiten gemacht worden waren, verschlimmerte sich ihre Lage durch das Erscheinen von Tausenden von Wahiyaos, welche mit den Rebellen das leider im Innern der Stadt gelegene Wohnhaus der Gesellschaft umzingelten und den Beamten jeglichen Verkehr nach außen hin abschnitten. Lange Zeit verteidigten sich die beiden wackeren Beamten mit größter Unerschrockenheit und brachten ihren Bedrängern erhebliche Verluste bei, da endlich schien für die Belagerten Hoffnung zu kommen mit dem Erscheinen S. M. S. Möwe, mit der in Verbindung zu treten ihnen auch schließlich durch Notsignale gelang. Indes ist, obgleich auf der Möwe die schwierige Lage der Landsleute in Kilwa erkannt wurde und obgleich die gesamten Offiziere der Möwe und sogar der Zahlmeister beim stellvertretenden Kommandanten dieses Kriegsschiffes dringend eine Landung erbaten, um den Bedrängten Hilfe zu bringen, nichts geschehen. Als dann die Beamten sahen, daß die Möwe sogar abdampfte und ihnen die letzte Hoffnung auf Rettung genommen werden sollte, da erkletterte Krieger angesichts der Tausende sie umringenden Rebellen einen im Hof des Wohnhauses stehenden hohen Baum, um noch einmal durch Signale dem Kriegsschiffe ihre gefährliche Lage zu erkennen zu geben. Er wurde[S. 35] bei diesem Versuch, Hilfe zu erlangen, vom Baum herabgeschossen, und nun erstürmte der Haufen die Station. Beim Eindringen der Rebellen durch die Thüre erkannte Hessel, daß alles verloren sei, und um nicht in die Hände der grausamen Feinde zu fallen, machte er selbst seinem Leben durch eine Kugel ein Ende. Das Verhalten des Kommandanten der Möwe wurde auf die ihm vom Geschwaderchef Deinhard erteilte Ordre zurückgeführt, in keinem Falle einen Landungsversuch zu unternehmen, um nicht wie bei Tanga kriegerische Ereignisse dadurch zu provozieren. Der Kommandant hat sich wörtlich an diese, für einen Fall wie den vorliegenden gewiß nicht berechnete Instruktion gehalten und hat daher als gehorsamer Soldat, also vom rein militärischen Standpunkt richtig gehandelt.
Inzwischen war durch die Ereignisse in Ostafrika die ganze zivilisierte Welt in Erregung geraten. Während unsere Mitbewerber in Ostafrika ihre Schadenfreude schlecht verhehlen konnten, machte sich in Deutschland naturgemäß ein mächtiger Umschlag der öffentlichen Meinung geltend. Selbst bei denjenigen, welche der Kolonialpolitik im allgemeinen gleichgültig gegenüberstanden, rührte sich das Nationalgefühl und fand in dem allgemeinen Verlangen Ausdruck, der deutschen Sache in Ostafrika einen nachdrücklichen Schutz angedeihen zu lassen. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft richtete ihrerseits am 15. September 1888 eine Eingabe an den Reichskanzler, in welcher sie auf Grund ihrer telegraphischen Berichte aus Sansibar den Ernst der Lage darlegte und außerordentliche Machtakte als notwendig hinstellte. Am 21. September folgte eine zweite Eingabe, in welcher das Verhalten des Sultans als durchaus zweifelhaft dargelegt wurde und man außerdem darauf hinwies, daß der Sultan in jedem Fall es an dem guten Willen habe fehlen lassen, welchen er im Vertrage vom April 1888 verbürgt hatte. Bereits am 3. Oktober wurde abermals dem Reichskanzler ein Telegramm vorgelegt, in welchem der Generalvertreter der Gesellschaft in Sansibar eine fortdauernde Besetzung der Küste als unumgänglich notwendig bezeichnete.
In Anbetracht des Tempos, welches die Reichsregierung bisher in bezug auf koloniale Angelegenheiten besonders in[S. 36] Ostafrika eingeschlagen hatte, ließ sich kaum erwarten, daß ohne weiteres die Wünsche der Gesellschaft in ihrem ganzen Umfang sich erfüllen würden. Die politischen Gegner, mit welchen der Reichskanzler bei allem guten Willen seinerseits besonders in der Kolonialfrage zu rechnen hatte, würden unter keinen Umständen zu einem solchen Umschlage der Meinung zu bringen gewesen sein, daß sie das direkte Eingreifen der deutschen Macht am afrikanischen Festlande sich hätten abringen lassen. Der Reichskanzler fühlte sich daher genötigt, eine Art Mittelweg zunächst zu wählen; und zu diesem bot das Moment der Sklavenausfuhr, welches man als Triebfeder des Aufstandes jedenfalls mitanführen konnte, die geeignetste Handhabe. Bereits Anfang September 1888 war der Reichskanzler in Verhandlung mit England, bald darauf auch mit Portugal als den an der ostafrikanischen Küste mitbeteiligten Mächten getreten, um zunächst eine gemeinsame Flottenaktion in Gestalt einer Blokade der gesamten Ostküste zustande zu bringen. Im November kamen diese Verhandlungen zum erwünschten Resultat, so daß am 27. November die Admirale Deinhard und Freemantle die nachstehende Blokade-Erklärung erlassen konnten:
»Auf Befehl unserer hohen Regierung und im Namen Sr. Hoheit des Sultans von Sansibar erklären wir, die kommandierenden Admirale des deutschen und englischen Geschwaders hiermit die Blokade der ununterbrochenen Küstenlinie des Sultanats von Sansibar mit Einschluß der Inseln Mafia, Lamu und einiger andrer kleinerer nahe der Küste legender Inseln zwischen 10° 28' und 2° 10' südlicher Breite. — Die Blokade ist nur gegen die Einfuhr von Kriegsmaterial und die Ausfuhr von Sklaven gerichtet. — Die Blokade wird in Kraft treten am Mittag des 2. Dezember dieses Jahres.«
Deutscherseits waren an der Blokade beteiligt die Schiffe Leipzig, Carola, Sophie, Schwalbe, Möwe, Pfeil.
Der Blokadedienst gestaltete sich für die Marine zu einer ungemein schwierigen Aufgabe. Bei den geringen Tiefenverhältnissen der ostafrikanischen Küste war es den großen Kriegsschiffen gar nicht möglich, so nahe unter Land hinzufahren, daß sie die an der Küste direkt kreuzenden Dhaus abzufangen vermochten. Infolgedessen war die Mannschaft[S. 37] in ungemein großer Ausdehnung zum Bootsdienst gezwungen. Alle entbehrlichen Kutter und Pinassen wurden bemannt und kreuzten unter den schwierigsten Verhältnissen die Küste ab. Sehr häufig waren bei der Strenge des Admirals Deinhard, welcher an sich selbst die höchsten Anforderungen stellte und auch von Offizieren und Mannschaften das Menschenmöglichste verlangte, die Bootsmannschaften genötigt, sich Proviant und Wasser, so gut es anging, in den Negerdörfern der Küste zu verschaffen.
Der schließliche Erfolg der Blokade stand in gar keinem Verhältnis zu dem aufreibenden Dienst. Es ist allerdings gelungen, die Zufuhr größerer Massen von Kriegsmaterial nach Ostafrika teilweise zu verhindern, und es sind andrerseits einige Sklaven-Dhaus eingebracht worden. Die Zahl des vorgefundenen Menschenmaterials war aber so geringfügig daß man eigentlich von einer verhinderten Ausfuhr kaum sprechen konnte; eine solche bestand auch zur Zeit des Aufstandes nur in sehr geringem Maße. Immerhin gewährte jedoch in Deutschland selbst die Blokade die erste wesentliche Handhabe zu einem weiteren Vorgehen. Denn so viel sah jeder ein, daß das Eingreifen der Kriegsschiffe eben nur als Vorläufer der eigentlichen deutschen Machtentfaltung dienen sollte und konnte. Das Hineinbringen der Sklavereifrage seitens des Fürsten Bismarck erwies sich jedenfalls als eine außerordentlich praktische politische Maßnahme. Der Reichskanzler gewann dadurch die Unterstützung der stärksten Partei des Reichstags, nämlich des Centrums, dessen Führer Windthorst schwerlich zu Gunsten der bloßen Kolonialpolitik seinen berühmten Antrag gestellt hätte, welcher die Grundlage für das militärische Einschreiten des deutschen Reiches und die Besetzung der ostafrikanischen Küste bildete. Der Antrag wurde von Dr. Windthorst am 27. November 1888 unter dem Namen des Antisklaverei-Antrages eingebracht.
Am 6. Dezember 1888 wurde im Reichstag das erste Weißbuch, enthaltend Aktenstücke über den Aufstand in Ostafrika, vorgelegt, und am 14. Dezember gelangte der Antisklaverei-Antrag zur Annahme. Jetzt folgten die Ereignisse Schlag auf Schlag. Am 9. Januar 1889 richtete die Deutsch Ostafrikanische[S. 38] Gesellschaft eine Denkschrift an den Reichstag, in welcher die Entwicklung der Gesellschaft geschildert und der Aufruhr auf die Reaktion der arabischen Sklavenhändler gegen die christliche Kultur und den europäischen Wettbewerb sowie auf die Machtlosigkeit des Sultans von Sansibar zurückgeführt wurde. Am 12. Januar gelangte das zweite Weißbuch über den Aufstand im Reichstage zur Verteilung, und am 22. Januar trat die Regierung mit dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Bekämpfung des Sklavenhandels und den Schutz der deutschen Interessen in Ostafrika vor den Reichstag. Am 30. Januar gelangte das Gesetz in folgender Fassung zur Annahme:
»§ 1. Für Maßregeln zur Unterdrückung des Sklavenhandels und zum Schutz der deutschen Interessen in Ostafrika wird eine Summe in der Höhe von 2 Millionen Mark zur Verfügung gestellt. § 2. Die Ausführung der erforderlichen Maßregeln wird einem Reichskommissar übertragen. § 3. Der Reichskanzler wird ermächtigt, die erforderlichen Beträge nach Maßgabe des eintretenden Bedürfnisses aus den bereiten Mitteln der Reichs-Hauptkasse zu entnehmen.«
Zum Reichskommissar wurde am 3. Februar durch Allerhöchste Kabinetsordre Hauptmann Wißmann, à la suite des 2. Garderegiments zu Fuß, ernannt.
[S. 39]
Hermann Wißmann, sein Leben und seine Bedeutung. — Soldatenmaterial für die Schutztruppe. — Vorläufiger Bestand an Europäern. — Beschaffung einer Kommissariatsflotte. — Anwerbung der Sudanesen in Egypten. — Transport der Truppen nach Sansibar. — Anwerbung von Zulus. — Die Askaris an der Küste. — Vorarbeiten in Sansibar. — Regelung des Verhältnisses zwischen Reichskommissar und der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. — Rekognoszierungsfahrt Wißmanns. — Zustand der beiden Stationen Bagamoyo und Daressalam. — Erster Waffen- und Munitionstransport. — Waffenstillstand zwischen Admiral Deinhard und den Rebellen. — Bruch des Waffenstillstandes durch Buschiri. — Ankunft der Sudanesen. — Vorhandenes Europäer-Material. — Verteilung desselben auf die Stationen Bagamoyo und Daressalam.
Hermann Wißmann wurde am 4. September 1853 als Sohn des Regierungsassessor Hermann Ludwig Wißmann und seiner Ehefrau Elise, geb. Schach von Wittenau zu Frankfurt a. O. geboren. Seine erste Schulbildung erhielt Wißmann auf der Bürgerschule in Langensalza. Dann trat er in die Realschule zu Erfurt und ein Jahr später in das dortige Gymnasium ein. 1867 wurde Wißmanns Vater als Regierungsrat von Erfurt nach Kiel versetzt und so ein abermaliger Schulwechsel des Knaben nötig. Bereits 1868 siedelte die Familie nach Neu-Ruppin über. Hier starb 1869 der Vater. 1870 trat der Sohn in die Prima des Kadettenkorps zu Berlin ein und legte hier Ostern 1873 in glänzender Weise sein Fähnrichsexamen ab, worauf er in das zu Rostock garnisonierende Mecklenburgische Füsilier-Regiment Nr. 90 eingestellt wurde. Nach einem längeren Besuch der Kriegsschule in Anklam[S. 40] machte er dort sein Offiziers-Examen und ging dann wieder nach Rostock, um seine militärische Laufbahn weiter zu verfolgen.
Hier lernte er den schon damals berühmten Afrikareisenden Pogge kennen, welcher einen entscheidenden Einfluß auf ihn auszuüben bestimmt war. Es war bereits die Absicht des Knaben gewesen, sich den Naturwissenschaften zu widmen, ein Wunsch, der ihm nicht erfüllt werden konnte. Im Verkehr mit Pogge lebte die alte Neigung wieder auf und gewann bald eine so feste Gestalt, daß der Entschluß in ihm reifte, sich Pogge bei der ersten Gelegenheit zu einer größeren Reise anzuschließen. Diese Gelegenheit bot sich im Jahr 1879.
Die Afrikanische Gesellschaft in Berlin erteilte Pogge den Auftrag, abermals nach dem von ihm früher schon besuchten Lundareiche in Westafrika zu gehen und dort eine Station zu gründen. Wißmann wandte sich auf Anraten Pogges an den Vorsitzenden der Deutschen Afrika-Gesellschaft Dr. Nachtigall und wurde zu seiner größten Freude als Geograph angenommen. Die Militärbehörde erteilte ihm Urlaub, den er zunächst zu einer längeren wissenschaftlichen Vorbereitung an der Seemannsschule zu Rostock benutzte.
Dann verließ er mit Pogge am 19. November 1880 den Hafen von Hamburg, um sich nach Westafrika zu begeben. Der entscheidende Schritt zu Wißmanns Ruhm war hiermit gethan; denn aus der Ursprünglich geplanten Expedition nach dem Lunda-Reiche wurde jene erste von Wißmann allein ausgeführte Durchquerung Afrikas, die erste Durchquerung seitens eines Deutschen, die erste Durchquerung von West nach Ost überhaupt.
Mitte November 1882 erreichte Wißmann bei Sadani die Küste und war dort — eine eigentümliche Fügung! — der Gast Bana Heris, desjenigen Mannes, den er später als den Hauptfeind der Deutschen in Ostafrika zu bekämpfen haben sollte. — Im April 1883 traf Wißmann wieder in Berlin ein, sein Ruf als Afrikaforscher war voll und ganz begründet. Unter den schwierigsten Verhältnissen mit einer kaum nennenswerten Geldsumme (30000 Mark) war die Durchquerung des schwarzen Erdteils auf einem bisher nie betretenen Wege durch gänzlich unbekannte Gebiete hindurch ohne jede Feindseligkeit mit Eingeborenen vollendet, der Wissenschaft ein ungeheurer[S. 41] Dienst geleistet worden. Der Name Wißmanns war in aller Munde.
Durch diesen außerordentlichen Erfolg war der König der Belgier auf den kühnen Forscher aufmerksam geworden und machte ihm sogleich nach seiner Ankunft das Anerbieten, in seinem Privatdienst das Congobecken zu durchforschen. Schon am 16. November 1883, also nach kaum halbjährigem Aufenthalt in der Heimat, schiffte sich Wißmann wiederum nach Afrika ein in Begleitung des sächsischen Stabsarztes Dr. Wolf und der preußischen Offiziere Hans und Franz Müller und v. François.
Die praktischen Ergebnisse dieser zweiten Expedition waren die Festlegung des Stromlaufes des Kassai, die Entdeckung seines Nebenflusses Sankurru, welcher bisher als selbständiger Nebenstrom des Congo aufgefaßt wurde, endlich der Mündung des Kassai in den Congo an einer Stelle, wo der Kassai bisher als Kwa-Fluß galt. Am 9. Juli 1885 erreichte Wißmann die Station an der Mündung des Kassai in den Congo. Er erblickte hier zum erstenmale die Flagge des Congostaates, welcher während der Dauer seiner Reise entstanden war.
Eine in der letzten Zeit aufgetretene Verschlimmerung seiner asthmatischen Beschwerden machte nach dieser erfolgreichen Reise einen Aufenthalt in Madeira notwendig, aber nach kaum 2 Monaten brach der unermüdliche Forscher abermals im Auftrag des Königs der Belgier nach Afrika auf. Er sollte im Dienste des Congostaates im Baluba-Lande eine Stütze schaffen zu den weiteren Unternehmungen im Süden des Congostaates und dann von dort aus nach Südosten und Nordosten eventuell bis zu den östlichen Grenzen den eingeborenen Stämmen ihr neues politisches Verhältnis bekannt machen. Er sollte ferner dem Gang der Sklavenjagden und des Sklavenhandels nachforschen und ihm nach Möglichkeit entgegenarbeiten.
Die eigentliche Aufgabe, welche Wißmann im ersten Teil seiner Instruktion gestellt war, konnte auf dieser Reise nicht zur Ausführung kommen; und zwar waren es gerade die Sklavenjagden der Araber und das weite Vordringen derselben bis in den Congostaat hinein, welche die Lösung dieser Aufgabe verhinderten. An der Stelle früher blühender Landschaften[S. 42] fand er vollkommene Wüsten. Ganze Völkerstämme zeigten sich vernichtet; die Stimmung der Araber war dem neuentstandenen Congostaat durchaus feindlich, ja, kurz zuvor war eine der Stationen des Staates (Stanley-Falls-Station) durch die Araber erstürmt und vernichtet worden.
Wißmann selbst geriet in Nyangwe, der westlichsten Araberstadt in so große Gefahr, daß an ein Weiterdringen im Congostaat selbst gar nicht gedacht werden konnte, und nur der Ausweg nach Osten übrig blieb. So wurde aus der geplanten Expedition die zweite Durchquerung des schwarzen Kontinents und zwar auf dem Wasserwege des Tanganjika, von dort zum Nyassa, Schire, Zambesi und Kwakwa nach Quilimane. Von hohem Interesse ist das Urteil, welches Wißmann bei dieser Durchquerung über das Arabertum fällt, — von besonderem Interesse, weil er berufen sein sollte, schon bald darauf gegen die Araberwirtschaft anzukämpfen. »Die Schuld des Urhebertums dieser Greuel,« sagt Wißmann in seiner »Zweiten Durchquerung[1]«, »trifft ohne jede Frage den Araber, denn nur durch seine Initiative war es möglich, immer weiter vorzudringen, immer weiter zu unterjochen, zu entvölkern, und daher muß, wenn man an Abhilfe denkt, wenn man den armen, wehrlosen Eingeborenen nachhaltig schützen will, das Arabertum in diesen Ländern ausgerottet werden mit Stumpf und Stiel, bevor es eine Macht erreicht, der wir Europäer des feindlichen Klimas und der Entfernung wegen nicht mehr gewachsen sind, wie dies im Süden der Fall war. Es war hohe Zeit, daß bald nach den bösen Tagen, über die ich hier berichte, schärfer vorgegangen wurde gegen die afrikanische Pest, und mir speziell gewährte es eine hohe Genugthuung, daß ich berufen war, beim Niederschlagen des Aufstandes der Araber in Ostafrika an der Küste, von der aus die Hauptanregung zu den beschriebenen Greueln ausgeht, den empfindlichsten Schlag zu führen.
Wenn auch die Flotten Englands und Deutschlands den Export der meist aus diesen Gegenden des zentralen Afrikas verschleppten Sklaven verringern, so schneidet doch erst die[S. 43] Besetzung der Küstenplätze und der großen Handelsstraßen dem Sklavenhandel und damit der Sklavenjagd die Zukunft ab. Jetzt, wo ich dies niederschreibe, ist vieles schon geschehen, jedoch noch sind die Operationsbasen der Sklavenhändler im Innern Tabora, Udjidji und Nyangwe Absatzgebiete für Sklaven. Noch lebt Tibbu-Tip, wüten Muini Muharra und andre Sklavenjäger Verderben bringend gegen die ihnen wehrlos gegenüberstehenden, nur mit Speer und Bogen bewaffneten Eingeborenen. Noch ist viel zu thun übrig zum Schutze der Freiheit und des Lebens von Millionen harmloser Kreaturen; noch ist es möglich, daß vom Sudan der Araber südlich vom Äquator verstärkt wird. Aber Deutschland ist doch schon gerüstet zu weiterem Schutz, schon bereit, einer von Norden drohenden Vermehrung der Gefahr Halt zu gebieten, und ich hoffe, daß, ehe noch dieser Ausdruck meiner tiefsten Empörung dem Leser vorliegt, ich schon wieder die Arbeit aufgenommen habe, deren Endzweck, die Befreiung des äquatorialen Afrikas von der Pest des Arabertums, mein Lebensziel geworden ist.« Freilich muß zu diesem Urteil bemerkt werden, daß die wirksamste Bekämpfung der arabischen Unthaten nur allmählich vor sich geht, daß man in vieler Beziehung bei der Kolonisierung Afrikas mit den Arabern im guten auszukommen suchen muß, wie dies gerade Wißmann gezeigt hat.
Die wissenschaftlichen Vorarbeiten und Erfolge Wißmanns, seine genaue Kenntniß der Araber, jener Gegner aller europäischen Kultur, seine in drei außerordentlich großartigen Expeditionen bewiesene Fähigkeit, die Eingeborenen richtig zu behandeln und doch seinem Willen dienstbar zu machen — das waren die Momente, welche Hermann Wißmann vor allen anderen zur Stellung des Reichskommissars befähigten. Ganz besonders aber müssen hier noch die Eigenschaften seines Charakters hinzugerechnet werden. Beispiellose Energie, persönliche Nichtachtung jeder Gefahr, wo es gilt, ein ideales Ziel zu erreichen; die seltene Fähigkeit, in jedem seiner Untergebenen die Individualität zu erkennen und völlig frei schalten zu lassen; rücksichtslose Strenge im Dienst; geistvolle Anregung im zwanglosen, außerdienstlichen Verkehr — alles das sind Eigenschaften, welche jeder Wißmannsche Offizier und jeder[S. 44] Beamte des Kommissariats dem allseitig verehrten Kommandanten immer nachrühmen wird, und welche ihm ein bleibendes Denkmal in aller Herzen sichern.
Im Sommer des Jahres 1888 nach Deutschland zurückgekehrt, wurde Wißmann von dem deutschen Emin Pascha-Entsatz-Komitee mit Dr. Peters zur Führung der Emin Pascha-Expedition ausersehen. Alle Vorbereitungen für die Expedition waren getroffen, das gesamte tote Material angeschafft — da erhielt Wißmann die Berufung zum Reichskommissar und vertrat bereits in den Verhandlungen des Reichstages über den Antisklaverei-Antrag als Bundeskommissar die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen. Die größte Eile war geboten; denn die Nachrichten aus Ostafrika lauteten von Tag zu Tag ungünstiger. Nach dem von der Regierung gebilligten Plane Wißmanns sollte die Niederwerfung des Aufstandes durch eine aus Negern bestehende Schutztruppe unter Führung deutscher Offiziere und Unteroffiziere geschehen. Als brauchbarstes Material brachte Wißmann die Sudanesen in Vorschlag, welche er bereits früher, besonders aber im letzten Winter, als er sich abermals im Auftrag des Königs der Belgier in Egypten aufhielt, kennen und schätzen gelernt hatte. Der vorläufige Stamm an Europäern bestand aus 21 deutschen Offizieren, Ärzten und Beamten und 40 Unteroffizieren. Der Lage der Sache nach mußte das gesamte deutsche Personal, so weit es der Armee angehörte, aus derselben ausscheiden und trat in den persönlichen Dienst des Reichskommissars. In rastloser Thätigkeit wurden im Zeitraum von etwa vier Wochen alle Vorbereitungen in Deutschland selbst getroffen, die Anschaffung von Kriegsmaterial und Ausrüstungsgegenständen beendet; und bereits im Februar reiste der Reichskommissar, begleitet von Lieutenant Theremin, von Berlin ab, während hier sein Stellvertreter, Frhr. v. Gravenreuth, die noch weiter zu erledigenden Geschäfte in die Hand nahm.
Für den notwendigen Verbindungsdienst zwischen der Küste und Sansibar selbst und für die voraussichtlich häufigen Truppentransporte zwischen den einzelnen Küstenplätzen wünschte der Reichskommissar einen Dampferdienst einzurichten. Da derselbe naturgemäß von der Marine bei ihrer ohnehin großen[S. 45] Aufgabe nicht geleistet werden konnte, sollten in Deutschland vier kleine Dampfer zu diesem Zweck angeschafft werden. Gleichzeitig sollten dieselben dazu dienen, die Flüsse, wenigstens den Kingani und Pangani, im Notfall aufwärts zu gehen und mit Revolvergeschützen die Ufer zu säubern, eventl. auch bei der Landung an der Flachküste von Bagamoyo durch ihre Armierung Dienste thun.
Das Reichskommissariat, welches ja mit der Marine in keiner direkten Verbindung stand, sollte auch nach dieser Richtung hin unabhängig gestaltet werden. Es wurden zu diesem Zweck 4 Dampfer in Deutschland angekauft, nämlich die Harmonie, etwa 200 Tonnen groß; München ca. 80 Tonnen; Vesuv 60; Max 50. Die drei letztgenannten Dampfer hatten in Deutschland als Schleppdampfer gedient; die Harmonie war in der Fahrt zwischen Köln und London beschäftigt gewesen. Leider stellte sich das gesamte Material als, gelinde ausgedrückt, wenig brauchbar heraus. Die Harmonie war der einzige Dampfer, welcher eine größere Anzahl von Menschen aufzunehmen vermochte; sie hatte aber nur einen Tiefgang von 5 Fuß und erwies sich gleich von vornherein als seeuntüchtig, Vesuv und Max konnten jeder im allerhöchsten Falle etwa 60 Menschen aufnehmen, welche dann aber dicht gedrängt an einander stehen mußten. Die München, zweifellos das seetüchtigste Fahrzeug, nahm im äußersten Fall etwa 80 bis 100 Mann auf, hatte aber einen zu großen Tiefgang (7 Fuß), um nahe an die Küste heran oder weit in den Flüssen aufwärts kommen zu können. Außerdem hatte sie nur 7 Zoll Bord und eine Verschanzung von 2 Fuß Höhe, so daß beim geringsten Seegang das Deck fortwährend überspült wurde.
Es darf als eine ganz außerordentliche Leistung deutscher seemännischer Tüchtigkeit betrachtet werden, daß diese 4 Dampfer den ungemein schwierigen Weg von Hamburg bis Sansibar selbständig und ohne alle fremde Hilfe zurücklegten. Ohne hier auf Einzelheiten eingehen zu wollen, muß doch gesagt werden, daß die ganze Reise nach Ostafrika eine fortdauernde Lebensgefahr der gesamten Bemannung bildete. — Später hat die Harmonie ihrer Untüchtigkeit wegen häufig müßig auf der Rhede von Sansibar gelegen; die drei kleineren Dampfer, mit[S. 46] Revolverkanonen ausgerüstet, haben ausreichende Dienste geleistet.
Um die Wege für die Anwerbung der Sudanesen zu ebnen und besonders etwa entgegenstehende religiöse Bedenken aus dem Wege zu räumen, waren vom Auswärtigen Amt zu Berlin vorher Verhandlungen mit der egyptischen Regierung gepflogen und deren Genehmigung erwirkt worden. Bei dem anzuwerbenden Material wurde in erster Linie auf die alten Soldaten aus den sudanesischen Regimentern, die den Feldzug gegen den Mahdi mitgemacht hatten, zurückgegriffen. Es waren dies Leute, denen durch die unglücklichen Kämpfe gegen den Mahdi die Rückkehr in ihre Heimat abgeschnitten war und welche nach Auflösung ihrer Regimenter eine Verwendung im egyptischen Kriegsdienst nicht mehr gefunden hatten.
Diese Leute, deren Soldforderungen zum Teil von der ägyptischen Regierung nicht befriedigt wurden, die außerdem arbeits- und erwerbslos in Egypten herumlungerten, strömten voller Freuden nach Kairo herbei, als von Wißmann die Werbetrommel gerührt wurde. Außerordentlich kam hierbei die Unterstützung des englischen, in egyptischem Dienst stehenden Obersten Scheffer zu statten, dessen Kenntnis der Sudanesen das Engagement ungemein erleichterte und beschleunigte. Daß neben vielen durchaus kriegsbrauchbaren und gut disziplinierten Soldaten auch einige verworfene Subjekte, welche wegen Aufsessigkeit und allerlei Uebelthaten aus der egyptischen Armee entlassen worden waren, mit unterliefen, ist bei der beim Engagement notwendig gewesenen Eile begreiflich. Dennoch war die Zahl der schlechten Leute nicht so bedeutend, daß die Qualität der Truppe im ganzen dadurch beeinträchtigt wurde.
Die Heimat der Sudanesen ist Nubien, Sennar, Kordofan, das Land der Schillucks und der Dinka-Stämme, zum Teil sogar sind es die Äquatorial-Provinzen, alles Länder, deren Söhne ihrem Beruf nach von Jugend auf Soldaten sind. Eine beim Engagement sowohl von Egypten wie von den Leuten selbst gestellte Bedingung war, daß die zu den einzelnen Truppenverbänden gehörigen Chargen des Offiziers- und des Unteroffizierstandes mit übernommen würden, und daß ebenso den Leuten Gelegenheit geboten würde, ihre Frauen und[S. 47] Familien mitzunehmen. Die meisten Leute weigerten sich entschieden, ohne ihre Familie die Reise anzutreten. Der Sold, welcher ausbedungen und bewilligt wurde, war höher, als er in der egyptischen Armee üblich war, und selbst für unsere Begriffe ziemlich bedeutend. Er betrug für den gemeinen Soldaten monatlich 45 Mark, außerdem freie Verpflegung (Naturalien oder 25 Pf. täglich); die farbigen Unteroffiziere erhielten 8-20 Mark mehr im Monat und von den farbigen Offizieren die Lieutenants circa 160 Mark, Hauptleute bis über 300 Mark. Ein Feilschen um die Höhe des Soldes erschien gerade bei den Chargen unmöglich, denn Offiziere und Unterchargen waren, soweit sie sich überhaupt als brauchbar erwiesen und nicht, wie es bei manchen der Fall war, wegen Unzuverlässigkeit, Faulheit oder gar Aufsessigkeit in der allerersten Zeit schon aus der Truppe entfernt werden mußten, uns durchaus unentbehrlich als Bindeglied zwischen der farbigen Truppe und den deutschen im Anfang den Soldaten noch recht fremd gegenüberstehenden Offizieren.
Man möge sich vergegenwärtigen, daß die von Wißmann aus Deutschland mitgenommenen Offiziere und Unteroffiziere in den meisten Fällen direkt aus dem Garnisondienst heraus kamen und kaum je vom Ausland etwas gesehen hatten, geschweige denn befähigt waren, ohne weiteres den Eigentümlichkeiten ihrer neuen Truppe entsprechend dieselbe zu verwerten. Bei der ungemeinen Eile, mit welcher die erste Ausbildung der Truppe ausgeführt werden mußte, konnte gar nicht anders verfahren werden, als daß man die wesentlichsten Teile des deutschen Exerzier-Reglements (für den Gefechtsdienst besonders) den schwarzen Truppen ohne weiteres eintrichterte. Wenn dabei ihr früherer egyptischer Militärdienst sich auch einigermaßen verwerten ließ und den Truppen wenigstens allgemeine Begriffe von Disziplin innewohnten, so war doch die Vermittlung der schwarzen Offiziere und Unteroffiziere bei diesem Eindrillen gar nicht zu entbehren und für das schnellere Verständnis der Soldaten ungleich wichtiger als das bloße Kommando. Es mußten im Anfang von den farbigen Offizieren die betreffenden ägyptischen Kommandos abgegeben werden, während später durchgehends das deutsche Kommando eingeführt wurde.
[S. 48]
Die Zahl der angeworbenen Sudanesen betrug 600 Mann. Es erschien geboten, die Leute nach der Anwerbung gar nicht erst zur Besinnung kommen zu lassen, damit nicht weitläufige Erwägungen Platz greifen konnten, sondern sie möglichst schnell ihrem Bestimmungsort zuzuführen. Sobald je 100 Mann angeworben waren, wurden dieselben mit Familie und Gepäck nach Suez verladen, dort an Bord eines Dampfers gebracht und nach Aden befördert, wo sie unter dem Kommando des Chefs Theremin vereinigt wurden. Als Offiziere waren für diesen Transport unter dem Kommando Theremins die Herren Premier-Lieutenant Böhlau, Lieutenant Sulzer und von Behr nach Egypten von Berlin telegraphisch berufen worden. Von Aden wurden die angeworbenen Soldaten durch 2 Dampfer nach Bagamoyo übergeführt, auch ca. 50 Somalis, welche als Boots- und Schiffsmannschaften in Ostafrika Verwendung fanden.
Ein zweiter farbiger Volksstamm, auf welchen bei unserer Anwerbung zurückgegriffen wurde, waren die Zulus. Nach Verhandlungen mit der portugiesischen Regierung wurde Lieutenant Ramsay nach Mozambique geschickt. Nachdem er sich mit dem dortigen Gouverneur ins Einvernehmen gesetzt hatte, reiste er nach Inhambane und warb dort zunächst 100 Mann aus den in Ostafrika als besonders kriegerisch bekannten Wangoni-Stämmen an. Waren auch die Zulus keine Berufssoldaten, so bildeten sie doch ein gutes Soldatenmaterial, das beste jedenfalls, was im östlichen Afrika zu haben war; — haben sie doch im Kriege gegen die Engländer ihre militärischen Eigenschaften vollauf bewiesen. —
Man beschränkte sich zunächst auf diese 100 Mann, weil die Anwerbungen sonst zu lange Zeit in Anspruch genommen hätten und die Zulus schon bei der ersten Aktion des Reichskommissars an Ort und Stelle sein sollten; später ist die Zahl derselben durch weitere Anwerbung auf 350 ergänzt worden.
In der Zahl der farbigen Kämpfer, die bei den ersten Aktionen zur Verfügung standen, sind die Askaris nicht zu vergessen, welche meist aus den Stämmen des innern Ostafrikas (besonders den Waniamuesi und Manjema) und nur zum sehr geringen Teil aus der Küstenbevölkerung hervorgingen.[S. 49] Einige von ihnen hatten schon in Bagamoyo und Daressalam unter den Beamten der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft gegen die Rebellenscharen an der Küste gekämpft und hatten dadurch, daß sie in jener schlechten Zeit bei der Gesellschaft ausharrten — die meisten hatten es freilich, als die Sache für uns Deutsche kritisch wurde, vorgezogen, ihren Dienst zu verlassen — militärische Eigenschaften und vor allem Treue bewiesen. In der Heranbildung jener Leute finden wir übrigens den einzigen Versuch, den die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft in den letzten Monaten gemacht hatte, sich eine kleine Macht zu schaffen. Es sind diese Leute immer schlechthin unter dem Namen Askaris (eigentlich = Soldaten) zusammengefaßt worden; im Folgenden sind daher unter Askaris auch immer nur die aus unsern Küsten- und Hinterlandsstämmen hervorgegangenen Söldner zu verstehen.
Die ersten Vorarbeiten in Ostafrika wurden durch die vom Reichskommissar vorausgesandten Beamten getroffen, und zwar in Sansibar durch Herrn Eugen Wolf, der früher in Westafrika thätig gewesen, und auf dem Festlande vom Verfasser. Von ihnen hatte der erstere die kaufmännischen und der letztere, dem Lieutenant Blümcke beigegeben war, die notwendigsten militärischen Vorbereitungsmaßregeln zu treffen zur Unterbringung der Truppen am Festland.
Wißmann selbst kam am 31. März, begleitet von seinem Adjutanten Dr. Bumiller in Sansibar an. Nachdem er dort in feierlicher Audienz vom Sultan empfangen worden war, fuhr er an Bord des Flaggschiffes des deutschen Geschwaders nach dem Festland, um gemeinsam mit dem Geschwaderchef, Herrn Admiral Deinhard, die Küstenplätze Daressalam, Bagamoyo, Pangani und Tanga zu besuchen, den Befehl an der Küste zu übernehmen und mit der Marine und der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft alle nötigen Maßregeln zu vereinbaren.
Die Stationen Bagamoyo und Daressalam wurden von Seiten des Vertreters der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, des Herrn v. Saint-Paul-Illaire dem Reichskommissar unter dem 28. April 1889 übergeben und an diesem Tage folgendes Abkommen zwischen dem Kommissar und der Gesellschaftsvertretung getroffen:
[S. 50]
»Vom heutigen Tage geht auf den Reichskommissar über:
1. das Oberkommando über die militärischen Machtmittel der Station sowie auch alle militärischen Maßnahmen und Operationen;
2. die Leitung und Anordnung der zur Verteidigung der Stationsgebäude erforderlichen Bauten und sonstigen Einrichtungen;
3. die Oberleitung der Civilverwaltung, abgesehen von der Zollverwaltung.«
Außerdem wurden Abmachungen wegen Übernahme einzelner Beamten aus dem Dienst der Gesellschaft in den Wißmannschen Dienst, ebenso über Abgabe von Waffen und Inventar getroffen.
Bei der Inspizierungs- und Rekognoszierungstour fand der Reichskommissar die Befestigungsarbeiten in Bagamoyo Dank der bereits früher erwähnten, eifrigen Thätigkeit der Herren v. Zelewski und v. Eberstein weit vorgeschritten. In Daressalam indes, wo der Bezirkschef der Gesellschaft, v. Bülow gemeinsam mit dem Verfasser nach dessen Ankunft diese Arbeiten erst in letzter Zeit begonnen hatte, waren dieselben noch weit zurück. Wißmann ordnete nun die Art der Weiterführung der Befestigungs- und Bauarbeiten persönlich an, und nach seiner Anweisung wurden die beiden Stationen in den nächsten Monaten vollkommen ausgebaut, befestigt und durch Umwallungen mit Schützenauftritt und Bastionen zur Infanterie- und Artillerieverteidigung eingerichtet.
In Daressalam war Anfang März bereits der erste Waffen- und Munitionstransport vom Bord des Norddeutschen Lloyddampfers »Schwan«, der für denselben gechartert war, gelöscht und in den Magazinen der Deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft untergebracht worden. Der Transport bestand aus 12 leichten Feldgeschützen C/73, sechs Revolverkanonen, 900 Mausergewehren (Jägerbüchsen und Karabinern), Infanterie-Seitengewehren, großem und kleinem Schanzzeug, der entsprechenden Artillerie- und Infanteriemunition, Schießwollpatronen und Proviant, der noch durch Einkäufe in Sansibar vervollständigt wurde. Die Vorräte an Waffen, Munition und Proviant wurden in einer der späteren Dislokation der Truppen entsprechenden[S. 51] Weise auf Bagamoyo und Daressalam verteilt in der Art, daß das Hauptdepot in Daressalam verblieb.
Da bei der Ankunft des Reichskommissars die Truppen noch nicht zur Stelle waren, benutzte er die ihm zur Verfügung stehende Zeit, die mit der Ankunft der Soldaten eintretende Organisation vorzubereiten und, wie erwähnt, eine Rekognoszierungstour vorzunehmen.
Als auf dieser die »Leipzig« vor dem Panganifluß lag und eine Dampfpinasse ausgesetzt wurde, um die Befestigungen der Rebellen in größerer Nähe betrachten zu können, wurden von den an der Einfahrt in den Fluß versammelten Rebellenscharen Schüsse auf die Pinasse abgegeben; man fand die Gegner, welche starke Befestigungen vor der Stadt und am Flusse angelegt hatten, vollkommen gefechtsbereit. Ebenso wurden im Hafen von Tanga Bewaffnete gesehen, desgleichen in dem mit einer Pallisadierung befestigten Sadani.
Der Admiral hatte nach dem letzten Angriff Buschiris auf Bagamoyo mit dem Rebellenführer einen Waffenstillstand geschlossen, um mit dem Reichskommissar diesen Waffenstillstand in einen definitiven Frieden umzuwandeln. Wenigstens sei dies, so äußerte sich Deinhard, wenn ihm das weitere Kommando an Land belassen worden wäre, seine Absicht gewesen. Die von Buschiri gestellten Bedingungen waren jedoch derart, daß ein Eingehen auf dieselben nach den vielen während des Aufstandes erlittenen Demütigungen und dem vielfach nicht nur nach europäischen, sondern grade nach orientalischen Begriffen recht wenig imponierenden Auftreten unsrer maßgebenden ostafrikanischen Organe, wie Wißmann sich im Bericht an den Reichskanzler ausdrückte, einfach »lächerlich« gewesen wäre.
In der That ist es unbegreiflich, wie man überhaupt ernstlich an eine Umwandlung jenes abgeschlossenen Waffenstillstandes in einen definitiven Frieden hatte denken können; die Folge wäre lediglich gewesen, daß man nach kürzester Frist sich auf dem alten Fleck befunden hätte.
Allerdings hatte sich Wißmann veranlaßt gesehen, den Waffenstillstand vorläufig auch seinerseits anzuerkennen, da er wegen der noch nicht erfolgten Ankunft der neuangeworbenen Truppen hierzu genötigt war. Außerdem wurde ein sofortiges[S. 52] Einschreiten gegen die Aufständischen noch durch den Umstand verhindert, daß zwei englische Missionare aus Mamboia, welche aus dem Innern nach der Küste zurückkehrten, in der Nähe derselben in die Gewalt Buschiris geraten waren und von ihm gefangen gehalten wurden. Allerdings wurden sie anständig behandelt, sollten aber nur gegen ein hohes Lösegeld herausgegeben werden. Die wegen des Lösegeldes und der Auslieferung der Missionare gepflogenen Verhandlungen führten zu einem befriedigenden Resultat, so daß die Missionare nach mehrtägiger Gefangenschaft in Freiheit gesetzt wurden. Einsicht in die Befestigungen und die wirkliche Lage des Buschirischen Lagers brachten sie allerdings nicht mit, da sie durch strengste Ueberwachung an genauerer Umschau verhindert waren.
Als nun Buschiri nach Auslieferung der Missionare das 3/4 Stunden südlich von Bagamoyo gelegene Dorf Kaule überfiel, ausplünderte und völlig zerstörte, — und als er sogar gegen einen im deutschen Dienst befindlichen schwarzen Handwerker, der in seine Gewalt gefallen war, einen Akt der empörendsten Brutalität verübte, da konnte Wißmann den Waffenstillstand als von Buschiri gebrochen ansehen.
Der Maurer Dunia nämlich hatte eines Tages nach empfangenem Lohn in der Absicht, sich seinem Arbeitsdienst zu entziehen, die Station Bagamoyo verlassen und sich zu Buschiris Leuten begeben, von welchen er zu dem Rebellenführer gebracht wurde, mit der Anschuldigung, daß er als Maurer für die Deutschen gearbeitet und so zur Befestigung ihrer Station beigetragen habe. Buschiri ließ ihm seine beiden Hände abhacken und schickte ihn nach der Station zurück mit dem Bedeuten, er solle nun weiter für die Deutschen arbeiten, Wißmann Grüße ausrichten und ihm bestellen, daß nächstens mit allen Deutschen ebenso verfahren würde. Der Mann kam thatsächlich lebend in Bagamoyo an. Er hatte sofort nach der Verstümmelung die beiden Armstümpfe fest in die Hüften gestemmt und war über Stock und Stein nach der Station gerannt. Hier wurde ihm sofort ein Notverband angelegt, dann kam er in die Behandlung eines Marinearztes, und dessen Pflege, sowie die unglaubliche, allen Negern eigene Zähigkeit und gute Heilnatur ließen ihn genesen.
[S. 53]
Es ist von Seiten des Reichskommissariats dann in der ausgiebigsten Weise für jenes arme Opfer der Wut Buschiris gesorgt worden; allerdings ohne Erfolg, denn Dunia ist im Gegenteil einer der größten Halunken geworden.
Am 29. April traf der Dampfer »Somali« mit dem größten Teil der angeworbenen Sudanesen in Bagamoyo ein, und nun ging es nach dem Ausschiffen dieser Leute an die Bewaffnung und Unterbringung der Soldaten. Das letztere war in Bagamoyo nicht schwierig, denn dort befanden sich eine Anzahl gut erhaltener oder leicht zu reparierender Steinhäuser. 60 von den angekommenen Soldaten wurden nach Daressalam gesandt. Mit der Ankunft dieser Truppen wurde das den beiden Stationen bis in die letzte Zeit noch verbliebene Marine-Detachement zurückgezogen.
Die in Daressalam stationierte Kreuzerkorvette Carola verließ aus Gesundheitsrücksichten den dortigen Hafen, um an der äußeren Rhede vor Anker zu gehen.
Am 4. Mai kamen mit der »Martha« die übrigen angeworbenen Sudanesen und das europäische Offizier- und Unteroffizier-Personal in Bagamoyo an. Am 6. Mai trafen auch die Zulus unter Lieutenant Ramsay vom Süden ein. Es stand nun dem Reichskommissar, welcher seiner Schutztruppe gegenüber den Titel Kommandant führte, nach Eintreffen des gesamten Personals und nach Übernahme einzelner Herren von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft folgendes Europäer-Personal zur Verfügung:
Chefs der Schutztruppe: Frhr. v. Gravenreuth, Dr. Schmidt (Schmidt I), v. Zelewski, Krenzler, Frhr. v. Eberstein, Rochus Schmidt (Schmidt II), Richelmann, Theremin, (Leue trat später hinzu).
Lieutenants der Schutztruppe: v. Bülow (später hinzugetreten nach erfolgter Rückkehr aus Europa), Ramsay, Böhlau, End, Sulzer, Johannes, Merker, v. Behr, Dr. Bumiller, v. Perbandt, v. Medem, Radatz.
Ärzte der Schutztruppe: Stabsarzt Dr. Schmelzkopf als Chefarzt und Assistents-Arzt erster Klasse Dr. Kohlstock.
[S. 54]
Beamte: a) im Chefrang: Eugen Wolf (als kaufmännischer Beirat); b) im Lieut.-Rang: Lieut. a. D. Blümcke und Zahlmeister Merkel.
Deckoffiziere: Bohndorf, Rabe, Illich, Tschepe, Grothe, Jancke, de la Frémoire.
Kapitäne der Flottille: Holz (bis August 1889), Hansen (vom August 1889 ab), Graf Pfeil, Tomaschewski, Prager, Römer.
Außerdem stand für seemännische Zwecke der Lieut. zur See der Reserve v. Sivers zur Verfügung. Von den genannten Personen hatten folgende bereits afrikanische Erfahrungen gesammelt: v. Gravenreuth, v. Zelewski, Krenzler, v. Eberstein, die beiden Schmidts, Leue, v. Bülow, Ramsay, Illich, ferner, wenn auch nur kurze Zeit: Merker, v. Medem, Tschepe, Rabe, (ebenso Wolf im Dienst des Kongostaates in Westafrika und Bohndorf als Reisebegleiter Junkers).
Unteroffiziere der Schutztruppe: Becker, Bilke, Bluhm, Brose, Budau, Burwitz, Busch, Eben, Firnstein, Fricke, Gaffri, Gaßmann, Germer, Greff, Grucza, Gurkasch, Hartmann, Hoffmann I, Hoffmann II, Kaiser, Kay, Kopp, Kühne, Leder, Ludwig, Martini, Mutter, Naeter, Peter, Piehl, Reich, Rohr, Rymarzig, Schaumbacher, Schulte, Schwarz, Snakker, Semmling, Steinbach, Tanner, Thielke, Velten, Weiß, Wille, Wonneberger, Först, Schafflick, Freitag, Mittelstädt, Bauer, Drescher, Fritz, Fülleborn, Hocke, Hoffmann III, Jacobs, Kröhnke, Markgraf, Marquard, Neumann, Nowack, Roberth, Schmid, Schultz, Steinkopf, Stolle.
Die Verteilung der Offiziere und Truppen auf die Stationen Bagamoyo und Daressalam geschah in folgender Weise:
Bagamoyo: Stationschef: Chef Dr. Schmidt. Stationsoffizier Premierlieutenant End. Truppen: 545 Sudanesen in 5 Kompagnien, 100 Zulus und 60 Suaheli-Askari, je eine Kompagnie; 40 Somali und 60 Europäer (Offiziere und Unteroffiziere). Abgesehen von der eigentlichen Stationsbesatzung waren die Truppen anfangs in 2 Bataillone eingeteilt[S. 55] unter den Chefs Freiherr von Gravenreuth und von Zelewski. Die Kompagnieführer waren die Herren Ramsay, Johannes, v. Medem, v. Perbandt, Sulzer und Radatz. Für die Artillerie waren bestimmt die Herren Chef Krenzler und Premierlieutenant Böhlau.
Daressalam: Stationschef: Chef Rochus Schmidt. Stationsoffizier: Lieutenant Merker. Truppen: 55 Sudanesen, 10 Somali, 20 Suaheli-Askari. Dazu Lieutenant v. Behr und später nach beendetem Angriff auf Buschiris Lager 8 Unteroffiziere. Auch wurde bald die Zahl der Besatzungstruppen auf 100 vermehrt.
[S. 56]
[1] Verlag von Trowitzsch u. Sohn, Frankfurt a. O. 1891.
Einrichtung des Spionendienstes. — Angriff und Einnahme von Buschiris Lager bei Bagamoyo und Operationen daselbst. — Streifzüge des Verfassers um Daressalam. — Beerdigung der ermordeten Missionare in Pugu. — Verhältnisse in Sadani. — Bombardement von Sadani. — Einnahme durch die Schutztruppe. — Einnahme von Pangani und Stationsgründung daselbst. — Einnahme von Tanga. — Errichtung eines Forts in Tanga. — Streifzug Gravenreuths gegen die Jumbes in der Umgegend von Bagamoyo. — Verhältnisse auf den neu gegründeten Stationen.
Unmittelbar nach der Ankunft der Truppen ließ Wißmann dem Führer der Rebellen den Waffenstillstand, der ja von ihm in frevelhafter Weise gebrochen war, aufkündigen und ihm sagen, daß er ihn in den nächsten Tagen angreifen würde. Die Antwort Buschiris lautete, er würde die Deutschen bestens empfangen.
Die Bestrafung zweier Leute, welche der Spionage gegen uns für die Interessen Buschiris überführt worden waren, mit dem Tode durch den Strang hatte Wißmann natürlich bis zur Auslieferung der Missionare aufgeschoben.
Bis zur Ankunft Wißmanns hatten nur die Rebellen ihre Spione, welche sie so geschickt ausgewählt und organisiert hatten, daß sie stets mit den genauesten Nachrichten über unsere Mittel und Absichten versehen waren, während die Beamten der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft im großen und ganzen auffällig spärlich mit Nachrichten versehen waren. Wißmann erkannte gleich am ersten Tage seiner Ankunft auf dem Festland, daß auf unserer Seite viel zu wenig auf den Spionendienst[S. 57] gehalten war und gab daher zur Einführung einer ordentlichen Spionage die betreffenden Anweisungen, indem er zugleich Gelder zur Verfügung stellte.
Die Spionage ist etwas in Afrika durchaus Notwendiges und Selbstverständliches. Der Europäer muß Gewicht darauf legen, unter den Eingeborenen zuverlässige Personen zu finden, die er zur Einziehung von Nachrichten benutzen kann, indem er nötigenfalls auch die einzelnen Leute gegenseitig ausspielt und so kontrolliert.
Die durch Wißmann eingeführte bessere Ausbildung des Spionendienstes hat sehr viel zu unseren Erfolgen beigetragen. Bedauerlicher Weise wurden, wie ich vorweg bemerken muß, im letzten Jahre vom Gouverneur von Soden unter vollkommener Verkennung der afrikanischen Verhältnisse aus Sparsamkeitsrücksichten selbst nach der Zelewskischen Katastrophe nicht die nötigen Mittel hierfür zur Verfügung gestellt, und wenn einmal wirklich Gelder zum Halten von einem oder einigen Spionen bewilligt wurden, so geschah dies nur nach bogenlangen Berichten, welche es den Offizieren und den dem Gouverneur unterstellten Beamten fast verleiden konnten, derartige im Interesse des Ganzen liegenden Anträge zu stellen. Diese Sparsamkeit ist übel angebracht und in Wirklichkeit häufig eine Verschwendung. Denn auf ein paar Tausend Rupies im Jahre kann es nicht ankommen, wenn man sich dadurch eine genaue Kenntnis dessen, was unter den Eingeborenen im Geheimen vorgeht, ihrer Absichten und ihrer Gesinnung gegen uns verschaffen kann.
Nachdem der Reichskommissar die Vorbereitungen zum Beginn der Operationen gegen die Aufständischen bereits am 4. Tage nach Eintreffen des Transportdampfers »Martha« auf der Rhede von Bagamoyo beendet hatte, beschloß derselbe nach erfolgter Verständigung mit dem Chef des Kreuzergeschwaders, Herrn Admiral Deinhard, sofort zum Angriff überzugehen. Ein möglichst rasches offensives Vorgehen bot in erster Linie eine Aussicht, gegen die vorwiegend auf Terrorismus gestützte Macht des Rebellenführers Buschiri einen entscheidenden Schlag zu führen, seinen Einfluß auf die Bevölkerung zu beeinträchtigen und die durch fortgesetzte feindliche[S. 58] Streifzüge sehr gehemmte Aktionsfähigkeit wieder zu erhöhen.
Eingezogene Nachrichten hatten ergeben, daß Buschiri, nachdem er in den letzten Monaten sein Lager mehrfach gewechselt, nun in einem stark befestigten Hauptlager in der Richtung landeinwärts von Bagamoyo, 1-1-1/2 Stunden von diesem Platz entfernt, alle seine Kräfte vereinigt habe. Der waffenfähige Anhang Buschiris wurde auf 6-800 Mann angegeben.
Nachdem die Unterstützung der Marine vom Admiral angeboten und vom Reichskommissar angenommen worden war, wurde der 8. Mai von beiden für die Operationen gegen Buschiri festgesetzt.
Am genannten Tage, früh 6-1/2 Uhr trat die Schutztruppe mit dem von der Marine gestellten Landungscorps von 200 Mann, welches der Korvettenkapitän Hirschberg, Kommandant S. M. S. »Schwalbe« befehligte, bei der Station in Bagamoyo an. Damit die farbigen Truppen möglichst alle im Kampf verwendet werden konnten, war die Station Bagamoyo für die Dauer der Operation durch eine andere Abteilung der Marine besetzt worden. Um 7 Uhr 10 Minuten setzte sich die Schutztruppe nach Erteilung der für den Marsch notwendigsten Instruktionen in folgender Marsch-Ordnung in Bewegung:
Avantgarde: Askaris — Frhr. v. Eberstein;
Abteilung Frhr. v. Gravenreuth — 2 Sudanesenkompagnien (Sulzer und von Perbandt);
Artillerie (zwei 4,7 cm Geschütze und ein 6 cm Geschütz) — Chef Krenzler;
geschlossenes Detachement der deutschen Unteroffiziere unter Premier-Lieutenant End;
Abteilung Dr. Schmidt — 2 Sudanesenkompagnien (Johannes und Radatz);
Abteilung von Zelewski — 1 Sudanesen- und 1 Zulukompagnie (Ramsay und v. Medem);
zum Ziehen der Geschütze wurden Waniamuesi mitgenommen, desgleichen gingen solche mit Erlaubnis Wißmanns, durch rote Tücher als die Unsrigen kenntlich gemacht, als Freiwillige mit.
[S. 59]
Nachdem der Marsch zunächst in südwestlicher Richtung durch die Bagamoyo umgebenden, ausgedehnten Kokosschamben erfolgt war, wurde nach Westen abgebogen und ein ungefähr 900 m breites, schattenloses, sumpfiges, mit fast mannshohem Grase bewachsenes Thal durchschritten, welches an dem besonders schwülen und heißen Tage, namentlich für die Artillerie, sehr schwierig zu passieren war. Die Marschdisciplin blieb indes bei den farbigen Truppen auf dem Hinmarsch eine gute. Nach Passieren dieses Thales wurde wieder in südwestlicher Richtung auf einem gut bewachsenen Höhenzug weiter marschiert, bis um 9 Uhr das Lager Buschiris der Avantgarde in Sicht kam.
Der Kommandant, welcher sich bei der Avantgarde befand, erteilte nun sofort die Befehle zum Angriff. Demzufolge nahm die Artillerie Aufstellung in der Linie der Askaris, welche, bis auf 600 m ans Lager herangekommen, ausschwärmten. Links von den Askaris befand sich die Abteilung Gravenreuth. Zelewski erhielt Befehl, rechts vom Wege abzubiegen und die linke feindliche Flanke zu umfassen, also nach der örtlichen Lage die Boma von Osten her zu umgehen. Dr. Schmidt sollte links abbiegen und die Umgehung der Boma von Westen her bewerkstelligen. In dieser Formation war man, die Artillerie eingeschlossen, bis 250 m an das Lager herangekommen. Die Marine-Abteilung befand sich dicht hinter den Askaris und der Artillerie.
Als die Truppen in dieser Ordnung bis auf etwa 200 m an die Boma herangekommen waren, wurde von Seiten der Rebellen ein heftiges Feuer aus Gewehren und einigen alten, mit Eisenstücken geladenen Böllern auf die Angreifer eröffnet. Zufällig kam zu gleicher Zeit aus dem Lager der überall bekannte weiße Buschirische Reitesel in Sicht und Wißmann, in der Absicht, den wohlbeleibten Buschiri dieses bei seiner Körperfülle sehr notwendigen Fluchtmittels zu berauben, gab einen Schuß auf den Esel ab. Dieser Schuß bildete unwillkürlich das Signal zur Eröffnung des Feuers auf der ganzen Linie; in der Front stand Gravenreuths Abteilung im 1. Treffen, während im 2. Treffen die Marine das Feuer ebenfalls eröffnete; als Wißmann bat, das Feuer des 2. Treffens einzustellen, da das 1. Treffen ihm dadurch gefährdet erschiene,[S. 60] wurde ihm von der Marine entgegengehalten, daß mit dem 600-meter-Visir von dieser geschossen werde.
Das feindliche Feuer richtete sich besonders auf eine kleine Anhöhe, wo Wißmann mit seinem Stabe bei der Artillerie Stellung genommen hatte, so daß dort, trotzdem die Aufständischen im allgemeinen recht schlecht zielten, einige Verluste in unmittelbarer Nähe des Reichskommissars, der für seine Person der Mahnung, sich nicht unnütz zu exponieren, kein Gehör schenkte, erlitten wurden.
Als der Kommandant durch anhaltendes Geschütz- und Gewehrfeuer den Feind hinlänglich erschüttert zu haben glaubte, gab er das Zeichen zum Aufpflanzen des Seitengewehrs und zum Sturm. Die Abteilung Gravenreuth drang zuerst in die Boma ein, allen voran Lieutenant Sulzer.
An der Spitze der Marineabteilung überklomm Lieutenant Schelle, ohne erst Bresche reißen zu lassen, die Pallisaden. Hierbei erhielt er eine Kugel in den Unterleib und erlag bald darauf dieser schweren Verwundung.
Herr von Gravenreuth war mit seiner Abteilung an der linken Flanke der Front eingedrungen, die Marine hingegen zugleich mit den Askaris unter Eberstein direkt in der Front, und zwar wurde nach dem Fall Schelles Bresche gerissen und drangen die Marinetruppen an dieser Stelle Mann hinter Mann durch die Bresche in die Boma, während Herr v. Eberstein mit den Askaris eine bei der Bresche befindliche Thür einrannte und durch diese ziemlich geschlossen mit seinen Leuten hineinkam.
Es ist damals ein sehr häßlicher Streit über die für die Sache natürlich ganz gleichgiltige Frage ausgebrochen, wer der erste in der feindlichen Boma gewesen sei. Von Seiten der Marine wurde der gefallene Lieutenant Schelle gemeldet; vom Reichskommissar der Lieutenant Sulzer. Dem Verfasser, der bei der Aktion gegen Buschiri nicht dabei gewesen ist, ist von verschiedenen Herren versichert worden, daß nicht nur Sulzer, sondern auch v. Gravenreuth und ein großer Teil der Soldaten von Gravenreuths Abteilung in der Boma, ja sogar in den dort befindlichen Hütten der Rebellen schon gewesen seien, als von der Frontseite her die Marine erst eindrang. Selbstverständlich[S. 61] ist die Meldung der Marine, daß Lieutenant Schelle der erste im Lager gewesen sei, in gutem Glauben erfolgt und ist dadurch zu erklären, daß wegen der im Innern der Boma errichteten Hütten und wegen der in solchen Momenten erklärlichen Aufregung das vorher erfolgte Einrücken Gravenreuths nicht gesehen wurde. Bedauerlich aber bleibt die Eifersüchtelei, welche zu jener Zeit zwischen Marine und Schutztruppe bestand. Obgleich sich die Offiziere der letzteren und auch viele Marineoffiziere redliche Mühe gegeben haben, dieselbe aus der Welt zu schaffen, besteht sie, wie dem Verfasser scheinen will, bis in die neueste Zeit hinein fort. Die Herren der Marine bedenken hierbei nicht, daß mit Beendigung der Blokade nach Übernahme des Reichskommissariats durch Wißmann ihre Aufgaben am Lande, denen sie sich ganz gewiß, wie von allen anerkannt wird, mit Eifer unterzogen haben, beendigt waren. Nur vereinzelt haben später Marinemannschaften die Operationen des Reichskommissars unterstützt, natürlich nur an der Küste oder in unmittelbarster Nähe derselben, wie hier bei Bagamoyo, dann bei Sadani, Pangani, Mkwadja. (Nur Tanga ist, worauf wir noch kommen werden, durch die Marine allein erobert worden.)
Beim Einrücken der Unsrigen in die Boma wagte nur ein Teil der Feinde noch standzuhalten und aus den Hütten im Innern der Befestigungen heraus zu schießen, wo sie dann teils niedergemacht, teils gefangen genommen wurden. Das Gefangennehmen freilich wollte nicht immer gelingen, da die Zulus, welche erst zwei Tage vorher eingetreten waren, gar nicht verstehen wollten, wie man einen überwältigten Feind schonen könne, statt ihn sofort zu tödten; so haben denn auch die Zulus vielen von den Rebellen, welche sich im letzten Augenblick ergeben wollten, durch ihre Seitengewehre den Garaus gemacht.
Von den Freiwilligen der Waniamuesi und den Askaris wurden die Zulus bei der Plünderung des Lagers in würdiger Weise ergänzt. Im großen und ganzen aber waren alle, welche die neue farbige Truppe während des Gefechts beobachtet hatten, im Lob derselben einig. Nirgends war weder während des Feuerns noch beim Sturm das geringste Zaudern eingetreten.
[S. 62]
Die Umgehung des Lagers, welche die Abteilungen Dr. Schmidt und v. Zelewski bewerkstelligen sollten, war nicht gelungen, da besonders Zelewski wegen des weiten Umweges, den er mit seinen Soldaten zu machen hatte, nicht zur rechten Zeit am Lager sein konnte. Es gelang daher dem größten Teil der Rebellen durch die Lücke zwischen den beiden von der Flanke anrückenden Abteilungen durchzukommen, wobei sie allerdings von der Abteilung Dr. Schmidt noch wirksam beschossen wurden.
Buschiri selbst war ebenfalls entkommen, hatte sich aber, wie er später selbst erzählte und wie auch bald hinterbracht wurde, im dichten Grase außerhalb der Boma versteckt und war so von den Verfolgern unbemerkt geblieben.
Das dicht bewachsene Terrain setzte der an die Einnahme des Lagers sich schließenden Verfolgung von selbst ein Ziel, um so mehr als die Europäer, sowohl die aus Europa gekommenen Offiziere und Unteroffiziere der Schutztruppe, wie die an afrikanische Märsche ebenfalls nicht gewöhnten Marinemannschaften und auch unsere Sudanesen sehr ermattet waren. Es zeigte sich dies unmittelbar nach dem Eindringen in die Befestigungen und auf dem Rückmarsch, der ein wenig angenehmes militärisches Bild abgab. Einige Fälle von schwererem und leichterem Sonnenstich kamen auf demselben vor. Die Zulus, Askari und Waniamuesi waren die einzigen, welche frisch geblieben waren und deren Benehmen und Schlachtgesänge etwas Leben in die Kolonnen der Marine und Schutztruppe brachten.
Die Zahl der Toten betrug auf gegnerischer Seite 106, fast alles Araber und Belutschen. Unter den Gefallenen ist wegen seines Einflusses besonders zu erwähnen der Jumbe von Windi, Ismael. Auf unserer Seite fielen — von der Marine: Lieutenant zur See Schelle und Obermatrose Föll; von der Schutztruppe 6 farbige Soldaten. Feldwebel Peter erlag dem Sonnenstich. Verwundet wurden — von der Marine: Obermatrose Klebba — von der Schutztruppe: Stabsarzt Dr. Schmelzkopf, Hauptmann Richelmann, Deckoffizier Illich und 3 Sudanesen.
Das Lager der Aufständischen zeigte ein ziemlich regelmäßiges Viereck von 800 m Umfang und war nach afrikanischen[S. 63] Begriffen mit einer sehr starken Befestigung umgeben. Sie bestand in Pallisadenreihen aus dicken Palmenstämmen. Hinter denselben war ein Graben für kniende Schützen ausgehoben, dessen Erde nach den Palisaden hin zu einem Wall aufgeschüttet worden war. Im Innern war, wie schon erwähnt, eine Zahl primitiver Hütten errichtet, welche den Rebellen Unterkunft gewährten, außerdem ihr Kleinvieh und Hühner wie ihren sonstigen Unterhalt bargen. Der vorgefundene Proviant und die noch in geringer Masse vorhandene Munition wurde durch die Einnahme des Lagers erbeutet; außerdem fielen in unsere Hände 2 arabische Fahnen, 2 Böller und Gewehre aller Art, darunter einige Mausergewehre, welche beim Ausbruch des Aufstandes auf den Stationen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft im Innern von den Rebellen vorgefunden waren, daneben befanden sich Snidergewehre, Hinterlader, Jagdgewehre, sowie die verschiedensten Perkussions- und Steinschloßgewehre. Die wertlosen Waffen und Sachen wurden verbrannt, das meiste aber — selbst ganz wertloses Hausgerät — von den Leuten, besonders den Sudanesen, die eine besondere Vorliebe für die Anhäufung von allerlei wertlosem Kram haben, nach Bagamoyo mitgenommen. Einige Kuriositäten, wertvolle Waffen der Araber und Belutschen sowie der Eingeborenen wurden ebenfalls vorgefunden. Ferner hatten unsere Soldaten in der Hütte Buschiris eine Kiste mit 6000 Rupien entdeckt, es aber vorgezogen, die Sache erst zu melden, nachdem sie den Inhalt unter sich verteilt hatten. Das Geld war vermutlich die für die englischen Missionare bezahlte Lösesumme und man beließ dieselbe den glücklichen Besitzern, um nicht gleich anfangs durch Untersuchungen Mißmut zu erregen. So wirkte auch der gute Fund ermunternd auf die Schwarzen, für welche ja überhaupt die Plünderung nach siegreichem Gefecht einen ungemeinen Reiz hat.
Der Geschwaderchef, Herr Admiral Deinhard, hatte (nach Rücksprache mit dem Reichskommissar) für einen eventuellen Empfang der entkommenen Rebellen Sorge getragen, indem er eine Marineabteilung nach der Windi- und Mtoni-Fähre schickte, wo der Uebergang von fliehenden Rebellen erwartet werden konnte. Die Fährboote, welche sich an jenem Teil[S. 64] des Kinganiflusses vorfanden, wurden, um ein Übersetzen der Rebellen zu verhindern, von der Marine zerstört. Indes hatten die Flüchtlinge es meist für klüger gehalten, sich zunächst, so lange sie das Terrain unsicher wußten, im dichten Gebüsch versteckt zu halten, wohin man ihnen nicht folgen konnte, und dann weiter zu flüchten, wobei von ihnen die weiter stromaufwärts befindliche Dunda-Fähre des Kingani benutzt wurde. Dorthin aber konnten die Pinassen der Marine wegen mehrfacher in jenem Teil des Kingani vorhandener Untiefen nicht geschickt werden.
Dem Reichskommissar hatte Dr. Peters seine für die Emin Pascha-Expedition in Aden angeworbenen Somalis zum Angriff auf Buschiri zur Verfügung gestellt; es war jedoch von ihrer Verwendung Abstand genommen worden, da sie Bedenken trugen, gegen ihre eigenen Glaubensgenossen zu kämpfen. Jetzt, als nach gelungenem Angriff die Truppen in Bagamoyo einrückten, zeigte sich ein Teil der Somalis beschämt und bat darum, auf den noch am selben Tage ausgesandten Patrouillen mitverwandt zu werden.
Nach dem Einrücken der Soldaten erhielt Freiherr v. Gravenreuth den Befehl, eine Rekognoszierung zu unternehmen zur Aufsuchung eines vermißten Offiziers, der, an der Queue seiner Abteilung, von den Seinen unbemerkt, infolge eines Sonnenstiches liegen geblieben war, und zugleich um auf etwaige Rebellentrupps zu fahnden. Der Vermißte kehrte aber von selbst bald darauf zurück, und die Rekognoszierungen Gravenreuths und später Zelewskis konnten nur feststellen, daß die nächste Umgebung von Bagamoyo bis zum benachbarten Teile des Kingani völlig von den Aufständischen gesäubert war. Kleine Patrouillen wurden zum großen Teil zu Pferde ausgeführt, von denen etwa 20 aus Egypten resp. Aden mitgebracht worden waren.
Einige Wochen später drangen nach Bagamoyo Nachrichten über neue Befestigungen, welche Buschiri in größerer Entfernung angelegt habe; ebenso habe er wieder eine große Zahl Anhänger gesammelt. Infolgedessen wurden von Wißmann zweimal Abteilungen unter Dr. Schmidt und Zelewski in solcher Stärke ausgesandt, daß es ihnen möglich war, die[S. 65] Rebellen mit Aussicht auf Erfolg anzugreifen. Die Expedition unter Zelewski führte zu keinem Resultat, da der Gegner in dem von ihr durchzogenen Gebiet nicht zu finden war. Die später ausgesandte Abteilung des Dr. Schmidt fand zwar mitten in dichtem Gestrüpp ein wohlbefestigtes Lager Buschiris, eine sogenannte Buschboma, zu welcher nur wenige schmale Stege führen, doch hatte Buschiri, der jedenfalls von dem Anmarsch Dr. Schmidts durch seine Kundschafter Nachricht erhalten, es vorgezogen, noch im letzten Augenblick ohne Kampf die Boma zu verlassen. Die Hausutensilien und die noch vorhandenen Lebensmittel, etwas Kleinvieh und Hühner, wurden zur Beute gemacht, die Boma selbst aber wurde den Flammen Preis gegeben. Es war dies, so begierig auch die Expedition war, den Gegner anzugreifen, doch den Herren nachträglich nicht unerwünscht, da die Stellung Buschiris eine derartige war, daß ein erfolgreicher Sturm auf das im größten Dickicht befindliche Lager, wenn überhaupt, nur mit den schwersten Verlusten möglich gewesen wäre. Das erste Lager hatte den Vorzug in freiem Terrain zu liegen, so daß es von allen Seiten gesehen und angegriffen werden konnte.
Wenden wir uns nun nach Daressalam, wo durch den von Wißmann dem Verfasser gesandten kleinen Teil der Schutztruppe die Marineabteilung abgelöst wurde, welche bisher als Besatzung der Station gedient hatte; S. M. S. Carola, welche zuletzt die Stationsbesatzung gestellt und deren Bemannung sehr unter Fieber- und Todesfällen zu leiden hatte, war bei der Besetzung der Station durch die Schutztruppe zunächst aus dem Hafen heraus auf die Rhede von Daressalam, dann ganz nach Bagamoyo in See gegangen. Für Daressalam erhielt der Verfasser von dem Reichskommissar die Instruktion, sich mit seiner kleinen Truppe auf die Verteidigung der Station und des Platzes zu beschränken und sich auf sonstige Unternehmungen nicht einzulassen. Um Daressalam hatten sich nicht, wie um Bagamoyo, die Rebellen alle in einer starken Befestigung versammelt, sondern sie waren auf mehrere befestigte Dörfer der Umgegend verteilt. Als nun die Nachricht von der Einnahme des Buschirischen Lagers, wenn auch mit einzelnen Unrichtigkeiten, südwärts zuerst zur Bevölkerung und[S. 66] zu den Rebellen, dann durch Spione nach der Station gedrungen war, erschien es notwendig, da, wo es mit Aussicht auf Erfolg möglich war, möglichst schnell einzugreifen, ehe die Aufständischen sich noch mehr zersplitterten oder ganz abzogen. In erster Linie wünschte der Verfasser das nahe gelegene Magogoni anzugreifen, in dem sich viele Araber und Belutschen befanden. Das Gesindel hatte der Station immer Schwierigkeiten gemacht und war im Besitze einer großen Viehherde. Nur den Offizieren wurde von der Absicht des Überfalls auf Magogoni Mitteilung gemacht, da sonst Grund zur Annahme vorlag, daß der Plan verraten und vereitelt werden würde. In der Nacht vom 12. bis 13. Mai wurde die Stationsbesatzung alarmirt, Munition verteilt und Lieutenant von Behr, dem sich der Beamte der Ostafrikanischen Gesellschaft, Herr Küsel, anschloß, der Befehl erteilt, mit 20 Mann bei Tagesanbruch unbemerkt westlich von Magogoni zu landen. Verfasser selbst fuhr mit Lieutenant Merker und den letzterem zugeteilten 30 Mann die Innenseite des Hafens und die schmale Landzunge entlang, auf welcher Magogoni liegt, und landete auf der diesem Orte entgegengesetzten Seite. Nach einstündigem Marsch erreichten wir Magogoni. Die Annäherung beider Abteilungen war wohl während der Nacht ziemlich unbemerkt erfolgt, doch stürzten sowohl der Abteilung v. Behr wie der Abteilung Merker kurz vor dem Dorfe Bewaffnete in ungeordneten Trupps entgegen, welche sofort in die Flucht geworfen wurden. Der Verlust der Gegner betrug 8 Tote, darunter 2 Araber. Es wurden neben 60 Stück Kleinvieh 90 Rinder erbeutet, welche den Strand entlang getrieben wurden bis an den Hafen von Daressalam, über welchen sie dann mit einer Pinasse zur Station gebracht wurden. Die in der weiteren Umgebung lagernden Banden sah sich Verfasser außer stande anzugreifen, da die Station nicht entblößt werden konnte, und erst Wißmanns Befehl und Truppenverstärkung hierzu abgewartet werden mußte.
Das Unternehmen gegen Magogoni billigte der Reichskommissar und auf die Meldung von der unbedingten Notwendigkeit, sofort gegen die anderen Rebellennester um Daressalam vorzugehen, kam er persönlich am 19. Mai auf[S. 67] dem von Dr. Peters gecharterten Dampfer Neera nach Daressalam, brachte über 100 Mann unter Chef Theremin und Lieutenant von Medem mit und erteilte dem Verfasser den Befehl am 20. Mai mit zwei kombinierten Kompagnien (Marschordnung: 1. Kompagnie [Lieutenant von Behr, Lieutenant Blümcke], 2. Kompagnie [Chef Theremin, Lieutenant von Medem] nach Mabibu vorzurücken, zu rekognoszieren und eventuell anzugreifen. Das Rebellenlager wurde gefunden, wurde aber bei unserer Annäherung verlassen. Vergebens versuchten die Aufständischen, ihre Viehherde vor uns zu retten; die kleinen Abteilungen, mit denen Plänkeleien entstanden, wurden schnell geworfen, und die ganze Herde, 80 Rinder und eine Menge Kleinvieh erbeutet. Auch einige Fahnen und Waffen fielen in unsere Hände; das Lager wurde geplündert und eingeäschert. Seliman ben Sef war leider entkommen, mit ihm Schindu.
Am nächsten Tage machte ich eine Rekognoszierungstour nach Magurmura, dem Dorfe Schindus. Dieselbe endete mehr komisch als erfolgreich. Die Einwohner flohen bei unserer Annäherung, nur eine alte energische Dame wehrte sich unter furchtbarem Geschimpfe mit einem Messer heftig gegen die Soldaten und verwundete einen derselben. Sie entpuppte sich später als Mutter des Rebellenhäuptlings und war als solche auch gleich von den Suaheli-Askaris erkannt worden. Sie wurde natürlich dingfest gemacht, mit nach der Station genommen, und dort einige Tage zur Beruhigung ihrer Nerven eingesperrt. Nach einem vereitelten Versuch ihrerseits, durch eine fensterartige Oeffnung der Bastion zu entweichen, wurde sie als im übrigen harmlos wieder entlassen.
Nach diesen Unternehmungen nahm der Reichskommissar die aus Bagamoyo mitgebrachte Kompagnie wieder dahin zurück, da große Rebellenansammlungen und ernste Schwierigkeiten um Daressalam nicht mehr bestanden. Die kleinen Unternehmungen des Verfassers gegen einzelne Rebellendörfer hatten genügt, den Bewohnern der Umgegend von Daressalam zu zeigen, daß es nunmehr ausschließlich ihr Besitz und Eigentum sei, die durch diese Unruhen gefährdet würden, denn wenn die Leute nicht standhielten, blieb nichts weiter übrig, als die unruhigen[S. 68] Massen an ihrem Eigentum durch Verbrennen und Ausplündern der Dörfer oder Konfiskation der Felder, so weit sie in unserm direkten Machtbezirk lagen, zu bestrafen.
Außerdem wurden die Jumbes sämtlicher im Umkreis von Daressalam gelegenen Ortschaften vom Verfasser aufgefordert, zur Station zu kommen und dort ihre vollständige Unterwerfung anzukündigen; so weit sie nicht eine ganz besonders hervorragende Rolle beim Aufstande gespielt hatten, wurde ihnen Straflosigkeit zugesichert. Diese Aufforderung und Zusicherung der Amnestie wirkte auf die gesamte Bevölkerung der Umgegend in gewünschter Weise. Nur gegen wenige Dörfer mußte in nächster Zeit vorgegangen werden. So wurde ein nochmaliges Vorgehen gegen Magogoni nötig, da dies große und reiche Dorf, besonders durch die Belutschen-Bevölkerung aufgehetzt, sich gegen uns auflehnte. Diesmal wurde es aber von Grund aus zerstört und geplündert.
Eine fernere Unternehmung aus dieser Zeit war die Bestrafung des Ortes Ukonga, dessen Pasi (Häuptling, Dorfschulze) Jangajanga hauptsächlich die Schuld an der Ermordung der Missionare in Pugu trug. Er hatte von den Missionaren die größten Wohlthaten empfangen und auch Geschenke dafür erhalten, daß er versprach, sie in Kenntnis zu setzen, wenn ihnen ein Anschlag der Rebellen drohe. Dieses Versprechen hatte er so eingelöst, daß er den Aufständischen von Bueni als Führer nach der Mission in Pugu diente und die Brüder und Schwestern meuchlings überfallen half. Als dem Verfasser dieses Verhalten Jangajangas zu Ohren gekommen war, trat er eines Tages mit einem Teil der Stationsbesatzung den Marsch gegen Ukonga an und traf daselbst bei Beginn der Abenddämmerung, kurz vor 6 Uhr ein. Bis zum Eintritt der Dunkelheit hielt sich unsere Abteilung im Gebüsch verborgen und überfiel dann, von den übrigen Dorfbewohnern ungesehen, den von Jangajanga und seinen Angehörigen bewohnten Teil Ukongas. Die Leute desselben leisteten nur ganz vereinzelt Widerstand; der Jumbe selbst hatte wohl Unrat gewittert und war zwei Tage zuvor weiter ins Innere geflohen. Verfasser setzte daher einen Preis auf seinen Kopf, es gelang jedoch nicht, ihn in unsere Gewalt zu bekommen.
[S. 69]
Nun ging Verfasser daran, endlich die Gebeine der ermordeten Missionare, die, wie er durch Kundschafter wußte, noch immer unbestattet in Pugu lagen, zur letzten Ruhe zu bringen. Mit den Herren Chef Theremin, Lieutenant Merker, Herrn Küsel, Unteroffizier Becker und einem kleinen Trupp Soldaten machte er sich auf. Außerhalb des von den Rebellen mit allen übrigen Missionsgebäuden in Asche gelegten Wohnhauses lag fast unversehrt der Leichnam des von den Eingeborenen als Fundi (Handwerksmeister) bezeichneten Missionars, der als Bruder Petrus festgestellt wurde. Im Hause selbst fanden sich die Gebeine des Bruders Benedict, die vom Feuer sehr gelitten hatten, und die wenigen Ueberreste der Schwester Martha, die von einer Innenwand des Gebäudes bedeckt lag. Das Feuer hatte offenbar darunter noch längere Zeit fortgequalmt, denn die Gebeine waren beinahe verkohlt. Die Reste der Unglücklichen wurden in je einen Sarg gelegt und neben den Gräbern der früher in ihrem Berufe verstorbenen Brüder und Schwestern beigesetzt. Wir schmückten, so gut es ging, die letzte Ruhestätte mit Palmenzweigen, und Lieutenant Merker machte eine photographische Aufnahme, welche der katholischen bairischen Missionsgesellschaft zugleich mit einigen Andenken an die Märtyrer ihres Berufs, die sich noch auf der ausgeplünderten und niedergebrannten Stätte gefunden hatten, übersandt wurden. Den Jumbes wurde streng anbefohlen, auf die Gräber sorgfältig Acht zu geben, wir drohten, deren Schändung an den Pugu-Leuten selbst zu bestrafen. Die letzteren waren freilich an der Unthat selbst nicht schuldig, ihr Fehler war nur der gewesen, daß sie es nicht gewagt hatten, der Uebermacht der Rebellen zu trotzen und die wegen ihrer Wohlthätigkeit und ihres stillen segensreichen Wirkens bei ihnen wohl beliebten Missionare zu verteidigen. Daraus kann man den Negern aber keinen Vorwurf machen. Von der Missionsgesellschaft, welcher der Verfasser bei der Uebersendung der Photographien von der Bestattung ihrer Angehörigen und den näheren Umständen ihrer Ermordung und Auffindung Mitteilung gemacht hatte, ging ein Dankschreiben ein, das ihren Gefühlen Ausdruck gab und zeigte, daß die schwergeprüften Väter nicht den Mut und die Lust[S. 70] verloren hatten, ihr Werk in Afrika fortzusetzen. Ihre jetzige Station ist Daressalam.
Während des größten Teils des Monats Juni und im Monat Juli konnten wir uns so in Daressalam der friedlichen Arbeit, dem weiteren Ausbau der Station und der Ausbildung der Truppen widmen und einige kleinere friedliche Expeditionen unternehmen. Nur noch einmal, im Monat August, wurde der Verfasser anläßlich der traurigen Pugu-Affaire genötigt, gegen die Ortschaft Simbasi vorzugehen, in welcher es ihm auch durch einen Ueberfall gelang, zwei beim Morde der Pugu-Missionare beteiligte Araber gefangen zu nehmen, die dann vom Reichskommissar zum Tode durch den Strang verurteilt wurden.
Nach dem Ausbruch des Aufstandes an der Küste waren es neben der Kilwabevölkerung besonders die Leute Bana Heris, des Machthabers von Usegua, welche sich durch eine große Unthat straffällig machten. Der mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft vom Sultan abgeschlossene Vertrag hatte Bana Heri um so härter betroffen, als er von den Machthabern an der Küste der einzige war, der niemals den Sultan von Sansibar als Herrn anerkannt hatte. Es war nur natürlich, daß Bana Heri nicht gutwillig auf das gute Einkommen Verzicht zu leisten gewillt war, welches er bislang durch die nach Sadani ziehenden Karawanen gehabt hatte. Eben so wenig wollte er den Einfluß einbüßen, den er als Sultan von Usegua, — wie er sich nannte, — in Usegua, Nguru und teilweise Ukami genoß und der naturgemäß wegen der zu jener Zeit gegen die Deutschen herrschenden Mißstimmung und Mißachtung noch gewachsen war. Diese Mißstimmung gegen alles Europäische zeitigte Ausschreitungen des fanatischen Pöbels und fand ihren empörendsten Ausdruck in der Ermordung des englischen Missionars Brooks, der im Januar 1889 aus dem Innern nach der Küste kam und hierzu die Sadanistraße benutzte. Brooks war von Abdallah, Bana Heris Sohn und einem Teil seiner Leute auf der Sadanistraße anscheinend in friedlicher und freundschaftlicher Absicht in Empfang genommen und in der Richtung nach der Küste hin geleitet worden. Bald darauf fand man ihn auf der Straße hinterrücks erschossen vor. Beide Arme waren ihm abgeschlagen,[S. 71] sein Leichnam zerstückelt, die Stücke verstreut. Fünfzehn seiner farbigen Begleiter wurden gleichfalls ermordet, die Waren und das Gepäck geraubt.
Es ist stets angenommen worden, daß der Urheber dieser Unthat der oben erwähnte Abdallah gewesen ist, obwohl sich das nicht mit absoluter Bestimmtheit nachweisen ließ.
Bana Heri erwartete natürlich auf jenen Mord hin ein Einschreiten der deutschen Regierung und rüstete sich, diesem wie auch einer Okkupation seines Landes energisch zu begegnen. Es strömte ihm sein Anhang in Usegua zu und wurde in der ersten Zeit noch durch Wadoës verstärkt. Bana Heri verschanzte sich besonders in Sadani und Uwindji und hatte außerdem verschiedene Befestigungen im Hinterlande dieser Küste errichtet.
Schon vor der Ankunft Wißmanns war Herr Admiral Deinhard gegen den Usegua-Sultan eingeschritten, indem er Sadani von See aus bombardierte. Der Admiral meinte hierdurch den Rebellen eine fühlbare Strafe zu teil werden zu lassen. Er hatte sich aber hierin getäuscht und nur bewirkt, daß die Rebellen während der Beschießung den Ort verließen und sich hinter demselben in gesichertes Terrain flüchteten. Als sie sahen, daß die Kriegsschiffe die Rhede verließen, kamen sie wieder zum Vorschein und schossen, gewissermaßen zum Hohn, mit einer alten Kanone hinter den Kriegsschiffen her, selbstverständlich ohne irgend welchen Schaden zu thun. Es schien daher, als der Aufstand in Bagamoyo und Daressalam niedergeworfen war und diese Orte gesichert schienen, notwendig, Sadani zu züchtigen.
Dies konnte nur durch eine Landung mit der gehörigen Truppenmacht geschehen. Wißmann war allerdings nicht in der Lage, damals schon vor der Einnahme von Pangani und Tanga Sadani dauernd zu besetzen, da seine Truppen für den nördlichen Küstenstreifen notwendig gebraucht wurden, aber er wollte mit der Züchtigung von Sadani noch den Zweck verbinden, durch einen entscheidenden Schlag gegen Bana Heri die Rebellen in Pangani einzuschüchtern und dadurch zu Friedensverhandlungen geneigter zu machen, zumal ihm von der Reichsregierung anempfohlen worden war, auf solche einzugehen.[S. 72] Wie wir später sehen werden, befand sich unter der Bevölkerung von Pangani eine Partei, die zum Frieden mit den Deutschen riet und diesen dringend wünschte.
Als Operationstag gegen Sadani wurde der 6. Juni festgesetzt. Tags zuvor wurden alle irgendwie entbehrlichen Truppen, im ganzen 500 Mann, unter den Chefs v. Gravenreuth, v. Zelewski, Krenzler und dem Verfasser, der von Daressalam herübergekommen war, mit zwei Geschützen auf dem von der Marine gecharterten Dampfer »Cutch« in Bagamoyo eingeschifft. Am 6. Juni früh begann seitens des Geschwaders, welches außer dem »Cutch« aus der »Möwe«, die solange Sadani blokiert hatte, »Leipzig«, »Schwalbe« und »Pfeil« bestand, die Beschießung der gegnerischen Befestigungen; während derselben zogen sich die Rebellen in die südlich gelegenen dichten Gebüsche zurück.
Als das Feuer der Kriegsschiffe schwieg, eröffneten die mit Revolverkanonen armierten Pinassen, welche das Expeditionskorps, jede drei oder vier Boote hinter sich schleppend, ans Land brachten, ein wirksames Granatfeuer.
Da der Strand von Sadani sehr flach zuläuft, mußten wir von den Booten aus noch eine längere Strecke durch das Wasser waten unter dem Feuer der Feinde, welche mittlerweile aus den Gebüschen heraus an den Strand geeilt waren, um unsere Landung zu verhindern. Dabei erhielt Unteroffizier Bilke einen Schuß durch den Arm und Lieutenant von Medem und einige Farbige wurden leicht verwundet, — der Verlust der Aufständischen soll sich nach ihren eigenen, freilich sehr unsicheren Angaben, auf 105 Tote belaufen haben. Chef von Zelewski führte den linken Flügel, Gravenreuth den rechten, der Verfasser das Centrum, das aus zwei Kompagnien unter den Herren von Perbandt und Sulzer und dem geschlossenen Trupp der deutschen Unteroffiziere unter Lieutenant v. Sivers bestand.
Während Gravenreuth Sadani selbst angriff und das Terrain hinter demselben säuberte, gingen die Abteilung Zelewski und die des Verfassers dem Befehl gemäß südlich des Dorfes durch die Büsche und Mangrove-Sümpfe vor, ohne sonderlichen Widerstand zu finden. Ziemlich das einzige Unglück, das passierte, war, daß dem Verfasser seine Schuhe[S. 73] und Strümpfe im Sumpfe stecken blieben und er so das Vergnügen hatte, den ganzen Tag barfuß durch die Dornen und den heißen Sand zu laufen.
Im Westen der Sümpfe hatten sich die Feinde zum Teil wieder gesammelt, doch wurden sie durch meine ausgeschwärmte Abteilung und das Feuer des Maxim-Guns unter Lieutenant Böhlau schnell in die Flucht gejagt. Bald darauf traf Zelewski, der weiter südlich die abziehenden Feinde beschossen hatte, beim Verfasser ein, während Wißmann mit der Gravenreuthschen Abteilung die Gegner noch in der Richtung auf Ndumi verfolgte und die Landungscorps der Marine im Norden Sadanis die Feinde verjagten. Die Befestigungen wurden zerstört, der Ort geplündert und eingeäschert.
Bei solchen gemeinsamen Plünderungen, wie sie bei Sadani, Pangani, erfolgten, kamen öfters unsere Marinesoldaten mit ihren schwarzen Waffenbrüdern in der Schutztruppe in Streitigkeiten um den Raub, und derartige kleine Zwistigkeiten wurden, wie schon erwähnt, dann tragischer aufgenommen, als sie es verdienten.
Nachdem wir kurze Rast gehalten und von dem, was wir mitgenommen oder erbeutet, gefrühstückt hatten, schifften wir uns wieder auf dem »Cutch« ein, aber nur um gleich darauf wieder 3 Stunden nördlich von Sadani bei Uwinje zu landen, wo sich eine Schamba Bana Heris und feindliche Befestigungen befanden. Auch dieser Platz wurde nach geringem Widerstand genommen und zerstört; die dort liegenden Dhaus, welche den Aufständischen Waffen und Munition zugeführt hatten, wurden verbrannt. Wir hatten bei Sadani und Uwinje zusammen 2 Tote und 9 meist leicht Verwundete. Die hierauf folgende Nacht wurde an Bord des »Cutch« in heiterster Laune verbracht, und am nächsten Tage ging es wieder zurück nach Bagamoyo.
Es wurde nun vom Reichskommissar die Operation gegen Pangani vorbereitet. An der Spitze der Friedenspartei daselbst stand der Araber Said Hamedi, ein alter Mann, der erstens keine Lust hatte, sich in einen Krieg mit uns einzulassen, auch vorher die Beamten der Deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft gegen die aufgeregten Volksmassen geschützt hatte,[S. 74] und der sich andrerseits wohl bewußt war, daß er, dessen Reichtum an der Küste ein großer war, nur an seinem Besitztum verlieren könne, wenn die Rebellen unterlägen. Ebenso dachten viele der begüterten Araber und der reichen Suaheli von Pangani.
Die Rebellion daselbst wurde indes durch die besitzlosen Araber und Belutschen, welche bei der Unsicherheit der Verhältnisse nur gewinnen konnten, geschürt und die kritiklose Masse der Eingeborenen so mit fortgerissen.
Die Friedenspartei in Pangani wandte sich an den Sultan von Sansibar mit der Bitte um Vermittlung beim deutschen Reichskommissar. Wißmann schickte daraufhin den früheren Wali von Pangani Soliman ben Nassr mit Abgesandten des Sultans nach Pangani, um der Bevölkerung durch diese Gesandten die Bedingungen der friedlichen Uebergabe zu übermitteln. Als der Abgesandte des Reichskommissars jedoch sich in einem Boote dem Strande von Pangani näherte, wurde er mit Schüssen empfangen und mußte unverrichteter Sache wieder nach Sansibar zurückkehren. In gleicher Weise war während der zwischen dem Reichskommissar und den Pangani-Leuten schwebenden Verhandlung eine auf der Panganireede liegende Dampfpinasse der »Leipzig« unter Lieutenant zur See v. Möller von den Rebellen beschossen worden. So zeigte sich, daß in letzter Stunde in Pangani wieder die Kriegspartei die Oberhand gewonnen hatte.
Viel hatten dazu wohl auch die falschen Nachrichten beigetragen, welche über das Gefecht von Sadani nach Pangani gedrungen waren; es sollten nämlich wohl die Rebellen große Verluste erlitten haben, aber auch 100 Deutsche teils gefallen, teils in den Sümpfen stecken geblieben sein. Es wurde damals in der Truppe der Witz gemacht, meine im Sumpfe stecken gebliebenen Stiefel hätten zu dieser Uebertreibung Veranlassung gegeben.
Als Tag des Angriffes wurde von Wißmann der 9. Juli bestimmt. Tags zuvor wurden alle zur Verfügung stehenden Truppen in Bagamoyo eingeschifft und in Bagamoyo selbst unter Chef von Gravenreuth, in Daressalam unter dem Verfasser eine starke Besatzung zurückgelassen, weil dem Gerücht[S. 75] zufolge ein Angriff Buschiris auf die Stationen zu erwarten stand. Am Abend des 8. vereinigten sich die Wißmannschen Schiffe »Harmonie«, »München«, »Vulkan« und »Max« — der »Vesuv« wartete noch in Aden das Aufhören des Südwestmonsuns ab —, mit dem Geschwader, welches den Ort bis dahin blokiert hatte.
Pangani liegt am linken Ufer des ebenso genannten Flusses, etwas landeinwärts.
An beiden Ufern erheben sich ziemlich steile Anhöhen von 100-200 Fuß, die mit dichtem Buschwerk bestanden und von Schützengräben umgeben waren. Die feindliche Stellung war also, zumal da nur schmale Zugänge hinaufführten und diese mit drei Vorderladern armiert waren, eine ziemlich starke und wurde von den Rebellen für uneinnehmbar gehalten. Die Hauptbefestigungen lagen auf dem rechten Ufer, wohin denn auch die sämtlichen Schiffe, mit möglichster Schonung des Ortes selbst, ihr außerordentlich wohl gezieltes Feuer richteten.
Der Strand ist hier sehr flach; die Truppen warteten daher, um möglichst wenig im Wasser unter dem Feuer der Feinde waten zu müssen, den höchsten Stand der Flut ab, und bewerkstelligten die Landung an einer kleinen, vor dem rechten feindlichen Flügel gelegenen Bucht. Das Angriffskorps war in drei Treffen formiert; das erste, bestehend aus der 1. und 5. Kompagnie unter Dr. Schmidt, wurde sogleich nach der Landung in Schützenlinien formiert und ging unter lebhaftem Feuer auf die im Gebüsch versteckt liegenden Gegner gegen die Höhe vor.
Als das zweite Treffen unter Chef Freiherrn von Eberstein herankam, wurden die Feinde aus allen Befestigungen geworfen und in eine westlicher gelegene Hügelkette getrieben, deren dichtes Buschwerk der Verfolgung bald ein Ziel setzte.
Das dritte Treffen unter v. Zelewski war durch ungünstige Umstände zu lange aufgehalten worden und kam nicht mehr ins Feuer.
Auch die Rebellen auf dem linken Ufer flohen aus ihren Pallisadenverschanzungen und suchten sich, am ungedeckten Flußufer entlang ziehend, in den Ort selbst zu retten; zur Hälfte[S. 76] aber wurden sie von den mittlerweile nachgekommenen Maxim-Geschütz unter Lieutenant Böhlau zusammengeschossen.
Es blieben von den Arabern etwa 30 Tote und 50 Verwundete auf dem Platze, ein Zeichen, eine wie furchtbare Wirkung das Maxim-Geschütz mit seinen 600 Schuß in der Minute in der Hand eines geschickten Artilleristen ausübt.
So fand denn die 300 Mann starke Marineabteilung unter Kapitän zur See Plüddemann, welche endlich trotz der heftigen Brandung auf dem linken Ufer des Flusses gelandet war, den Feind in den Befestigungen nicht mehr vor, auch nicht mehr in Pangani selbst. Auf unserer Seite war nur ein Sudanese gefallen, ein deutscher Unteroffizier und 3 Sudanesen waren verwundet.
Pangani wurde von der 5. und 6. Kompagnie besetzt, die Befestigung auf dem rechten Ufer zur Zeit der Abwesenheit des Expeditionskorps von der 1.-3. Kompagnie. Die Europäer und die Truppen, welche alle vollkommen durchnäßt waren, hatten, da der Proviant bis zum Abend des Gefechtstages noch nicht hatte vom Bord der Schiffe aus ans Land geschafft werden können, nach der Anstrengung des Tages nicht einmal eine Stärkung. Erst am Abend half Wißmann persönlich, als er auf der Pangani- wie auf der Ras Muhesa-Seite die Truppen inspizierte, diesem Übelstande dadurch ab, daß er sofort selbst für die Übersendung der nötigen Vorräte Sorge trug. Das frühere Gesellschaftshaus in Pangani, von dem aus man einen bequemen Überblick über den ganzen Ort hatte und diesen wie das Flußufer mit Feuer bestreichen konnte, wurde als Stationshaus beibehalten und der Bau von Befestigungen hier wie auf Ras Muhesa begonnen.
Ras Muhesa ist ein Felsen an der rechten Flußmündung, der auf drei Seiten schroff ins Meer abfällt. Das Buschwerk auf der vierten Seite, welches den freien Überblick hinderte, wurde ausgerodet, und der Zugang mit einer 1-1/2 m hohen Wand aus Wellblech mit Erdeinlage geschützt.
Da diese Befestigungsarbeiten in Pangani und auf Ras Muhesa längere Zeit in Anspruch nahmen, der Reichskommissar sie aber so sehr als möglich fördern wollte, um eine möglichst geringe Anzahl von Soldaten dort als Besatzung zurückzulassen,[S. 77] konnte der ursprünglich zwischen Wißmann und dem Admiral verabredete Termin für die Operation gegen Tanga, der 10. Juli, nicht innegehalten werden. Der Admiral aber, den Gründen Wißmanns unzugänglich, ging infolgedessen am 9. mit dem Geschwader voraus und schickte noch am selben Tage in Tanga eine Botschaft ans Land, die Einwohner sollten, wenn sie den Frieden wünschten, mit ihm in Unterhandlungen treten. Sie erbaten sich, da sich die friedlich gesinnten Neger nicht sogleich mit den im allgemeinen zum Kriege geneigten Arabern und Belutschen einigen konnten, drei Tage Bedenkzeit. Diese wurde vom Admiral abgeschlagen.
So wurde denn am 10. früh das Landungscorps der Marine formiert und an Land gesetzt. Es wurde zuerst mit Schüssen empfangen, doch ergriffen die Rebellen beim ersten Schnellfeuer der Marinetruppen die Flucht und wurden mit geringer Mühe aus Tanga selbst und seiner näheren Umgebung vertrieben. Das frühere Haus der ostafrikanischen Gesellschaft wurde mit 100 Mann der Carola besetzt, um den Ort gegen etwaige feindliche Angriffe halten zu können.
Einige umliegende Dörfer schickten nach Tanga und erbaten den Frieden, der ihnen vom Admiral auch gern gewährt wurde. Die Inder waren im Ort zurückgeblieben, ein Zeichen, daß von vornherein eine Aussicht auf einen ernsten Kampf um Tanga nicht vorhanden war, und die Friedenspartei hier die Oberhand hatte. Wißmann wurde durch einen Brief des Admirals vom 11. Juli davon in Kenntnis gesetzt, daß Tanga von der Marine genommen und besetzt sei, und daß das Geschwader bis zum 14. Juli auf den Reichskommissar warten werde. Wißmann fuhr infolgedessen am 13. auf der München zunächst allein nach Tanga, wählte einen Platz für die Station aus, von wo aus der Ort und der Hafen beherrscht werden konnte, und als am 15. das Expeditionskorps nachkam, wurde sofort mit der Befestigung des Platzes, welche hier von Grund aus neu gebaut werden mußte, begonnen.
Das provisorische Fort wurde aus Wellblech und Brettern hergerichtet und mit einem Stacheldrahtzaun umgeben. Die Bauten gingen in Pangani und Tanga, Dank des Eifers unserer Zulus und Sudanesen, so außerordentlich schnell von statten,[S. 78] daß Wißmann bald den Norden verlassen und sich wieder nach Bagamoyo zurückbegeben konnte, nachdem er die Station Tanga mit einer Kompagnie besetzt und dem Chef Krenzler übergeben hatte.
Aus Pangani nahm er die Ueberzeugung mit, daß der Handel hier bald wieder den früheren Umfang annehmen würde, da bereits in den ersten Tagen nach der Einnahme des Ortes eine Anzahl der flüchtigen Rebellen zurückgekehrt war und sich unterworfen hatte.
Als so die Hauptplätze an dem nördlichen Teil der Küste unseres Interessengebietes wieder unter unsere Herrschaft gebracht waren, dachte Wißmann daran, die Verkehrswege, welche nach dem Innern führten, von neuem zu eröffnen; hierzu gab besonders den Anstoß die Absicht der in Daressalam weilenden großen Waniamuesi-Karawane, in ihre Heimat mit den gegen ihr Elfenbein an der Küste erhandelten Waren zurückzukehren.
Da sie alle von Bagamoyo, dem Endpunkt der großen Karawanenstraßen aus, gemeinsam den Rückmarsch antreten wollten, ging Wißmann daran, die in Daressalam befindliche Karawane dorthin überzuführen. Er sandte zu dem Zweck Ende Juli sein Expeditionskorps unter Führung des Chefs von Zelewski nach Daressalam, wohin er sich Tags darauf selbst begab, ließ die Waren und sämtliches Gepäck der Waniamuesi per Dampfer nach Bagamoyo bringen, und führte selbst auf einem dreitägigen Marsche die Karawane unter der Bedeckung seiner Soldaten ebendahin. Während dieses Küstenmarsches pflog der Reichskommissar persönlich Verhandlungen mit den Jumbes der Küstenorte, und gewann hier, wie überall und zu jeder Zeit, das volle Vertrauen der Eingeborenen zur deutschen Herrschaft. In Bueni, dem bedeutendsten Küstenplatze zwischen Bagamoyo und Daressalam, dessen Handel entschieden der ausgedehnteste an der Küste ist, wurde der bisherige Wali, Sef ben Issa, welcher ebenfalls an der Ermordung der Missionare in Pugu hervorragend beteiligt war, seines Amtes enthoben, sein Besitztum konfisziert, seine Sklaven freigelassen, und ein Preis von 1000 Rupies auf seinen Kopf gesetzt. An seine Stelle trat Seliman ben Nassr, eine dem[S. 79] Reichskommissar sowohl wie der Bevölkerung genehme Persönlichkeit.
In der weiteren Umgegend von Bagamoyo, zwischen dem Kingani und dem Wami, hatten sich die alten Jumbes von Bagamoyo (Jehasi, Makanda, Simbambili und Bomboma), die Hauptverbündeten Buschiris, wieder festgesetzt und den ihnen durch Vermittler erteilten Rat, nach Bagamoyo zurückzukehren und sich Wißmann zu stellen, höhnisch zurückgewiesen. Wißmann mußte daher daran gehen, sie aus dieser Gegend zu vertreiben, um zu verhindern, daß Buschiri, wenn er aus dem Innern zurückkehrte, hier wieder einen Stützpunkt fände. Es wurde zu dem Zweck Chef v. Gravenreuth mit zwei Kompagnien und einer größeren Waniamuesi-Abteilung abgeschickt, mit dem Befehl, die Gegend zu säubern und die mit den Jumbes verbündeten Ortschaften zu zerstören, ein Auftrag, den Gravenreuth mit dem ihm eigenen Geschick ausführte. Er brachte den Gegnern erhebliche Verluste bei, ohne selbst solche zu erleiden, äscherte die Rebellenlager ein und nahm die dort angehäuften Lebensmittel weg. Dieser Erfolg trug bald gute Früchte, indem auch die Jumbes aus der weiteren Umgegend nach Bagamoyo kamen und um Frieden baten. Auch gegen die berüchtigten Sklavenhändler von Mlangotini wurde um diese Zeit ein Schlag geführt; ein Sklaventransport, den sie bei Nacht nach Sansibar zu bringen im Begriffe standen, wurde ihnen abgenommen und sie selbst wurden aufgehängt, unter ihnen der gefährlichste von allen Salem, den erfreulicherweise die Eingeborenen selbst gebunden dem Reichskommissar überbrachten.
In Sadani hatte sich inzwischen Bana Heri wieder mit einem Teile seiner Leute eingefunden, und schien durch alle Mißerfolge seiner Partei noch nicht im geringsten entmutigt, vielmehr entschlossen, den Kampf fortzusetzen und die Herrschaft über Usegua zu behaupten.
Sef ben Mohammed, der Sohn des unter dem Namen Tibbu-Tip bekannten Hammed ben Mohammed, war mit einer Menge Elfenbein und unter anderm auch mit Geschenken für Wißmann von seinem Vater aus dem Innern nach der Küste abgeschickt worden und nach unserm Kampf bei Sadani dort angekommen, hatte er vom Reichskommissar auf sein Ansuchen[S. 80] die Erlaubnis erhalten, die Festlandsküste zu verlassen, um nach Sansibar zu gehen. Er ging bald darauf wieder im Einverständnis mit Wißmann nach Sadani und bot hier all seinen Einfluß auf Bana Heri auf, um diesen zur Unterwerfung unter die deutsche Herrschaft zu veranlassen. Seine Bemühungen waren vollkommen vergeblich.
Der Reichskommissar wandte sich deshalb an den Kapitän Valette, den stellvertretenden Geschwaderchef nach Abgang der Leipzig aus Ostafrika, mit der Bitte, Sadani zu blokieren, um die Versorgung Bana Heris mit Waffen und Munition, wie überhaupt jede Kommunikation desselben mit Sansibar zu verhindern.
Die ersten in dieser Zeit eingetroffenen Berichte aus Pangani und Tanga an den Reichskommissar lauteten günstig. Die nächste Umgebung Panganis hatte sich bis auf den Dörferkomplex Muganda unterworfen. Auch mit diesem hoffte der Stationschef Dr. Schmidt ein friedliches Abkommen treffen zu können. Als er jedoch auf einem Spazierritt, den er allein in jene Gegend machte, von Muganda-Leuten mit Schüssen aus den Gebüschen auf beiden Seiten des Weges empfangen wurde und nur mit genauer Not entkam, sah er sich genötigt, sofort die Rebellen anzugreifen und sie zur Flucht weiter ins Innere hinein zu zwingen. Von der Stationsbesatzung fiel ein Mann und einer wurde schwer verwundet, während die Aufständischen erhebliche Verluste hatten.
In Tanga wurde, nachdem das letzte noch feindliche Dorf in der Umgegend, Timbari, vom Stationschef mit einem Teil seiner Besatzung und einer Matrosenabteilung von 16 Mann zerstört und den Rebellen ihr Vorrat an Munition und Proviant abgenommen war, der bei dem Gros der Bevölkerung beliebte Neger Munikombo als Wali eingesetzt und so auch hier Ruhe und Ordnung vollkommen wiederhergestellt.
[S. 81]
Mangel an Verwaltungspersonal. — Einrichtung und Geschäftsbereich der Verwaltung in der Schutztruppe. — Verwaltung des vorhandenen Dampfermaterials. — Unterstützung durch deutsche Firmen in Sansibar. — Das Hauptquartier. — Adjutant Bumiller. — Verkehr mit den Arabern und Indern. — Verteilung des Kriegsmaterials auf Stationen. — Das Sanitätswesen und die Hospitäler. — Tod des Stabsarztes Schmelzkopf. — Einexerzierung der Schutztruppe. — Deutsche Kommandos. — Uniformen und Gepäck. — Verteilung der Schutztruppe. — Schwarze Chargen. — Weiße Chargen. — Systematische Ausbildung der Gruppe. — Schießresultate bei Sudanesen und Zulus. — Disziplin der Zulus. — Verhältnis des Kommissariats zu den deutschen Behörden in Sansibar. — Verhältnis zur Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. — Dienst der Wißmann-Flotte.
Die Kämpfe um Bagamoyo, Daressalam, Pangani und Tanga bilden den ersten Abschnitt in der Niederwerfung des Aufstandes. Nach ihrer Beendigung konnte der Reichskommissar mit größerer Ruhe an die weitere Durchführung der ihm gestellten Aufgabe gehen. Während dieses ersten Teils seiner Thätigkeit hatte sich naturgemäß eine vollständige Umbildung des Reichskommissariats in allen seinen Teilen vollziehen müssen, da dasselbe anfangs nur zu sehr den Charakter des Provisorischen an sich trug.
In erster Linie gehörte hierher die Ausbildung der eigentlichen Verwaltung und des Verkehrs mit den wiedergewonnenen oder neugeschaffenen Stationen. Streng genommen stand dem Reichskommissar an geschultem Verwaltungspersonal nur zur Verfügung der Zahlmeisteraspirant der Marine Merkel, der jedoch bald nach seiner Ankunft den Wirkungen des Klimas unterlag. Dagegen war kein Intendanturbeamter, ja nicht[S. 82] einmal eine Art Sekretär vorhanden, sondern es vereinigte sich alles dieses in der ersten Zeit des Kommissariats in der Person von Eugen Wolf, der in der That ein ungemein großes Arbeitsquantum in geeigneter Weise erledigt hat.
Später mußte Wißmann aus seinem Personal an Offizieren diejenigen für die Verwaltung aussuchen, welche hierzu besonders geeignet erschienen. An die Spitze der Verwaltung wurde von ihm der Chef Freiherr von Eberstein gestellt, der sich, obwohl er keine andere Vorbildung mitbrachte als seine in Ostafrika gesammelten Erfahrungen, mit großer Umsicht und anerkennenswertem Fleiß, im Interesse der Sache, diesem ihm ursprünglich gewiß nicht angenehmen Amte widmete. Es gelang ihm auch mit den übrigen ihm unterstellten Beamten die Verwaltung, soweit es eben bei den damaligen Verhältnissen möglich war, in geordnete Bahnen zu lenken.
Daß man an einen Verwaltungsapparat, wie Ostafrika ihn heute hat, wo ein Intendant, ein Landrentmeister, ein Dutzend Zahlmeisteraspiranten, eine Anzahl Sekretäre außer den dazu kommandierten Deckoffizieren und Unteroffizieren dem Gouverneur zur Verfügung stehen, ganz andere Anforderungen stellen kann, liegt auf der Hand.
Nichtsdestoweniger wird von den Gegnern Wißmanns immer die Mangelhaftigkeit der damaligen Verwaltung gegen ihn angeführt.
Und thatsächlich ist auch an leitender Stelle dem Reichskommissar stark verübelt worden, daß sich die Intendantur nicht in ganz ordnungsgemäßen Bahnen bewegt hat.
Um von dem bedeutenden Umfange dieses Verwaltungsgeschäftes ein ungefähres Bild zu geben, mögen hier nur die wichtigsten Zweige desselben kurz erwähnt sein.
Es gehörte dahin die sehr komplizierte Soldberechnung der Truppen, welche bei dem verschiedenen Material auf ganz verschiedener Basis beruhte; die Herstellung und Instandhaltung der Mannschaftslisten, welche hier mehr denn irgend wo anders durch Krankheit, Verwundung und Tod fortwährenden Aenderungen unterworfen waren; ferner die besonders in der ersten Zeit ungemein schwierige Verpflegungsfrage.
[S. 83]
In der ersten Zeit des Aufstandes, als die indischen Kaufleute noch nicht nach Bagamoyo und den übrigen Küstenplätzen zurückgekehrt waren und zudem die Zufuhr aus dem Innern mangelte, mußte die gesamte Verpflegung für Offiziere und Mannschaften von Sansibar aus durch die Verwaltungsabteilung besorgt werden. Dieselbe hatte ferner unter sich die gesamten Ausrüstungsgegenstände der Truppe, über welche ebenfalls eine Unzahl von Zu- und Abgangslisten geführt werden mußte.
Das gesamte Kriegsmaterial, ursprünglich in Daressalam untergebracht, unterstand selbstverständlich ebenfalls der Verwaltungsabteilung. Zu Anfang mußten die Journale darüber von den Stationsoffizieren geführt werden.
Daß diese Journalisten unter diesen Verhältnissen sich nicht immer durch absolute Vollständigkeit auszeichneten, liegt in der Natur der Sache. Denn welcher der Frontoffiziere sollte von dem komplizierten Schreibmechanismus der preußischen Verwaltung so durchdrungen sein, daß er alles zur Zufriedenheit der Oberrechnungskammer erledigen könnte?
Weitere Schwierigkeiten entstanden der Verwaltung aus dem vorhandenen Dampfermaterial, welches wiederum ganz neue Kenntnisse bei den Verwaltungsbeamten voraussetzte. Die Kohlenlieferungen, die Reparaturen an den Dampfern, die An- und Abmusterung von Mannschaften — alles dies sind Verwaltungszweige, welche für sich allein schon einen geschulten Verwaltungsbeamten verlangt hätten.
Den letztgenannten Teil des Verwaltungsapparates behielt während des ersten halben Jahres des Kommissariats Eugen Wolf unter sich.
Ganz besonders anzuerkennen ist noch während der ersten Schwierigkeiten, welche sich dem Kommissariat entgegenstellten, die Hilfe der deutschen Firmen in Sansibar, besonders des Hauses Hansing u. Cie., dessen damalige Leiter Strandes, später Wegner mit ihrem kaufmännischen Rat und ihrer Kenntnis der örtlichen Verhältnisse wesentliche Dienste geleistet haben. Das Haus Hansing hatte, nebenbei bemerkt, die Hauptlieferungen für das Kommissariat übernommen und hat dieselben stets zur Zufriedenheit erledigt.
[S. 84]
Alle Anforderungen bezüglich der Verwaltung kamen selbstverständlich am letzten Ende an den Reichskommissar, der in der That durch seine ungewöhnliche Arbeitskraft und durch sein überaus bedeutendes organisatorisches Talent in der Lage war, jedesmal die wenigstens für den Augenblick richtige Entscheidung zu treffen. Erst allmählich gelang es durch Heranziehung neuen europäischen Materials und durch die richtige Verwendung der zur Verfügung stehenden Kräfte einige Ordnung in den Verwaltungsdienst zu bringen und die einzelnen Zweige desselben zu organisieren.
Das Hauptquartier selbst war während der ganzen Zeit des Aufstandes in Sansibar in drei großen Gebäuden untergebracht. Das eine derselben, in der Hauptstraße gelegen, barg die sämtlichen Bureaus, außerdem befand sich dort die Wohnung des Reichskommissars und einiger Beamten. Ein zweites Gebäude diente zu Hospitalzwecken, ein drittes lediglich zu Wohnräumen für Offiziere. Ein Teil des Unteroffizierpersonals, welches beim Hauptquartier beschäftigt wurde, mußte trotzdem noch im Hotel untergebracht werden. Für diejenigen, welche in der Zeit des Reichskommissariats nach Sansibar kamen, mußte unzweifelhaft das Hauptquartier Wißmanns als der anziehendste Punkt der ganzen Insel gelten; war doch der Verkehr im Hauptquartier sogar lebhafter als der im Sultanspalast. In der nach arabischer Art mit Steinbänken ausgestatteten Halle wimmelte es von Kawassen und Dienern oder Boten. Im Hofe, in derselben Vorhalle, nur etwas weiter nach der Rückwand des Hauses zu, stampften die Pferde des Reichskommissars. Ein fortmährendes Gehen und Kommen deutscher Unteroffiziere gab Zeugnis von der regen Thätigkeit, welche den Tag über, zum Teil aber auch bis tief in die Nacht hinein in dem Hauptquartier herrschte.
Dazwischen fielen die zuweilen wegen ihrer langen Dauer keineswegs angenehmen Besuche vornehmer Araber und reicher Inder, welche wesentlich zur Belebung des Bildes beitrugen. Alle aber wurden vom Reichskommissar in Person stets mit der gleichen Liebenswürdigkeit empfangen und ihrem persönlichen oder Volkscharakter nach durchaus richtig behandelt. Man darf behaupten, daß niemand von diesen Bittstellern[S. 85] unzufrieden aus dem Kommissariat herausgegangen ist. Eine wesentliche Stütze hatte Wißmann dabei an seinem Adjutanten Dr. Bumiller. Dieser war ursprünglich als Freiwilliger ohne irgend eine bestimmt in Aussicht genommene Verwendung nach Sansibar gegangen und wurde erst draußen von Wißmann als Lieutenant und persönlicher Adjutant in den Verband der Schutztruppe aufgenommen.
Es muß der außerordentlichen Arbeitskraft und Uneigennützigkeit Bumillers das vollste Lob gespendet werden. Wohl alle Schriftstücke von einiger Wichtigkeit sind durch seine Hände gegangen, beziehungsweise von ihm verfaßt worden. Seine sehr günstigen Privatverhältnisse setzten ihn außerdem in den Stand, in einer Weise, welche auf den ersten Blick sonderbar erscheinen konnte, dem Kommissariat Dienste zu leisten: wir meinen die äußere Ausstattung desselben und zwar besonders der Räume, welche für den offiziellen Gebrauch des Reichskommissars d. h. besonders für seinen Verkehr mit den auf Aeußerlichkeiten sehr bedachten Arabern bestimmt waren. Die kostbare Einrichtung des Salons, in welchem Wißmann die vornehmen Araber empfing, war Bumillers persönliches Eigentum und von ihm dem Kommissariat zur Verfügung gestellt worden. Schwerlich würde man in Berlin ohne weiteres begriffen haben, daß in dieser Beziehung die Aeußerlichkeiten von einer wesentlichen Wirkung sein konnten und mußten. Der Maskataraber verlangt aber, wenn er jemanden als eine besonders hervorragende Persönlichkeit anerkennen soll, daß derselbe, wenigstens in einem Verkehrscentrum wie Sansibar, durch äußeren Prunk in irgend einer Weise seine Bedeutung kundgiebt. Nach dieser Richtung hin hat Bumillers Liberalität zweifellos politische Früchte getragen, ganz abgesehen davon, daß auch dem Reichskommissar und den Offizieren der Schutztruppe an der Wahrung der äußeren Würde gelegen sein mußte.
Während ursprünglich nun die Verwaltungsgeschäfte unter der persönlichen Oberleitung Wißmanns sich in den Händen von Eberstein, Eugen Wolf und Bumiller vereinigten, wurde später eine notwendige Teilung der Geschäfte und der einzelnen Ressorts vorgenommen. Die eigentliche Verwaltung, d. h. die Verpflegungsgeschäfte, das Finanzdepartement, die Führung[S. 86] der Generallisten über Zu- und Abgang blieb unter der Leitung des Freiherrn von Eberstein im Hauptquartier. Das Kriegsmaterial dagegen wurde teils als fester Bestand auf die einzelnen Stationen verteilt und unterstand der Verwaltung der Stationschefs; teils befand es sich als Arsenal in Daressalam unter der Verwaltung des dortigen Chefs. Das Schiffsmaterial endlich war als besonderes Ressort dem Chef der neu gebildeten Seeabteilung, zuerst dem Kapitän Hansen, später dem Lieutenant zur See der Reserve von Sivers unterstellt.
Einen ganz besonders umfangreichen Zweig des Reichskommissariats bildete das von Anfang an unter eigener Verwaltung stehende Sanitätswesen. Bei Beginn der Thätigkeit des Kommissariats standen diesem zwei Ärzte vor: Stabsarzt Dr. Schmelzkopf und Assistenzarzt 1. Klasse Dr. Kohlstock. Es mag gestattet sein, an dieser Stelle noch etwas weiter zurück zu greifen und auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, welche sich schon beim Transport der Truppen für die Ärzte herausstellten. Wenn auch die erste Untersuchung in Kairo gesundes Material geliefert hatte, so zeigte sich bei der Langsamkeit des Transportes und bei dem Aufenthalt in Aden doch schon bald eine erhebliche Zahl von Erkrankungsfällen, zum Teil epidemischer Natur. In Aden brachen unter den Sudanesen die Pocken aus und griffen in erschreckender Weise um sich, so daß in Aden selbst bereits eine größere Anzahl Todesfälle eintraten, eine Reihe von Pockenkranken dort zurückgelassen werden mußte und auf dem Transport von Aden nach Sansibar in nur sieben Tagen noch 11 Personen der Krankheit zum Opfer fielen. Nur der durchgreifenden energischen Impfung des gesamten schwarzen Personals ist es zu danken, daß nicht eine vollkommene Dezimierung der Truppe eintrat.
Kaum in Sansibar angekommen, wurden an die Thätigkeit der Ärzte die außerordentlichsten Anforderungen gestellt. Die Einrichtung des Hospitals in Sansibar, die erste Hilfe in den Gefechten, die Überführung der Verwundeten und Kranken von der Küste nach Sansibar hinüber — alles das waren Ausgaben, welche an die Hingebung beider Ärzte mehr als gewöhnliche Anforderungen stellten. Daneben ließ ihr[S. 87] Kriegseifer sie auch noch als Truppenführer in den Gefechten aktive Dienste thun. Die einzige Unterstützung für die Ärzte bildeten vier Lazarettgehülfen — bei einer Truppe von mehr als 1000 Mann, zu denen die Familien der Sudanesen hinzukamen, eine verschwindende Anzahl! Eine Entlastung trat erst dann ein, als durch die Thätigkeit des deutschen Frauen-Vereins einige in der Krankenpflege ausgebildete Schwestern gesandt wurden, die im Haupthospital in Sansibar, sowie in dem bereits im Mai in Bagamoyo bei der dringenden Not errichteten Hospital Verwendung fanden. Leider hatte die Schutztruppe schon bald den Tod ihres ersten Chefsarztes, des Dr. Schmelzkopf zu beklagen.
Als dieser mit Wißmann von den Operationen bei Pangani und Tanga zurückkehrte und auf dem Wege nach Daressalam war, welches er behufs sanitärer Einrichtungen inspizieren wollte, ertrank er im Meere bei dem Versuche Hilfe zu leisten. Der Hergang war etwa folgender:
Die »München«, welche eines Tages früh mit Wißmann und Schmelzkopf an Bord Sansibar verlassen hatte, konnte im Laufe des Tages wegen des hohen Seegangs den Hafen von Daressalam nicht mehr erreichen und war genötigt bei einer kleinen, der Rhede dieses Platzes vorgelagerten Insel Anker zu werfen. Wißmann ging mit einem Beamten der Ostafrikanischen Gesellschaft, Heinz, der nach Daressalam versetzt worden war, ans Land; doch nur mit Mühe gelang es ihnen, in dem kleinen schadhaften Boote bei dem schweren Seegange glücklich die Insel zu erreichen. Dadurch war jedoch, wie man von Bord aus erkennen konnte, das Boot so leck geworden, daß Wißmann an der Rückkehr verhindert war. Als diese auch bis zum nächsten Morgen nicht erfolgte und die an Bord gebliebenen Herren Besorgnisse zu hegen anfingen, machte Schmelzkopf, der ein vorzüglicher Schwimmer war, den Versuch, mit einigen Stärkungsmitteln in Flaschen und einem Päckchen kleiner Nägel zum Kalfatern des Bootes um den Hals, schwimmend ans Land zu kommen, um Wißmann Hilfe zu bringen. Er wurde noch einige Zeit vom Schiffe aus beobachtet, kam dann aber plötzlich außer Sicht. Wißmann und Heinz hatten inzwischen mit ihren eigenen Kleidungsstücken[S. 88] und den Lappen der Neger, so gut es eben gehen wollte, das Boot kalfatert und kamen mit Mühe und Not glücklich an Bord zurück. Schon vom Lande aus hatten sie die »München« hin- und herfahren sehen und geahnt, daß etwas vorgefallen sei. An Bord angekommen, erfuhren sie von dem Wagnis Schmelzkopfs, der zweifellos seiner kameradschaftlichen Opferwilligkeit zum Opfer gefallen war. Wahrscheinlich ist es, daß er entweder in den Fluten von einem Herzschlag getroffen oder von einem Hai, die ja in jenen Gewässern sehr zahlreich sind, in die Tiefe gezogen wurde. Nach zwei Stunden vergeblichen Suchens fuhr die »München«, die Flagge halb Mast, weiter nach Daressalam. Durch den Tod dieses allgemein beliebten Mannes, der nicht nur als stets hilfsbereiter Arzt, sondern auch gerade in seiner Eigenschaft als ältester Kamerad nächst Wißmann einen segensreichen Einfluß in der Truppe ausgeübt hatte, wurden wir alle in tiefe Trauer versetzt. Die bei den Fischern, welche mit ihren kleinen Böten jene Gegend befuhren, eingezogenen Erkundigungen blieben gänzlich resultatlos. Das ein Jahr später der Unglücksstelle gegenüber Dr. Schmelzkopf gesetzte Denkmal erzählt auch den Späteren, die ihn nicht gekannt, von der Berufstreue und Opferwilligkeit des ersten Chefarztes der Schutztruppe.
An seine Stelle trat Dr. Kohlstock[2], der nun allein mit gleicher Gewissenhaftigkeit die gesamte ärztliche Thätigkeit in seine Hand nahm, bis er später durch die Sendung dreier Militärärzte die nötige Unterstützung erhielt. Obwohl die Ärzte zu jener Zeit durch ihren Beruf schon mehr als genug in Anspruch genommen waren, mußten sie doch bei dem großen Mangel an Europäern, wie erwähnt, noch Dienste als Offiziere verrichten. Schmelzkopf, Kohlstock, Stabsarzt Dr. Becker, Dr. Gärtner und Dr. Brehme haben alle neben ihrer Thätigkeit als Ärzte Truppen gedrillt, ja sogar teilweise die Führung von Kompagnien übernommen und auch an den Gefechten in anerkennenswerter Weise Anteil genommen. Heutigen Tages ist die Zahl der Ärzte sowohl wie der Abgesandten des[S. 89] deutschen Frauenvereins stark vermehrt worden. Wir können dem Frauenverein für seine Opferwilligkeit nicht dankbar genug sein.
Im Voraus sei erwähnt, daß, um die Schwierigkeiten des Transportes zu vermeiden, später zu den Hospitälern in Sansibar und Bagamoyo noch ein drittes in Pangani gefügt werden mußte. Während nach der wegen schwerer Malaria nothwendig gewordenen Heimreise des Dr. Kohlstock der Stabsarzt Dr. Becker in Sansibar selbst als Chefarzt fungierte und von hier aus die beiden andern Hospitäler oder sonstige auf den Stationen befindliche Krankenhäuser besuchte, unterstand das Hospital in Bagamoyo während des Feldzuges im Norden dem Dr. Brehme und das Hospital in Pangani dem Dr. Gärtner.
Die Gestaltung der Truppe hatte während der ersten Monate des Kommissariats eine durchgreifende Veränderung erfahren und bot sie jetzt einen ganz andern militärischen Anblick als zuvor. Bei der außerordentlichen Kürze der Zeit, welche dem Reichskommissar in Berlin und Kairo zur Verfügung gestanden hatte, war es ganz unmöglich gewesen, die Truppen in geeigneter Weise einzukleiden und einzuexerzieren. Bei der Ankunft in Sansibar und während der ersten Gefechte um Bagamoyo trugen die Truppen die fabelhaftesten, aus Kairo mitgebrachten Kostüme. Es sah nichts weniger als kriegerisch aus, wenn der eine im Kaftan, ein andrer im Araberhemd, wieder ein andrer mit Resten ehemaliger europäischer Kleidung behängt Frontdienste that. Aber die Not zwang zu schnellem Vorgehen und ließ uns alle anderen Rücksichten außer Acht setzen. Es ist ja auch das außerordentlich schnelle Eingreifen einer erheblichen deutschen Macht sowohl auf Eingeborene wie auf Araber und Inder von durchschlagender Wirkung gewesen.
Bereits früher ist kurz auf die erste Ausbildung der Sudanesen in Kairo und Aden hingewiesen worden. Während in der ersten Zeit die egyptischen Kommandos gebraucht und infolgedessen die direkten Befehle durch die farbigen Offiziere den Truppen übermittelt wurden, stellte sich bald die Notwendigkeit heraus, das deutsche Kommando allgemein durchzuführen, weil ja selbstverständlich dadurch die Wirkung des[S. 90] Führers auf die Truppe ungleich gesteigert und dieselbe eher zu einem direkten Werkzeug des Führers gemacht wurde. Während ferner anfänglich lediglich Gewicht auf den Gefechtsdienst gelegt ward und eigentlich den ersten Truppen weiter nichts beigebracht worden war, als das Draufgehen im Sturmschritt, trat jetzt, als etwas größere Ruhe sich einstellte, eine wesentliche Ausdehnung des Dienstes ein. Es wurden die Truppen erst zu solchen gemacht. Als Uniform war für die Sudanesen im großen und ganzen die egyptische beibehalten worden: ein Anzug aus sogenanntem Kaki, einer sandfarbenen Leinewand, welche mit großer Haltbarkeit den Vorteil vereinigte, daß sie nicht so leicht unansehnlich wurde. Der Form nach bestand und besteht der Anzug auch heute noch in einer Art Jaquet mit Achselklappen ohne besonderes Abzeichen auf denselben, einer bis zur halben Wade reichenden Hose, welche später nach unserem militärischen Schnitt umgeformt worden ist, einer Beinbinde aus dunkelblauem dünnen Stoff, welche vom Fuß an aufwärts bis zum Knie in eng übereinander liegenden Touren spiralförmig gewickelt wurde und derben Lederschuhen. Die letzteren waren in Deutschland angefertigt worden, doch zeigte sich leider bei der ganzen ersten Sendung, daß die deutschen Schuhmacher keineswegs mit Negerfüßen zu rechnen verstanden. Die Schuhe waren alle viel zu klein und in der Form des Schnittes durchaus ungeeignet. Erst später konnte hier Abhilfe geschaffen werden. Zur Kopfbedeckung wurde ursprünglich der leichten Beschaffung wegen der Fez gewählt, doch wurde derselbe später durch den ungleich kleidsameren und praktischeren Turban ersetzt.
Die Bewaffnung bildete bei den schwarzen Truppen durchgängig das Mausergewehr Konstruktion 71, ein Infanterie-Seitengewehr[3] und zwei vordere und eine hintere Patronentasche. Außerdem führte jeder Soldat als Gepäck einen Tornister aus braunem Segeltuch, ebenso Brotbeutel und eine dünne Decke, welche, mantelähnlich znsammengerollt, auf der Brust getragen wurde.
[S. 91]
Die Schutztruppe, welche ursprünglich in Kompagnien eingeteilt war, verteilte sich teils auf die einzelnen Stationen als ständige Besatzung, teils bildete sie ein je nach Bedürfnis und Stärke wechselndes, zuweilen aus den Besatzungen heraus ergänztes Expeditionskorps, so daß von eigentlichen Kompagnieverbänden nicht recht die Rede sein konnte. Besondere Schwierigkeiten bei der Rangierung der einzelnen Glieder unter die Vorgesetzten machten und machen auch heut noch die schwarzen Chargen. Es giebt deren bei den Sudanesenkompagnien mehr als zehn. Sie lassen sich schwer rücksichtlich ihres eigentlichen Dienstbereichs klassifizieren. Der Verfasser hat später eine feste Einteilung der schwarzen Chargen in den ihm unterstehenden Kompagnien vorgenommen. Doch blieb dieser Versuch durch den fortwährenden, durch die Notwendigkeit bedingten Wechsel der Offiziere resultatlos: die Schwarzen rückten immer wieder in ihre zum Teil nur eingebildeten Rechte ein. Im großen und ganzen kann man bei den Sudanesentruppen folgende Chargen unterscheiden: Die unterste Charge bilden die Ombaschi, Gefreite, welche nach egyptischem Brauch als Schließende hinter der Front aufgestellt sind, bei uns jedoch wegen ihrer großen Anzahl in Reih und Glied mit eintreten mußten. Beim Arbeitsdienst indes dienten sie als Aufseher, beim Wachtdienst, in welchem wir es für praktisch befunden haben, die egyptischen Formen in den meisten Punkten beizubehalten, wurde der Ombaschi nur als aufführender Gefreiter verwandt. Die nächsten Chargen bilden die Schausche, Unteroffiziere, die im innern Dienst Korporalschaftsführer sind. Es folgen dann die Betschausche, Sergeanten, von denen der Regel nach jedem Zuge je einer zugeteilt ist. Den Dienst als Zugführer — die Kompagnie soll in der Regel in 3 Züge eingeteilt werden — versehen im inneren Dienst die farbigen Offiziere resp. Sols, welche letzteren nur im Feldwebelrang stehen. Der Grund, daß dieselben Funktionen von verschiedenen Chargen ausgeführt wurden, lag darin, daß nach egyptischem Brauch entweder nur durch ihre Erziehung wissenschaftlich vorgebildete Leute, welche die egyptischen militärischen Institute besucht hatten, zu Offizieren befördert wurden, oder auch solche, welche durch eine langjährige Dienstzeit oder durch besondere Auszeichnung[S. 92] sich ein Anrecht auf die Beförderung zum Offizier erworben hatten.
Von uns wurde dahin gestrebt, die Zahl der farbigen Offiziere auf einen zu reduzieren, da der Exerzierdienst, wenn nicht die Leistungsfähigkeit der Kompagnie darunter leiden soll, entschieden durch Europäer versehen werden muß. Dieser eine war besonders als Vertrauens- und Mittelsperson zwischen dem Kompagnieführer und den farbigen Soldaten von Wichtigkeit.
Die Chargen-Abzeichen bestanden bei den Unteroffizieren in nach oben geöffneten Tuchwinkeln auf dem linken Oberarm, von denen der Ombaschi einen, der Schausch zwei, der Betschausch drei und der Sol vier trug.
Schließlich ist auch noch das Amt des Bullogamin (Kompagnieschreiber) zu erwähnen, obgleich wir absichtlich diese Stellung, so weit es möglich war, eingehen ließen. Die Inhaber derselben waren meist so faul, daß sie öfters nach Egypten zurückgeschickt werden mußten. Die schriftlichen Geschäfte der Kompagnie wurden natürlich von den deutschen Offizieren resp. Unteroffizieren übernommen. Der Bullogamin gehörte im übrigen zur Charge der Betschausche. Die hohe egyptische Charge des Wekil-Ombaschi, des stellvertretenden Gefreiten, ist, da sie von uns abgeschafft wurde, bei dieser Chargenaufzählung nicht berücksichtigt.
An farbigen Offizieren hatten wir in der Schutztruppe Hauptleute, Premierlieutenants und Sekondelieutenants. Von diesen wurden die für den Zweck brauchbarsten Lieutenants vorläufig im Frontdienst beibehalten; aus den übrigen machte man Polizeichefs, eine Stellung, in welcher sie sich im Allgemeinen recht gut bewährt haben.
An weißen Chargen gab es in der Schutztruppe Offiziere vom Hauptmann bis zum Sekondelieutenant, welche jedoch, da sie aus der Armee ausgetreten und in Wißmanns Privatdienst übergetreten waren, hier nicht nach ihrer in der Armee erworbenen Charge rangierten, sondern nach einer eigenen Anciennität in der Schutztruppe.
Es setzte sich das Offizierkorps zusammen aus dem Kommandanten Major v. Wißmann, den Chefs und den Lieutenants. Die Uniform der Offiziere bestand in der ersten[S. 93] Zeit aus weißen Baumwollanzügen, Jaquet und Hose, mit Metallknöpfen und Achselstücken und einem Tropenhelm. Als Rangabzeichen dienten außer den betreffenden Achselstücken um die Ärmel genähte Goldborten, von denen die oberste eine runde Schleife zeigte; beim Kommandanten waren es deren vier, bei den Chefs drei, bei den übrigen Offizieren zwei. Für Paradezwecke oder sonstige feierliche Gelegenheiten war ursprünglich eine Uniform von dunkelblauer Serge hergestellt worden, von demselben Schnitt wie die weiße und mit denselben Abzeichen. Diese blaue Uniform bewährte sich aber gar nicht und ist nur in sehr seltenen Fällen angelegt worden. Als Seitengewehr diente der frühere Infanterie-Campagne-Säbel mit Kavallerie-Portepee, als Schärpe die Marineschärpe mit der Kaiserkrone.
Die Uniform der Unteroffiziere war im Schnitt dieselbe wie die der Offiziere. Sie bestand aus grauem, festem Baumwollstoff; das Abzeichen bildete eine gelbe Wollenborte mit Schleife an den Ärmeln. An Waffen trugen sie Repetiergewehr, Infanterie-Seitengewehr und Revolver. Als Fußbekleidung kamen sehr bald die für die Küste außerordentlich praktischen und auch haltbaren Schuhe aus Segeltuch auf, welche leicht sauber gehalten werden können, im Inneren natürlich Lederschuhe bezw. Stiefel.
Sobald die Verhältnisse es erlaubten, wurde zu einer systematischen Ausbildung der Truppe geschritten, und zwar in der Weise, daß dabei lediglich auf die praktischen Zwecke Gewicht gelegt wurde. Der gesamte Exerzierdienst zielte darauf ab, die Truppe zu einem geschlossenen Ganzen zu machen und in die Hand des Führers zu bringen. Infolgedessen fiel natürlich das eigentliche Garnisonsexerzieren mit seiner Krone, dem Parademarsch, so gut wie gänzlich weg, und an seine Stelle trat die desto eifrigere Übung des eigentlichen Gefechtsexerzierens.
Die Ausbildung der einzelnen Züge geschah unter den weißen Unteroffizieren, die Zusammenfassung der Züge in Kompagnieverbände unter den Offizieren, die der einzelnen Kompagnien endlich unter dem Hauptführer. Der Lage der Sache nach fiel die letztere Stellung je nach Bedarf entweder[S. 94] dem Stationschef oder dem Führer des Expeditionskorps zu. Die allergrößten Verdienste erwarb sich bei der Aufgabe, die Truppen einzuexerzieren und zu einem schlagfertigen Ganzen zu gestalten, nicht bloß bei dem ersten Kontingent, sondern auch bei dem später zu erwähnenden Nachschub Chef v. Zelewski. Mit unermüdlicher Ausdauer und ungemein großer Hingebung an die Sache verband er das größte Wohlwollen für alle seine Untergebenen. Er kannte die meisten Soldaten der Schutztruppe persönlich und war überall gleich beliebt.
Wenn nun aber der eigentliche Exerzierdienst und die Ausbildung der Leute zur Gefechtsschlagfertigkeit verhältnismäßig wenig Mühe machte, wenigstens nach Überwindung der ersten sprachlichen Schwierigkeiten, besonders nach Einführung des deutschen Kommandos, welches von den Sudanesen in überraschend kurzer Zeit begriffen und von den schwarzen Chargen sofort richtig angewendet wurde, — kamen doch die Sudanesen aus der egyptischen Armee und brauchten sich nur einem neuen Modus anzupassen —, so waren dafür die Schwierigkeiten bei den Schießübungen desto größer. Trotz der ausgedehnten Bemühungen seitens der Offiziere und Unteroffiziere sind wirklich gute Schießresultate nicht erzielt worden. Im Gefecht selbst schossen die Sudanesen, besonders in der ersten Zeit, blind darauf los, und es war ganz unmöglich, sie hier in den nötigen Schranken zu halten. So kam man bald dahin, ihnen das Einzelschießen im Gefecht vollständig zu untersagen: es durften nur noch Salven auf Kommando abgegeben werden. Der so erzielte Erfolg war durchaus genügend, und vor allen Dingen lernten sie auf diese Weise größere Besonnenheit und Kaltblütigkeit beim Gebrauch der Schußwaffe.
Noch größer als bei den Sudanesen waren die anfänglichen Schwierigkeiten bei den Zulus. Regulärer Kriegsdienst war ihnen gänzlich fremd. Die Bekleidung mit einer Uniform schien ihnen zum mindesten gänzlich überflüssig; die meisten hatten nicht einmal vom Gebrauch der einzelnen Kleidungsstücke einen Begriff und mußten erst dazu erzogen werden. Schuhwerk zeigte sich bei ihnen als gänzlich unangebracht. Ihre Uniform unterschied sich ursprünglich wesentlich von der[S. 95] der Sudanesen, später jedoch wurde dieselbe Uniform bei der gesamten Schutztruppe eingeführt.
Von Natur intelligent, begriffen die Zulus jedoch sehr bald den Wert der Disziplin, besonders nachdem ihnen in einigen Fällen die Notwendigkeit derselben handgreiflich vor Augen geführt worden war. Daß es nicht immer ganz glatt dabei abging, mag besonders ein Fall beleuchten, wo ein Zulu sich thätlich an seinem weißen Vorgesetzten vergriff. Nach Kriegsrecht wäre der Mann ja zweifellos mit dem Tode zu bestrafen gewesen. Der betreffende Stationschef jedoch ließ, und zwar besonders um den Geist der Leute zu prüfen, durch seine Kameraden über ihn aburteilen — und siehe da: — ihr Urteil lautete fast einstimmig auf Tod. Der Mann wurde jedoch zu Stockschlägen begnadigt. Da baten seine Kameraden durch eine Deputation um die Erlaubnis, das Urteil selbst vollstrecken, besonders aber auch die Zahl der Schläge bemessen zu dürfen. Mit Rücksicht auf den zu erhaltenden Geist in der Kompagnie wurde ihnen dieser Wunsch zugestanden. Der Delinquent erhielt nicht weniger als 150 Schläge mit dem Kiboko, der Flußpferdpeitsche und wurde dann, obwohl der Arzt keine erhebliche Beschleunigung des Pulses, noch auch sonstige bedenkliche Symptome zu erkennen vermochte, begnadigt, wie es schien — zur Unzufriedenheit seiner Genossen. 8 Tage darauf that er schon wieder Dienst und hat seitdem nie mehr zu irgend welchen Klagen Anlaß gegeben.
Der schwierigste Teil in der Ausbildung der Zulus war in weit höherem Maße noch als bei den Sudanesen das Schießen. Die Leute kannten zum bei weitem größten Teil gar keine Hinterlader; viele hatten nie ein Gewehr in der Hand gehabt und setzten infolgedessen ein recht geringes Vertrauen in die Waffe. Um so größer war ihr Vertrauen zur Führung, und zwar schon in den ersten Gefechten.
Mit Bravour stürzten sich die Zulus auf den Feind und ließen ihrer natürlichen, ungebändigten Wildheit die Zügel schießen, so daß es anfänglich nur sehr schwer gelang, sie vom Kopfabschneiden der Gefallenen und Verwundeten, und von sonstigen bestialischen Verstümmelungen der Feinde, wie sie bei[S. 96] ihnen üblich sind, zurückzuhalten. Wir werden an manchen Stellen Beispiele hiervon finden.
Ein in der ersten Zeit der Ausbildung gemachter Versuch, die einzelnen Kompagnien aus Sudanesen und Zulus zu mischen, mißlang vollständig. Der Nationalcharakter beider Völker ist durchaus von einander verschieden und die Denk- und Anschauungsweise beider weicht so weit von einander ab, daß ein Zusammenwirken oder auch nur ein kameradschaftliches Zusammenleben sich als unmöglich erwies. Fortwährende Prügeleien machten dem Versuche bald ein Ende.
Wir haben noch einen Blick auf das Verhältnis zu werfen, welches zwischen den einzelnen deutschen Behörden in Ostafrika bestand. Diese Behörden waren der Reichskommissar, der Geschwaderchef (zuerst Admiral Deinhard, später Kapitän Valette), der Generalkonsul und die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. Nur zu häufig begegnet man der Anschauung, als ob durch die Übertragung des Reichskommissariats an Wißmann nunmehr alle diese Behörden in einer Hand vereinigt gewesen seien und als ob der Reichskommissar jedenfalls die oberste Behörde gewesen sei. Das ist aber durchaus niemals der Fall gewesen. Wenn der Reichskommissar die Mitwirkung der Marine in irgend einer Beziehung, sei es zur Landung von Truppen oder zur Beschießung eines Platzes oder auch nur zur Beobachtung eines solchen wünschte, wenn er die Marinekutter oder Dampfpinassen für den Dienst des Reichskommissariats benötigte, so war er keineswegs in der Lage, einfach seine Requisition zu machen, sondern er hatte in jedem Falle den Admiral um seine Mitwirkung zu bitten; und wenn dieselbe auch in den meisten Fällen anstandslos und sofort geschah, so blieb der Geschwaderchef doch immer eine vom Reichskommissar gänzlich unabhängige, in seinen Entschließungen durchaus freie Behörde. Dasselbe war in politischer Beziehung mit dem Generalkonsul Dr. Michahelles der Fall. Wenn irgend welche Anträge an den Sultan als Souverän der Küste und Sansibars zu stellen waren, wenn die Mitwirkung des Sultans in irgend einer Sache erwünscht oder nötig schien, wenn endlich bei der durchaus zweifelhaften Rolle, welche der Sultan in dem ganzen Aufstande spielte, — man wußte nie[S. 97] recht, ob die Araber der Küste nicht mit seinem Gelde und jedenfalls mit seiner Autorisation fochten, — es angebracht erschien, ihm seine Stellung zu den Deutschen gebührend vor Augen zu führen, so mußten solche politischen Verhandlungen regelmäßig unter Mitwirkung, zum Teil sogar unter Genehmigung des Generalkonsuls vorgenommen werden. Das Verhältnis ist nicht immer ein günstiges gewesen. Wenn man dem Generalkonsul auch keinen Vorwurf aus seiner Vorsicht machen kann, die ihm durch die Rücksicht auf die andern in Sansibar beteiligten Mächte geboten erschien, so sind doch zum Teil erhebliche Mißhelligkeiten nicht ausgeblieben. Jedenfalls wurde die Thätigkeit des Reichskommissars dadurch erschwert, daß zwei vollkommen selbständige Behörden neben ihm bestanden, deren einzelne Funktionen in die Aufgabe Wißmanns hineingriffen. Der Generalkonsul blieb immer die oberste politische Behörde in Sansibar. Audienzen beim Sultan, der Schriftverkehr des Kommissariats mit dem Sultanspalast mußten sich durch das Generalkonsulat hindurchbewegen.
Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, welche oben unter den selbständigen Behörden mitgenannt war, ist die einzige gewesen, welche vom Reichskommissar von vornherein abhängig war. Die ganze Küste stand ja unter dem direkten und unmittelbaren Befehl Wißmanns, und hier hatte sich die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft aller ihrer Rechte begeben, sogar ihre Stationen dem Reichskommissariat untergeordnet und durch besonderen Vertrag mit Wißmann einen Teil ihrer Beamten zur Verfügung gestellt. In Sansibar selbst mußte sie natürlich auf Grund des eben erst abgeschlossenen Küstenvertrages ihre Autorität behalten.
Hier wirkte als Generalvertreter nach Herrn Vohsen Herr von Saint-Paul-Illaire mit einem Beamtenstabe, welcher lediglich zur Erhebung der Ausfuhrzölle vom Festland Verwendung fand. Das Verhältnis der Vertreter der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zum Reichskommissariat ist im großen und ganzen ein gutes gewesen. Die Wünsche der Gesellschaft, der es ja natürlich darauf ankam, so schnell als möglich wieder Fuß zu fassen, wurden vom Kommandanten und den Offizieren in jeder Weise berücksichtigt.
[S. 98]
Zum Kapitel von der Ausbildung des Kommissariats gehört schließlich noch der regelmäßige Dampferverkehr, welcher von Sansibar aus durch die Flotte des Kommissariats mit der Küste unterhalten wurde. Die Aufgaben, welche dabei der Flottille zufielen, waren einmal die Versorgung der Stationen mit europäischen Bedürfnissen, dann der Depeschenverkehr und endlich die Besorgung der Post, welche zum erstenmal durch das Reichskommissariat auf dem Dampferwege an der Küste eingeführt wurde.
Diese Post besorgte die Briefe für die Truppe, später auch für die Beamten der Gesellschaft; ja, auch die Araber- und Inderpost wurde durch das Reichskommissariat erledigt. Im Hauptquartier in Sansibar befand sich die Annahme. Dort wurden die Postbeutel für die einzelnen Stationen fertig gestellt und versiegelt durch die Dampfer des Kommissariats befördert, sehr zur Freude besonders des kaufmännischen Teils der Küstenbevölkerung, die zum erstenmal eine regelmäßige Briefbeförderung erlebte.
[S. 99]
[2] In Ostafrika und tropischen Malariagegenden sich Aufhaltenden, besonders neu dahin herausgehenden sei empfohlen: »Ärztlicher Ratgeber für Ostafrika und tropische Malariagegenden« von Stabsarzt Dr. Kohlstock.
[3] Später wurden die Truppen durchgehends mit dem neuesten Seitengewehr ausgerüstet.
Buschiris Rückzug nach dem Innern. — Sein Angriff auf die Station Mpapua der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. — Die Station wird von den Beamten aufgegeben. — Zusammensetzung des Expeditionskorps Wißmanns. — Mitnahme einer Waniamuesi-Karawane. — Teilung der Expedition. — Marsch des Verfassers auf der großen Karawanenstraße. — Kämpfe Wißmanns gegen die vereinigten Bagamoyo-Jumbes bei Pangiri. — Wiedervereinigung der beiden Korps in Msua. — Verhalten der Bevölkerung gegenüber der Expedition. — Wißmanns Verhandlungen mit der Bevölkerung. — Der Häuptling Kingo von Morogro. — Marschtempo und Lageranlage. — Gefecht des Verfassers gegen die Bagamoyo-Jumbes bei Somwi und Zersprengung der Rebellen. — Friedlicher Marsch bis Mpapua. — Wahehe und Massai. — Ankunft in Mpapua. — Stationsbau daselbst. — Verhandlungen mit dem Häuptling Kipangiro. — Wißmanns Abmarsch zur Küste.
Wenden wir uns nun wieder zu Buschiri. Dieser hatte sich nach seinen Niederlagen bei Bagamoyo in der ersten Hälfte des Mai ins Innere begeben, um den einzigen Platz, welchen die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft noch dort besaß, Mpapua, in seine Gewalt zu bringen.
Jene Gegend war bis dahin so ziemlich vom Aufstande verschont geblieben und nur die Kunde davon von der Küste zu den Beamten der Gesellschaft gedrungen. Von Seiten der Gesellschaftsvertretung war dem Stationschef von Mpapua, Lieutenant Giese und dem dortigen Beamten Nielsen der Rat erteilt worden, den Versuch zu machen, auf dem Wege durch das Massai-Land nach der Küste zu dringen.
Die Herren arbeiteten indes weiter an dem Ausbau der Station, allerdings in recht unpraktischer Weise, wie sich später zeigte, und glaubten sich in jener, wie gesagt, bis dahin ruhigen[S. 100] Gegend halten zu können, bis von der Küste Hilfe käme; um so mehr, als sie eine ganze Anzahl Suaheli-Askaris angeworben und ausgebildet hatten.
Als nun Nachrichten über einen Anschlag Buschiris nach Mpapua gelangten, versäumten sowohl Giese, teils weil er diesen Gerüchten nicht recht glaubte, teils auch, weil er am Fieber und Dyssenterie schwer darniederlag, wie auch Nielsen, die nötigen Vorsichtsmaßregeln zu treffen. So gelang es denn einem Teil der Leute Buschiris bei Nacht sich in die Station einzuschleichen. Nielsen wurde ermordet, Giese, der im Schlafe von den Aufständischen überrascht wurde, griff zwar zum Gewehr, als dieses jedoch versagte, sprang er zum Fenster hinaus und kam im Nachtgewande, alles verloren glaubend, zu einem ihm ergebenen Häuptlinge. Die Station war aber gar nicht verloren, auch waren die Suaheli-Askari nicht entflohen, sondern hatten so tapferen Widerstand geleistet, daß die Rebellen wieder von Mpapua abzogen.
Die Leute Gieses verblieben noch einige Zeit daselbst, zerstreuten sich aber, als ihr Führer nicht zu ihnen zurückkehrte. Einige von ihnen fanden sich zu Giese, der bald von seiner Krankheit soweit hergestellt war, daß er in Begleitung zweier Soldaten auf dem von seinen Askaris Buschiri abgenommenen Esel in Nachtmärschen nach der Küste reisen konnte. Buschiri kehrte, als der Ort schon von Soldaten ganz verlassen war, noch einmal dahin zurück und zerstörte und plünderte die Station, wie auch die Gebäude und die Kirche der englischen Mission zu Mpapua; die 2-1/2 Stunden entfernte englische Missionsstation Kisogue blieb verschont.
Das auf der Station befindliche 4,7 cm Geschütz hatte der Wagogo-Häuptling Kipangiro vor dem Rebellenführer gerettet und mit der dazu gehörigen Munition in seine Tembe (befestigte Niederlassung) geschafft, um es später den Deutschen auszuliefern.
So stellt sich die Sache dar nach den übereinstimmenden Aussagen der Soldaten der Besatzung und der englischen Missionare von Kisogue. Der Bericht Gieses widerspricht dem in einigen Punkten, indes ist es wahrscheinlich, daß der durch seine Krankheit schwer Mitgenommene den Vorgang nicht so[S. 101] klar überschaut hat, wie er es bei vollkommener Gesundheit gethan hätte. Zweierlei steht jedenfalls unleugbar fest, daß Vorsichtsmaßregeln so gut wie gar nicht getroffen waren, und daß die Besatzung, obwohl ihr Führer alles verloren glaubte, noch einige Tage nach dem Abzug Buschiris sich in Mpapua gehalten hat.
Die über die Vorfälle in Mpapua an die Küste gedrungenen Gerüchte, welche durch den persönlichen Bericht des Lieutenants Giese teils bestätigt, teils erweitert wurden, sowie die Nachricht, daß Buschiri unter den Wahehe und Mafiti Anwerbungen mache, um gegen uns zu ziehen, veranlaßten den Reichskommissar nunmehr eine Expedition nach dem Innern vorzubereiten. Lag doch die Gefahr vor, daß Buschiri jetzt, wo die deutschen Interessen im Innern nicht mehr genügend geschützt werden konnten, gegen die Stationen der englischen und französischen Mission vorgehen und die große Karawanenstraße weiterhin beunruhigen werde.
Hatte Buschiri doch schon den wenn auch vergeblichen Versuch gemacht, eine vor kurzem in Bagamoyo unter der Führung des bekannten Karawanenführers Tscherekesa angelangte Karawane, welche eine große Rindviehherde, Kleinvieh und Elfenbein mit sich führte, auf ihrem Marsche ihrer Habe zu berauben.
Für Wißmanns Absicht traf es sich günstig, daß Lieutenant Ramsay, der zur abermaligen Anwerbung von Zulus abgeschickt war, gerade mit 300 Neuangeworbenen in Bagamoyo angekommen war, die nun eifrig einexerziert wurden und zur Teilnahme an der Expedition herangezogen werden konnten.
Dem Reichskommissar war es klar, daß, wenn sich die Nachricht von den Anwerbungen Buschiris bei den Wahehes und Mafitis bewahrheitete, nach seinem Abrücken mit einer größeren Truppenmacht ein Erscheinen der Rebellen an der Küste mit den alten Anhängern und den neuen Kräften mindestens wahrscheinlich sei. Nichtsdestoweniger schien es Wißmann von der größten Wichtigkeit, die Expedition selbst ins Innere zu führen, um sich persönlich über die Absichten und die Stimmung der Eingeborenen und ihr Verhalten zu den Deutschen und Buschiri zu unterrichten. Die bisher nur in sehr unsicherer[S. 102] Form zu ihm gedrungenen Gerüchte ließen es nötig erscheinen, daß der Kommissar auf Grund eigener Wahrnehmungen seine Maßnahmen träfe. Er trug jedoch Bedacht, daß sein Stellvertreter an der Küste, Freiherr von Gravenreuth, nicht nur eine zur Sicherung der Stationen erforderliche Truppenzahl zur Verfügung behielt, sondern auch gegebenen Falls ein Expeditionskorps bis zur Stärke von 200 Mann formieren konnte, ohne daß deshalb die Stationen entblößt werden mußten. Hierzu kam noch, daß an der Küste selbst ja im äußersten Falle die Kriegsschiffe helfend eingreifen konnten.
Das Korps, welches der Reichskommissar mit sich nahm, bestand aus 3 Kompagnien, (1 Sudanesen- und 2 Zulukompagnien), einer Askaritruppe und der Artillerieabteilung (1 Maxim-Gun und ein 4,7 cm Geschütz); im ganzen waren es 25 Europäer und 550 Mann.
Die Führung des ganzen Expeditionskorps hatte Chef von Zelewski, der Sudanesen Lieutenant End, der Zulus Lieutenant Ramsay und von Medem, der Artillerie Lieutenant Böhlau, der Askaris Deckoffizier Illich. Ferner nahmen Teil Dr. Bumiller als Adjutant des Reichskommissars, und als Gast Wißmanns Herr Otto Ehlers, bekannt durch seine Reise nach dem Kilimandscharo und als Führer der vom Dschaggahäuptling Mandara an Se. Majestät den deutschen Kaiser geschickten Gesandtschaft.
Verfasser selbst hatte in der ersten Zeit die Waniamuesi-Karawane mit einem Teile der Soldaten zu führen. Es erschien wohl möglich, daß diese Karawane unterwegs von Buschiri angegriffen würde. Die Söhne Uniamuesis waren wegen der uns geleisteten Dienste den Rebellen verhaßt und sie führten große Reichtümer mit sich.
Die Fürsorge für die Träger und die Lasten, wie das ganze Verpflegungswesen war Lieutenant Blümcke übertragen. Die Trägerkolonne bestand, da wir uns nur auf die Mitnahme des Proviants und der notwendigsten Tauschartikel und Geschenke beschränkten, trotz der großen Anzahl von Europäern und Truppen, aus nur 100 Mann, meist Leute von der Küste nebst einer Anzahl Wassukuma aus der oben bereits erwähnten Karawane, deren Zutrauen wir uns so schnell zu verschaffen[S. 103] gewußt hatten, daß sich ein Teil von ihnen willig zu Trägern für uns hergab.
Da vor dem Aufbruch der Expedition gemeldet wurde, daß etwas seitlich von der Karawanenstraße bei Pangiri sich ein Rebellenlager befinde, wohin sich die vereinigten Jumbes von Bagamoyo gezogen haben sollten, beschloß Wißmann zunächst dorthin zu marschieren und die Aufständischen zu vertreiben. Wie erwähnt, gab er dem Verfasser den Auftrag am Tage nach seinem Abmarsch mit der ganzen Waniamuesi-Karawane und den Trägern auf der großen Karawanenstraße vorzugehen, bis er wieder zum Gros stieße, was spätestens in Gerengere der Fall sein würde.
In Gemäßheit dieses Befehls setzten wir am ersten Marschtage in Böten über den Kingani, woselbst Lieutenant Sulzer einen befestigten Posten kommandierte. Daß die Karawane nur außerordentlich langsam vorwärts kam, ist bei der großen Masse von Weibern und Kindern und besonders bei den ungewöhnlich großen Lasten, die jeder einzelne zu schleppen hatte, leicht begreiflich. Hatten doch die Waniamuesi durch ihre Teilnahme am Kampfe gegen die Rebellen und an den Befestigungsarbeiten in den Küstenplätzen Gelegenheit gehabt, mehr als gewöhnlich zu verdienen, und so natürlich auch mehr eingekauft als sonst. Von einer Ordnung war überhaupt keine Rede, und es wäre verlorene Mühe gewesen, hieran irgendwie etwas ändern zu wollen, wenn wir nur unsern Zweck, die Karawane vor feindlichen Überfällen zu schützen, erreichten.
Aus Furcht vor einem Angriff Buschiris hielten sich die Waniamuesi in den ersten Marschtagen, als wir uns noch nicht mit der Expedition des Reichskommissars vereinigt hatten, stets möglichst dicht hinter dem deutschen Teil der Expedition, welcher die Begleitmannschaft und unsere Träger umfaßte. In Mtoni am Kingani verabschiedete sich Verfasser vom Lieutenant Sulzer. Nachdem wir die links vom Flusse sich hinziehende durch ihren Reichtum an Giraffen und Antilopen zur Jagd verlockende Ebene passiert hatten, langten wir in Mbuyuni, dem dortigen Hauptplatze der Wadoës an. Da diese sich am Aufstande beteiligt hatten, ihnen sogar nachgesagt wurde, daß sie[S. 104] drei von der Marine während des Kampfes desertierte Matrosen gefangen genommen und aufgezehrt hätten, — was dahin zu berichtigen ist, daß sie allerdings, ihrer alten kannibalischen Sitte folgend, den Leichnam eines jener drei von andern Aufständischen ermordeten und in den Fluß geworfenen Fahnenflüchtigen herausgefischt und verspeist hatten, — so war es von vorn herein nicht gewiß, wie sich die zu passierenden Wadoë-Dörfer zu unserer Expedition stellen würden.
Bei Mbuyuni angekommen, ging ich zunächst mit einigen meiner Leute in das von einer schwachen Boma umgebene Dorf, das ich ziemlich verlassen fand. Ich schickte in das Haus des Muene, wie die Wadoë-Häuptlinge genannt werden, und ließ ihn zu mir rufen. Er erschien auch sofort mit einem kleinen Gefolge, hinter sich einen Diener, der ein Leopardenfell und einen mit ebensolchem Fell überzogenen Sessel trug, — beides nebst einer kunstvoll geschnitzten Axt, welche der Muene immer mit sich führt, die von ihm unzertrennlichen Zeichen seiner Würde. Als der Diener den Sessel hingestellt und das Fell davor gebreitet, nahm der Muene selbst darauf Platz und ließ den Verfasser vor sich stehen. Es wurde ihm bedeutet, daß dies bei uns nicht Sitte sei, und er ließ auch sofort eine Kitanda (Negerbettstelle) herbei bringen, auf welche wir uns einträchtig neben einander setzten.
Aus der Unterredung gewann ich bald die Ueberzeugung, daß besagter Häuptling ein gutmütiger Mann sei, und daß ihm wie seinen Leuten daran lag, mit uns in Frieden zu leben. Wir erfuhren später, daß kurz vor meinem Besuche die Wadoë bei einem Zauberer angefragt hatten, ob sie den Krieg fortsetzen und auf Seiten Buschiris bleiben sollten oder nicht, und von diesem den Rat erhalten hatten, vom Kampfe abzulassen und sich offen auf unsere Seite zu stellen. So geschah es denn auch in Mbuyuni, wie in den andern Wadoë-Dörfern, welche wir durchzogen. Der Muene von Mbuyuni hat sogar einige Wochen später Anhänger Buschiris, welche jene Gegend passierten, gefangen genommen und Herrn von Gravenreuth nach Bagamoyo zugeschickt.
Ich machte zwei Rasttage, um die weit zerstreute Waniamuesi-Karawane wieder vollzählig beisammen zu haben.[S. 105] Von den Eingeborenen kehrten die meisten, auch die Weiber und Kinder bald wieder aus ihren Verstecken zurück, als sie sahen, daß wir nichts Arges gegen sie im Schilde führten, und nicht duldeten, daß ihr Hab und Gut irgendwie von unseren Soldaten oder den Leuten der Karawane angetastet würde, ja daß sogar die Diebstähle, welche die Waniamuesi nicht lassen konnten, streng bestraft wurden. Es bestand bald das beste Einvernehmen, und ein gemütlicher Verkehr zwischen uns und den Eingeborenen entfaltete sich.
Die Wadoë sind ursprünglich reguläre Kannibalen. Sogar noch im vorigen Jahrzehnt waren die Fälle, daß Leute geschlachtet und verzehrt wurden, gar nicht so selten und bei feierlichen Gelegenheiten, Thronwechsel und dergl. fehlte der Leckerbissen des Menschenfleisches nicht, trotz der großen Nähe der Küste und der Lage von Mbuyuni an der Karawanenstraße.
Bei der Karawane des Verfassers wurden eine Anzahl Brieftauben mitgeführt, um festzustellen, auf welche Entfernung dieselben zur Verbindung des Innern mit Bagamoyo verwandt werden könnten, wo sie einige Monate lang gefüttert worden waren. In Mbuyuni wurden zum großen Gaudium der Einwohner zwei Brieftauben mit der in den Kiel eingeführten und an einer Schwanzfeder angenähten Depesche aufgelassen. Sie stiegen zunächst hoch in die Luft empor, offenbar um Umschau zu halten und das Meer ist ihnen wahrscheinlich der beste Wegweiser über die einzuschlagende Richtung gewesen. Sie sind, wie auch alle andern, die in den nächsten Tagen bei Msua abgeschickt wurden, richtig in Bagamoyo eingetroffen. Verfasser war dafür, ein Paar Exemplare mit bis Mpapua zu nehmen und zu versuchen, ob sie auch von dort aus unsere Nachrichten bis an die Küste bringen würden. Es wäre dies später von großem Interesse gewesen, wenn die Kunde von der Ankunft Stanleys und Emin Paschas in Mpapua in kurzer Zeit hätte nach der Küste übermittelt werden können, um von da aus per Draht nach Europa befördert zu werden. Allein dies unterblieb, weil von Msua nur das absolut Notwendige weiter mitgenommen werden sollte.
[S. 106]
In den nächsten Tagen wurde Mbiki, ebenfalls ein Wadoë-Dorf, passiert, und zwei Tage später Msua erreicht. Von dort aus hatte mir der Kommandant schon die Nachricht seiner Ankunft gesandt. Nach dem Zusammentreffen setzte nun die gesamte Expedition unter der Führung des Reichskommissars ihren Weg fort, wobei es allerdings vorkam, daß die Waniamuesi-Karawane, welche so schnell nicht folgen konnte und mochte, mitunter ein auch mehrere Tage zurückblieb.
Bei diesem Marsche benutzten die Europäer, soweit es angängig war, Reittiere, und zwar Esel oder Maultiere. Die Versuche, Ochsen als Reittiere zu benutzen, wie dies in Westafrika geschieht, mißlangen. Die Tiere waren nicht kräftig genug, um den Anstrengungen unserer Märsche gewachsen zu sein, krepierten teilweise unterwegs, oder waren, wenn sie noch bis zur Küste gelangten, derartig entkräftet, daß sie dem Fieber erlagen, während die westafrikanischen Stiere meist aushalten; hat doch Wißmann den größten Teil seiner Reisen in Westafrika auf einem Reitochsen gemacht.
Beiläufig bemerkt, ist es eine in Ostafrika allgemein gemachte Erfahrung, daß Menschen (Fremde und Eingeborene) wie auch Tiere nach den Anstrengungen großer Expeditionen am Fieber erkranken, — ferner aber, daß bestehende Fieber durch Ortsveränderung verschwinden.
Bevor Wißmann nach Msua kam, hatte er in Pangiri die vereinigten Jumbes von Bagamoyo geschlagen und große Vorräte an Proviant erbeutet, von denen ein Teil der Expedition zu gute kam. Der Rest, der von den Soldaten und Trägern nicht verzehrt oder mitgenommen werden konnte, wurde wie das Rebellenlager selbst verbrannt.
Es sei gleich hier erwähnt, daß inzwischen Gravenreuth an der Küste aus den Besatzungen von Bagamoyo und Daressalam eine Abteilung zusammengezogen hatte, um mit ihr zur Züchtigung der Sklavenräuber in Bueni und Kondutschi auszuziehen. Er hatte Bueni, einen Platz, an dem immer viel Schmuggel getrieben worden war, besetzt und dort einen Offizier als Stationschef zurückgelassen. Die Besetzung Buenis und der Erfolg in Pangiri wirkten zusammen vorteilhaft für unser Ansehen an der Küste.
[S. 107]
Da im Innern die meisten Ortschaften, mehr oder minder dem Zwange der Verhältnisse folgend, am Aufstande beteiligt waren, wurde die Wißmannsche Expedition zunächst überall mit Furcht und Mißtrauen empfangen; so in Msua, wo die Weiber und Kinder geflüchtet waren und die Männer bewaffnet im Dorfe uns erwarteten. Sie wurden davon verständigt, daß es dem Reichskommissar fern liege, an allen, welchen eine Teilnahme am Aufstande zugeschrieben werden konnte, Rache zu nehmen. So ist es ihm an der Karawanenstraße, wo es besonders darauf ankam, möglichst schnell Sicherheit und Ordnung herzustellen, gelungen, die Häuptlinge und Eingeborenen für sich zu gewinnen. Wie überall, so meldete sich auch in Msua bald der Jumbe Simba mit seinen Leuten, brachte Geschenke und erbat friedlichen Verkehr. Von Msua aus ließ der Reichskommissar seine Ankunft in den an den nächsten Tagen zu passierenden Ortschaften immer vorher ankündigen und den Eingeborenen anheimgeben, ihm bereits auf dem Wege Gesandte entgegenzuschicken, und eine friedliche Verständigung zu suchen. In allen Dörfern hielt Wißmann dann Schauri ab (Gerichtsverhandlung), worin er erklärte, daß er es nur mit Buschiri, dem Anstifter des Aufstandes zu thun habe, der auch jetzt noch keinen Frieden wolle, sondern den Krieg gegen uns fortsetze. Er werde daher auch fortfahren Buschiri zu bekämpfen und überall hin zu verfolgen; ihn und seinen Anhang irgendwie zu unterstützen, verbiete er den Eingeborenen, wenn sie ein Einschreiten seinerseits und eine strenge Bestrafung an ihrem Hab und Gut vermeiden wollten. Er versprach zugleich, gegen die Räuber und Sklavenfänger strengstens vorzugehen und aufs angelegentlichste für die Herstellung von Ruhe und Ordnung an der Straße Sorge zu tragen. Solche Reden Wißmanns verfehlten nirgends ihren Eindruck. Alle Dörfer erbaten sich Schutzbriefe und eine deutsche Flagge, die sie freilich in der ersten Zeit noch etwas schüchtern aufzogen, da sie es doch noch immer für angezeigt hielten, sich nicht ganz offen in den Augen des uns feindlichen Teils der Araber, Belutschen und Mrima-Leute als Freunde der Deutschen zu bekennen. Konnten sie doch immer noch annehmen, daß die Rebellenpartei gelegentlich einmal die Oberhand gewinnen[S. 108] würde. Indes die zunehmenden Erfolge Wißmanns und Gravenreuths und die späteren Siege über Buschiri bewogen sie bald, ganz offen für uns Farbe zu bekennen.
Von Msua ging es weiter über Kisemo, Gerengere nach Simbamueno, einem Dorfe in der Ebene, welche sich am Fuße der Ukamiberge südlich vom Nguru-Gebirge hinzieht und östlich in die Makata-Ebene übergeht. Am Abhange der Ukamiberge, etwa 1-1/2 Stunde von Simbamueno und eine Stunde von der westlich dieses Dorfes gelegenen Ortschaft Morogro ist von der französischen Mission eine Station angelegt, die in der Regel ebenfalls Morogro genannt wird. Dieselbe hatte in der letzten Zeit die gesamten Missionare der Missionsgesellschaft vom heiligen Geist, aus Longa, Mhonda und Tubugue beherbergt. Es schien auf diesen Stationen nicht mehr genügende Sicherheit vor Buschiri vorhanden zu sein, obgleich er die Bagamoyo-Missionare stets als neutral behandelt hatte. In Morogro selbst hatte die Mission den Schutz des mächtigen Häuptlings Kingo angerufen, der als Herrscher von Morogro bis an die Grenze von Usagara anerkannt war, ein wohlbefestigtes und leicht zu verteidigendes Dorf zum Sitz hatte und sich der französischen Mission, von der er viele Wohlthaten empfangen, stets gut gesinnt erwiesen. Von Morogro aus schickte Wißmann einen Boten mit Nachrichten über die Vorgänge an der Küste und seine Absichten zu den Missionaren, und erhielt auch von diesen einen Brief zurück. Da aber darin genauere Angaben über Kingo fehlten, Kingo selbst weder erschien, noch Gesandte schickte, auch die für die große Karawane so notwendigen Lebensmittel aus Morogro und Simbamueno, wo Kingos ältere Schwester, gleichfalls Simbamuene genannt, herrschte, nicht zum Verkauf gebracht wurden, so hatten wir Grund anzunehmen, daß es mit der guten Gesinnung des Häuptlings doch so weit nicht her sein könne. So wurde denn den Eingeborenen mitgeteilt, daß am nächsten Tage ein Besuch Kingos erwartet werde und schleunigst ausreichende Lebensmittel gebracht werden sollten, wenn sie eine für sie unangenehme gewaltsame Requisition vermeiden wollten.
Am nächsten Morgen schickte mich der Reichskommissar mit Lieutenant Böhlau auf die Mission, um genauere Nachrichten[S. 109] über die dortigen Verhältnisse einzuziehen, die Missionare zu uns ins Lager einzuladen und sie, falls sie Einfluß auf Kingo hätten, zu bewegen, denselben in vermittelnder Weise zur Geltung zu bringen.
Der Vorsteher der Mission, Pater Mevel, ein Franzose, empfing uns auf das liebenswürdigste; bei ihm befand sich Pater Horner, ein Nassauer, der vorher an der Westküste zwei Jahre thätig gewesen war. Verfasser erfuhr von ihnen, daß Kingos Verhalten ein durchaus friedliches gewesen war, daß er sogar ein persönlicher Feind Buschiris sei und diesem sowohl wie den von Pangiri geflüchteten Jumbes von Bagamoyo die Aufnahme in seinem Dorfe verweigert habe. Er hatte die letzteren hierdurch gezwungen, von der Karawanenstraße nach Süden abzubiegen; die Missionare habe er entschieden in Schutz genommen und ein Vorgehen Buschiris gegen sie verhindert, welcher des Lösegeldes wegen sie gern in seine Gewalt gebracht hätte. Daß Kingo sich den Deutschen noch nicht genähert habe, sei auf eine gewisse den Negern überhaupt eigentümliche Ängstlichkeit zurückzuführen.
Die von den Missionaren an den Häuptling gesandten Boten bewogen diesen auch sofort, sich mit Geschenken zu uns ins Lager zu begeben und seine Unterthanen zum Verkaufe reichlicher Lebensmittel zu veranlassen. Am Nachmittag desselben Tages begab sich Verfasser auch zur Simbamuene, einer bereits ältlichen Dame mit ergrautem Haar und erreichte hier den gleichen Erfolg. Tags darauf verlegte Wißmann das Lager von Simbamueno in die Nähe des Kingoschen Dorfes.
Es sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß wir die Lager immer in einer dem Gelände angepaßten Form, meist im Viereck oder im Kreise errichteten und mit einer schirmartigen schrägen Umzäunung aus Matama oder Maisstengeln oder irgendwelchem Gestrüpp oder Gras, je nachdem es die Gegend ermöglichte, umgaben. Die Soldaten hatten auf diese Weise Schutz gegen die gröbsten Unbilden des Wetters und das Innere des Lagers war zum Teil dem Einblick von außen entzogen. Bei einem Überfalle hatten die Truppen weiter nichts zu thun, als sich jeder an dem angewiesenen Platze auf die Erde zu werfen, die Gewehre aus der Einfassung herauszustecken und den Befehl[S. 110] zum Feuern abzuwarten. Im Innern der Lager erhoben sich eine Anzahl Zelte für je zwei, drei und vier Europäer. Vor dem Zelte Wißmanns wurde in der Regel das Maxim-Gun und das 4,7 cm Geschütz aufgestellt, welches stets sofort nach dem Beziehen des Lagers zum Gefecht klar gemacht wurde. Alsdann wurden Innen- und Außenposten aufgestellt.
Über die Art und Weise unseres Marsches ist folgendes zu erwähnen. Wenn eine besondere Eile nicht erforderlich schien, wurde des Vormittags und auch noch einen Teil des Nachmittags marschiert, bis der für den Tag bestimmte Lagerplatz erreicht war, die Expedition hatte dann noch hinreichend Zeit, sich vor Eintritt der Dunkelheit ordnungsgemäß und bequem einzurichten.
Das war natürlich nicht möglich, wenn es galt schnell vorwärts zu kommen. Dann wurde in den weniger heißen Stunden des Vormittags marschiert und nach einer Mittagsrast der Marsch den späteren Nachmittag hindurch fortgesetzt. Wenn es der Zweck erforderte, wenn zum Beispiel die Absicht vorlag, irgendwo überraschend anzutreten, sind von der Schutztruppe öfters auch sehr bedeutende Eilmärsche, Tag und Nacht hindurch, ausgeführt worden. —
Wie erwähnt, führte das Schauri in Simbamueno, das dann später in Morogro fortgesetzt wurde, zu einem für beide Teile befriedigenden Resultate. Kingo erklärte sich ganz offen für uns und umgekehrt wurde ihm von Wißmann seine Herrschaft bis nach Usagara, — selbstredend unter deutscher Oberhoheit, — bestätigt. Auch wurde sein Einfluß bei allen Schauris mit den Eingeborenen der nächsten Dörfer, auf denen sich der Reichskommissar als Freund Kingos erklärte, in jeder Weise gehoben. Es war dies für uns ein großer Vorteil, da wir bei unsern verhältnismäßig geringen Mitteln in Ostafrika nicht überall selbst sein und herrschen können. Oft sind wir auf die gute Gesinnung der eingeborenen Häuptlinge angewiesen und sind durch diese viel leichter und ohne Mißstimmung zu erregen in der Lage, unsere eigene Herrschaft auszubreiten und humanitäre Zwecke zu erreichen. Außerdem wurde Kingo ein Monatsgehalt ausgesetzt und ihm außer andern Geschenken seinem Wunsche gemäß die deutsche[S. 111] Fahne übergeben. Von der Küste wurden ihm später zur Verteidigung seines Dorfes zwei Böller übersandt, mit denen allerdings nicht viel Unheil anzustiften ist, die aber immerhin auf die feindlichen Eingeborenen ihre moralische Wirkung nicht verfehlen.
Kingo gab unserer Expedition bis nach Usagara seinen Bruder Kibana mit, welcher Wißmann durch seine Beziehungen zu den Eingeborenen gute Dienste leistete und ihm seine Absicht erleichterte, die Eingeborenen an der Straße für sich zu gewinnen.
Unterdes hatten die aufständischen Jumbes es ihrerseits nicht an Bemühungen fehlen lassen, den mächtigen Häuptling auf ihre Seite zu bringen, obwohl sie ja allerdings, wie oben erwähnt, durch sein ablehnendes Verhalten genötigt worden waren, nach Süden auszubiegen. Von ihrem neuen Lager aus schickten sie einen Brief an Kingo. Sie hofften ihn zu bewegen, mit ihnen gemeinsam die Waniamuesi-Karawane, welche sehr langsam marschierte und noch hinter uns zurück war, oder, wenn sie wieder mit uns vereinigt wäre, die gesamte Expedition auf dem Marsche von Makata nach Comberingha an einem der nächsten Tage zu überfallen. Sie glaubten besonders durch den Hinweis auf die wertvollen Lasten der Karawane die Gewinnsucht Kingos zu reizen und ihn dadurch dem vorgeschlagenen Unternehmen geneigt zu machen.
Wißmann hatte es jedoch, wie immer bei den Eingeborenen, verstanden, das Vertrauen des Häuptlings derartig zu gewinnen, daß dieser nach Empfang des Briefes nichts Eiligeres zu thun hatte, als ihn dem Reichskommissar zu übergeben und ihn so von dem Anschlage in Kenntnis zu setzen.
Es war dies am 3. September Abends. Infolgedessen erteilte Wißmann mir den Auftrag mit der Zulukompagnie von Medem und einer halben Kompagnie Sudanesen, geführt von ortskundigen Eingeborenen, welche Kingo uns zur Verfügung stellte, gegen die Aufständischen vorzugehen. Ich fand diese nach ununterbrochenem Marsche in den Mittagsstunden des 4. September in der Nähe von Somwi, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie wurden sofort aus ihrer ersten[S. 112] Position geworfen, hielten uns aber, als wir in dem sehr coupierten Terrain weiter vorgingen, noch einmal in einer Bergmulde stand. Hier entspann sich ein heftiges Feuergefecht.
Meine Abteilung bis auf einen Zug Sudanesen, den ich die hinter uns gelegenen Hügel hatte besetzen lassen, hatte ich völlig entwickelt, und so lagen wir uns in langen Linien an einem sich unregelmäßig durch das Gelände hinziehenden Graben, der ein natürliches Hindernis bildete, auf nur 20 Schritt gegenüber.
Der hohe Gras- und Dornenwuchs gestattete wenig Einsicht in das Terrain, in welchem sich der Gegner festgesetzt hatte, doch schien er nach einer Reihe von Salven, die er zuerst ebenfalls mit einem heftigen Schnellfeuer erwiderte, erschüttert, und als wir nun mit Marsch-Marsch über das Hindernis vorgingen, zwangen wir ihn zu einer regellosen Flucht ins Gebirge, das uns leider nur eine kurze Verfolgung gestattete.
In dem Gefechte waren auf gegnerischer Seite etwa 30 Mann gefallen und viele verwundet worden. Wir hatten einen Zulu tot und drei schwerverwundete Farbige; Verfasser selbst hatte einen leichten Streifschuß am Oberschenkel und Herr Ehlers, der sich freiwillig angeschlossen hatte, konnte von großem Glück sagen, daß ihm eine gutgemeinte Kugel zwischen den Strümpfen und der Stiefelsohle stecken geblieben war.
Wir hatten auch drei Gefangene gemacht. Dieselben unternahmen, als wir nach der Rückkehr von der Verfolgung gerade mit dem Verbinden der Verwundeten und dem Bestatten des Gefallenen beschäftigt waren, einen Fluchtversuch und wurden dabei von den sie bewachenden Zulus, ehe es Verfasser hindere konnte, mit den Messern niedergestochen. Das Dorf Somwi, aus welchem ebenfalls auf uns geschossen war, wurde geplündert und niedergebrannt.
Als wir nach diesem Gefecht bei Somwi etwas gerastet hatten, wurde dem vorher erteilten Befehl Wißmanns gemäß sofort der Rückmarsch nach Morogro angetreten. Diesem hatte Verfasser durch einen Boten seinen Erfolg gemeldet und zugleich mitgeteilt, daß wir Verwundete mit uns führten. Infolgedessen schickte uns der Reichskommissar den die Expedition[S. 113] begleitenden Lazarettgehülfen Grucza unter Bedeckung bis in die Gegend von Simbamueno entgegen, wo die Schwerverwundeten einen regelrechten Verband erhielten. Kurz vor dem Anbruch des 5. September traf ich wieder im Lager ein, in dessen unmittelbarer Nähe eine Abteilung unter Lieutenant Ramsay inzwischen die Waniamuesi, für welche Wißmann Besorgnisse hegte, ein Lager hatte beziehen lassen. Nachdem Wißmann uns am 5. September einen Rasttag gegönnt hatte, damit wir uns von den Anstrengungen des Unternehmens gegen Somwi erholen konnten, wurde am 6. der Weitermarsch angetreten.
Bis Mpapua hin war der Marsch ein durchaus friedlicher. Er führte zunächst über den Makata-Fluß und durch die Makata-Ebene nach Longa. Hier befand sich ebenfalls eine französische Missionsstation, die seit wenigen Tagen wieder von den Missionaren bewohnt wurde. Der einzige Platz, in dem die Verhältnisse noch manches zu wünschen übrig ließen, war Kondoa. Das arabische Element hatte hier die Oberhand und hier war die Heimat eines Teils der Buschirischen Rebellen. Da indes die meisten, welche wirklich am Aufstande Teil genommen hatten, entflohen waren, andererseits die Missionare den Reichskommissar baten, die zurückgebliebenen Araber zu schonen, und da endlich Wißmann selbst Bedenken trug, eine so reiche und für die Karawanenstraße so überaus wichtige Ortschaft zu zerstören, wurde auch Kondoa, wie das gesamte durch Usagara sich hinziehende Mukondogua-Thal friedlich durchzogen. Freilich sind die Bewohner Kondoas, obwohl sie so gut davonkamen, nie ganz zuverlässig gewesen, nur die Furcht vor unserem Einschreiten hat sie im Zaume gehalten, so lange wir den Erfolg auf unserer Seite hatten. Erst in der neueren Zeit, nach der Katastrophe in Uhehe, hat der widerauftauchende Übermut der Araber und Belutschen zu Kondoa den durchziehenden Europäern und den Missionaren Grund zu heftigen Klagen gegeben.
Ein Tagemarsch hinter Kondoa brachte uns nach Muinisagara, wo die Tochter des alten, bereits früher erwähnten Muinisagara, denselben Namen führend, residierte. Bei dem Vorbeimarsch sahen wir die Reste der früheren Gesellschaftsstation[S. 114] Kiora, welche schon ein Jahr vor dem Aufstand, ebenso wie das nördlich gelegene Sima, von den Wasagara zerstört war. Verfasser benutzte mit einem Teile der Kameraden den Aufenthalt in Muinisagara, auch Sima und das Grab des früheren Vorstehers der Station, des Gärtners Schmidt, zu besuchen, welcher ihn im Jahre 1885 gastlich daselbst aufgenommen hatte.
Über Kirassa, den Kidete-Fluß, Dambi und Tubugue führte sodann der Weg nach Mpapua. Bei Kirassa verließen wir Usagara und das fruchtbare Mukondogua-Thal. Der Weg führte von nun an durch ein recht coupiertes und schwieriges Terrain, planlos Berg auf und Berg ab, während er sehr gut, durch eine Schlucht weiter südlich, sanft aufsteigend nach Mpapua hätte angelegt werden können. Hier war früher auch eine Straße gewesen, die jedoch, um den Negerausdruck zu gebrauchen, im Laufe der Zeit gestorben, d. h. mit Gestrüpp überwachsen war. Die Karawanen hatten sie aus Furcht vor den Wahehe, welche dieses Gebiet unsicher machten, aufgegeben. Einen Teil des Dorfkomplexes von Kirassa, der im Mukondogua-Thale lag, fanden wir niedergebrannt und zerstört. Die Eingeborenen erzählten uns, daß wenige Tage zuvor die Wahehe einen ihrer Einfälle gemacht und nur die hohen auf dem Abhang der Usagara-Berge verstreuten Hütten verschont hätten. Die Bewohner dieser hochgelegenen Hütten waren gezwungen, jedesmal von ihrer Höhe herunter ins Mukondogua-Thal zu steigen, um das unentbehrliche Wasser zu holen; aber die Sicherheit vor den gefürchteten Wahehe ließ sie dieses Ungemach recht gern ertragen.
Geographisch wird Ugogo im Osten erst durch die Bergkette zwischen Tubugue und Mpapua begrenzt, und diese Grenze ist auch auf allen Karten angegeben; doch bildet jetzt ethnographisch bereits der Höhenzug nördlich des Mukondogua-Thales die Grenze von Usagara und Ugogo, da die schwächlichen Wasagara im Laufe der Zeit immer mehr und mehr vor den umwohnenden kriegerischen Stämmen zurückgewichen sind. Von Westen her drängten die räuberischen Wagogo, von Südwesten her die Wahehe und aus dem Nordwesten die Massai, oder[S. 115] genau gesagt, die einen Teil derselben ausmachenden Wahumba. Die spärlichen, von uns hinter Kirassa passierten Ortschaften waren alle von Wagogo oder mit ihnen vermischten Negern bewohnt. Gerade zu der Zeit, wo wir diese Gegend durchzogen, war ein heftiger Kampf der Wahehe gegen die Massai vorangegangen, und so fanden wir öfter eben erst von den Wahehes verlassene Lagerstätten.
Nachdem wir in Tubugue, einem größeren Orte der Wagogo, gerastet, erreichten wir am 10. Oktober Mpapua. Auf dem Höhenzuge zwischen beiden Dörfern fiel uns ein mit Unterholz wenig bewachsener Wald auf, der uns in den nächsten Tagen gutes Bauholz für den Bau der Station lieferte. In Mpapua zogen wir zunächst an den von Buschiri bei seiner letzten Anwesenheit zerstörten Gebäuden und der Kirche der englischen Mission vorbei, bis zu dem kleinen Hügel hin, der sich dicht am Fuße des östlichen Höhenzuges am Ausgange des von Mpapua eingenommenen Thales nach Nordosten hin erhebt. Hier hatte die Station der Ostafrikanischen Gesellschaft gestanden, die ebenfalls von Buschiri, soweit es die Stärke der Mauern zugelassen, zerstört war. Dieser Platz war vom militärischen Standpunkt aus durchaus unpraktisch gewählt, da von dem Abhange des östlichen Gebirgszuges mit Gewehren ganz bequem in die Station und ihre Zimmer hineingeschossen werden konnte, und zwar aus einer Entfernung von kaum mehr als 100 m.
Wir wurden beim Einrücken von den englischen Missionaren, welche von ihrer Station in Kisogue nach Mpapua herübergekommen waren, begrüßt, und Wißmann erhielt von ihnen über die Vorgänge hierselbst und die Stimmung der Eingeborenen Nachricht.
Der erste Häuptling des Ortes, Kipangiro oder Schipangilo, der von seinen Gegnern angeschuldigt wurde, mit Buschiri im Einverständnis gewesen zu sein, war geflohen und hielt sich in den nahen Bergen versteckt. Das Geschütz der Station, welches er, wie oben bemerkt, in seine Tembe gebracht hatte, wurde von uns dort abgeholt, und da uns Nahrungsmittel nicht zum Verkauf geboten wurden, wurden sie ebendort entnommen und unter die Soldaten verteilt. Es gelang indes[S. 116] in den nächsten Tagen den Häuptling zu beruhigen und ihn zu bewegen in unser Lager zu kommen, wo er von Wißmann die Zusicherung friedlichen Verkehrs erhielt.
Gleich am Nachmittage nach unserer Ankunft gingen wir daran, einen geeigneten Platz für die neue Station auszusuchen. Wißmann hielt es durchaus für angezeigt, in Mpapua, welches von allen Karawanen, die vom Viktoria und Tanganjika nach der Küste gehen, und umgekehrt, passiert werden muß und nur unter großen Beschwerden durch einen Marsch über ein an Wasser und Nahrungsmitteln armes und sehr beschwerliches Terrain vermieden werden kann, einen festen Stützpunkt für die Sicherung der Karawanenstraße und der durchziehenden Karawanen zu errichten. Bei der Auswahl eines Platzes waren der Reichskommissar, von Zelewski und der Verfasser thätig. Wir waren bald darüber einig, daß kein Platz besser dazu geeignet sei, als der, auf welchem die jetzige Station steht. Es ist eine dicht an dem einzigen die Ebene durchziehenden Flußlauf sanft ansteigende Erhebung, von welcher aus das gesamte Terrain ringsum beherrscht, und besonders auch die Wagogo-Tembes unter Feuer genommen werden können. Steine für den Bau waren reichlich von den früheren Befestigungen vorhanden, und Holz lieferte uns der oben erwähnte Wald. So wurde im Laufe der Woche, die Wißmann in Mpapua verblieb, die Steinumwallung der Station etwa 1 m hoch aufgeführt, mit zwei zur Unterkunft eingerichteten Eckbastionen versehen, auf deren einer das Geschütz aufgestellt wurde, und mit zwei starken Hindernissen, einem Ast- und einem Dornverhau umgeben.
Die Zeit seines Aufenthaltes benutzte Wißmann, um möglichst viel gute Beziehungen mit den eingeborenen Häuptlingen, speziell denen der Wagogo, anzuknüpfen, wobei ihm die englischen Missionare nach bestem Vermögen zur Seite standen. Die Waniamuesi-Karawane, deren Häuptlinge Wißmann teilweise von seiner ersten Durchquerung Afrikas kannte, — er hatte damals mit Mirambo, dem damaligen Herrscher von Uniamuesi Freundschaft geschlossen, — nahm infolge der guten Behandlung unsererseits und des Schutzes, den wir ihnen hatten angedeihen lassen, lebhafte Sympathien[S. 117] für uns mit in ihre Heimat. Wißmann gab ihr auch reiche Geschenke an den inzwischen auch verstorbenen Häuptling Pandascharo mit.
Nach achttägigen Arbeiten, die meist von Wißmann persönlich geleitet wurden, übergab er die Station, besetzt mit 75 Zulus, 25 Sudanesen, 10 Suaheli, 2 deutschen Unteroffizieren und dem zum Stationschef ausersehenen Lieutenant von Medem, zunächst dem Verfasser mit dem Auftrage, die weitere Regelung unseres Verhältnisses zu den Eingeborenen in die Hand zu nehmen. Ich sollte den Reichskommissar in dieser Gegend vertreten, bis die Stanley'sche Expedition und Emin in Mpapua anlangten, sollte diese Expedition begrüßen und mit 10 Sudanesen der Station durch deutsches Gebiet nach Bagamoyo führen.
[S. 118]
Erweiterung der Beziehungen zu den Eingeborenen. — Reise in die Umgegend von Mpapua. — Die Massais und Wagogo um Mpapua. — Vertrauen der Massai zur Station. — Befestigung und Bauarbeiten. — Schlechter Gesundheitszustand der Europäer. — Dyssenterie in Mpapua. — Ankunft der Stanleyschen Expedition. — Rückblick auf Emins Lage in der Äquatorialprovinz. — Sein Abmarsch mit Stanley. — Ärztliche Dienste des Pascha in Mpapua. — Stanleys Entgegenkommen. — Abmarsch zur Küste. — Marschordnung. — Leben auf dem Marsche. — Verkehr mit den Eingeborenen. — Jagd. — Begegnung unserer Expedition mit Gravenreuth in Msua. — Amerikanische Reporter. — Ankunft in Bagamoyo. — Emins unglücklicher Fall. — Seine Behandlung und Heilung.
Für die dauernde Wahrnehmung der Stationsleitung in Mpapua war, wie erwähnt, der Lieutenant v. Medem ausersehen. Er war von den jüngeren Offizieren der Expedition, die damals für Mpapua in Frage kamen, derjenige, welcher am meisten die für jene höchst wichtige Stellung notwendigen Eigenschaften in sich vereinigte: große Ruhe und die Fähigkeit, mit den Eingeborenen zu leben und sich diesen anzupassen, praktischen Sinn und große Willenskraft, dazu ein besonderes Talent, gerade mit den Zulus, die ja den Hauptteil der Besatzung von Mpapua bildeten, umzugehen. Wißmanns Wahl fiel sofort auf Medem; es wurde dem Verfasser übertragen, diesen während der Zeit der gemeinsamen Thätigkeit zu Mpapua noch eingehender mit den örtlichen Geschäften bekannt zu machen.
Dem Befehle des Reichskommissars gemäß benutzte der Verfasser die nächsten Wochen nach dem Abmarsche der Expedition[S. 119] Wißmanns von Mpapua zur weiteren Fortführung der Stationsarbeiten, sowie zur Erweiterung unserer freundschaftlichen Beziehungen zu den Eingeborenen in der Umgebung Mpapuas und zwar bis zu den mehrere Tagereisen weit von dort angesessenen Stämmen. Eine höchst angenehme Beigabe war bei diesen Reisen die Ausübung der hervorragend guten Jagd, welcher auf dem Hermarsch die Mitglieder der Expedition nur an einzelnen Stellen, z. B. in der Makata-Ebene hatten obliegen können. Ich besuchte mehrere Häuptlinge der Wagogo und der Wahumba, deren Land von Ugogo durch den nördlich Mpapua's sich hinziehenden Höhenzug geschieden wird. Vom Kamm dieses Höhenzuges öffnet sich eine weite, herrliche Aussicht über die zu Füßen sich ausbreitende Massai-Ebene. Ebenso hatte ich Gelegenheit, das Land der Wahehe zu sehen, allerdings nur an der äußersten Grenze und auf einer Jagdreise.
Die Massai lebten zu jener Zeit im Kriege mit den Wahehe. Wie schon erwähnt, hatten letztere kurz vor der Ankunft der Expedition einen Überfall nicht nur in Usagara gemacht, sondern waren auch bis ins Land der Wahumba vorgedrungen, und es war ihnen durch ihr unerwartetes Auftreten gelungen, noch einige Viehherden der Massai zu erbeuten. Eines Tages, als ich von Kongua aus in ein Massaidorf kam, fand ich daselbst tausende von Massai-Kriegern, auch solche, die nicht zum Stamme der Wahumba gehörten, und die, wie sie erklärten, bis vom Kilimandscharo hergekommen waren, um mit vereinten Kräften gegen die Wahehe zu kämpfen. Es fanden denn auch in dieser Zeit sowohl in der Marenga Mkali, der westlich von Mpapua von Tschunio an sich mehrere Tagereisen ausdehnenden süßwasserlosen Steppe wie auch weiter südlich an der Grenze von Uhehe fast täglich zwischen den beiden Stämmen Gefechte statt.
Mit den Wagogo und Massai war es vollkommen gelungen, einen friedlichen Verkehr herbeizuführen. Ich besuchte ihre Häuptlinge, wie auch umgekehrt diese selbst von weit her mit Geschenken zur Station kamen und sich Schutzbriefe von mir ausbaten. Selbst der oberste Wahumba-Häuptling schickte eine Gesandtschaft und gab derselben ein Geschenk an Rindern mit, was sonst bei den Massais unerhört ist. Sie bringen[S. 120] es selten übers Herz, sich selbst von dem schlechtesten Stück Rindvieh zu trennen. Die Gesandtschaft befragte mich, wie ich über ihren Feldzug gegen die Wahehe dächte und ob ich geneigt sei, sie hierin zu unterstützen, ihnen eventuell von meiner Besatzung Leute mitzugeben. Ich konnte ihnen meinerseits zwar guten Erfolg zu ihrem gerechten Vergeltungskampf wünschen, hielt es aber für gut, jede Unterstützung abzulehnen. Es waren über die Werbungen Buschiris bei den Mafitis und Wahehe nur Gerüchte zu uns gedrungen, keineswegs aber konnten diese damals als feststehende Thatsachen angesehen werden. Zudem wurde unsere Besatzung notwendig zum Bau der Station gebraucht: wir mußten auf alles gefaßt sein und daher alle unsere Kräfte zusammenhalten, wie ja auch der Reichskommissar zur Vorsicht ermahnt hatte.
Ich stellte den Massai jedoch meine Hilfe in Aussicht, wenn die Wahehe in der Umgegend von Mpapua selbst aufträten oder wenn sie zu weit nach den Wahumba hin um sich griffen. Unser Verhältnis zu den Wahumba und den östlichen Wagogo war, wie aus dem Erwähnten hervorgeht, ein gutes und ist im allgemeinen auch ein solches geblieben, wenngleich einzelne Räubereien der Wahumba sowohl wie der Wagogo an der Karawanenstraße hier und da die Besatzung von Mpapua zum Einschreiten nötigten. Sehr schlecht dagegen haben sich, wie das nicht anders zu erwarten war, unsere Beziehungen zu den Wahehes gestaltet.
Neben der Ausbreitung des Ansehens der neuen, von Wißmann gegründeten Station, schritten auch die Befestigungs- und Bauarbeiten rüstig vorwärts, welche nach meiner Abreise vom Feldwebel Hoffmann weitergeführt und von Herrn von Bülow vollendet wurden. Hingegen ließ der Gesundheitszustand unter den Europäern wie den Farbigen der Station sehr viel zu wünschen übrig. Die Dyssenterie brach mit großem Heftigkeit unter uns aus. Der Unteroffizier Kröhnke war schon auf dem Marsche von dieser Krankheit befallen worden, wahrscheinlich angesteckt von dem Feldwebel Markgraf, mit dem er in einem Zelte zusammenlag. Bald nach ihm erkrankten einige Sudanesen und Zulus, und trotz aller Vorsichtsmaßregeln griff die Krankheit immer mehr und[S. 121] mehr um sich, vermutlich durch die Unmassen von Fliegen in dem viehreichen Mpapua weiter getragen. Endlich wurden auch Lieutenant von Medem und ich von der Krankheit ergriffen. Durch den Tod verloren wir, solange ich in Mpapua war, nur einen Farbigen, einige Wochen jedoch nach meinem Abmarsche erlag auch Lieutenant v. Medem der Krankheit, während Unteroffizier Kröhnke sich besserte. Indessen machten bald vielfache schwere Fieberanfälle auch seine Ablösung von Mpapua und seine Beförderung nach der Heimat notwendig. In Deutschland fiel er einem Herzschlage zum Opfer.
Während der ganzen Zeit der Epidemie standen uns die englischen Missionare in Kisogue opferbereit zur Seite, wie denn überhaupt das Verhältnis zwischen Mission und Militärstation ein sehr freundschaftliches war.
Der Reichskommissar hatte mir, wie erwähnt, den Befehl erteilt, die Ankunft der Expedition Stanley-Emin Pascha in Mpapua abzuwarten und dieselbe dann durch deutsches Gebiet an die Küste zu führen. Am Tage der Ankunft der Wißmannschen Expedition hatten Boten von Stanley Mpapua passiert, durch welche wir Kenntnis von seinem Herannahen erhielten. Wißmann selbst sandte durch die bereits mehrfach erwähnte Waniamuesi-Karawane, die ihren Weitermarsch nach der Heimat fortsetzte, einige Briefe mit, in denen er Emin Pascha und Stanley begrüßte und sie über die Vorkommnisse der letzten Zeit orientierte.
Etwa einen Monat später traf die Stanleysche Expedition, trotz einer ziemlichen Anzahl Kranker und Schwacher und des ziemlich wüsten Gesindels, welches aus der Äquatorialprovinz mitkam, gut geordnet und geschlossen vor der Station ein, bei einer so großen Karawane immer ein Zeichen, daß es der Führer verstanden hat, die Disziplin aufrecht zu erhalten. Sie bezog das gewöhnliche Karawanenlager, um eine große Sykomore herum, wo Stanley gelegentlich einer seiner früheren Expeditionen schon gelagert hatte. Die Karawane bestand aus 3 Kompagnien Wangwana zu je 60 Mann, etwa 80 Wangwana-Trägern und den aus Wadelai mitgezogenen Leuten des Pascha, welche fast alle Weiber, Kinder und Träger mit sich führten. Die letzteren waren mit allem möglichen, teilweise[S. 122] ganz wertlosen Hausgerät beladen und erinnerten uns lebhaft an die Eigenschaft unserer Sudanesen, alles, was nicht niet- und nagelfest ist, mit sich zu schleppen. Im ganzen waren es noch etwa 600 Mann, trotz der großen Verluste, die die Karawane unterwegs erlitten hatte. Unter den Leuten des Pascha befand sich eine Anzahl ägyptischer Offiziere, Schreiber und Soldaten, ein griechischer Kaufmann, der sich früher in Wadelai etabliert hatte, und ein ebenfalls daselbst als Apotheker thätig gewesener tunesischer Jude. Die Weiber und Kinder, wie auch die meisten Offiziere ritten auf Eseln.
Die Europäer der Expedition waren folgende: Stanley mit seinen Offizieren, den Herren Lieutenant Stairs, Kapitän Nelson, Dr. Parke, Mr. Jephson, seinem, man kann sagen Proviantmeister, Mr. Bonny, und einem Diener, namens Hoffmann. Ferner zwei französische Missionare, Père Giraud, ein sehr liebenswürdiger Mann, welcher durch ein Augenleiden zur Rückkehr nach Europa genötigt war, und der ihm zur Begleitung mitgegebene Père Schynse, jener bekannte, bei den Deutschen allgemein beliebte, ganz deutsch denkende und fühlende Mann, der dem Werke der Zivilisation leider zu früh durch den Tod entrissen worden ist. Die beiden letzteren kamen von Bukumbi, ihrer Station am Südufer des Viktoriasees und waren in Ikungu zur Expedition Stanleys gestoßen, um unter ihrem Schutze weiter nach der Küste zu marschieren. Endlich waren bei der Expedition Emin und Casati, welcher dem Pascha während seines Aufenthaltes im Sudan treulich zur Seite gestanden hatte. Besonderes Interesse erregte die kleine Tochter, die Emin von seiner verstorbenen Frau, einer Abessinierin, hatte, namens Ferida, die damals etwa 6 Jahr alt war, und in der Karawane in einer Hängematte stets unmittelbar vor dem damals schon ganz kurzsichtigen Pascha einhergetragen wurde. Der Pascha hing mit großer Liebe an ihr und wollte sie immer vor sich sehen. Sie wurde von ihrer Gouvernante, einer ganz hübschen, stattlichen Ägypterin begleitet.
Stanley pflegte immer an der Spitze des Zuges zu marschieren, und so hatte ich denn zuerst Gelegenheit, ihn zu begrüßen. Er machte mich alsbald mit seinen Offizieren, sowie[S. 123] mit Emin und Casati bekannt. Unser spärliches Hausgerät auf der Station gestattete mir zunächst nur den Pascha und Stanley zum Essen zu mir zu laden. Eine Flasche Sekt, deren mir Wißmann mehrere für Krankheitsfälle und speziell zur Begrüßung Emins und Stanleys dagelassen hatte, wurde auf die glückliche Ankunft beider getrunken. Sie mundete ihnen ganz trefflich, da sie solche Erfrischungen lange hatten entbehren müssen. Im Verkehr zwischen dem Pascha und Stanley bemerkte ich bald den Gegensatz der beiden Männer, der, obwohl sie täglich öfter mit einander zusammenkommen mußten, eine rechte Ungezwungenheit, besonders von Seiten des Pascha, nicht aufkommen ließ. Dieser erzählte mir, wie herzlich er sich gefreut habe, als er durch Wißmanns Briefe Kenntnis von unseren Fortschritten erhalten, als er die deutsche Flagge auf der Station habe flattern sehen, und wie lebhaftes Vergnügen er jetzt empfinde, wieder mit Deutschen persönlich verkehren zu können. Er erzählte mir auch offenherzig von der Expedition Stanleys und dessen Absichten.
Bei der Wichtigkeit der Persönlichkeit Emins für uns und wegen seiner späteren Anteilnahme an den Arbeiten des Reichskommissariats erscheint ein kurzer Rückblick auf die Verhältnisse in der Äquatorialprovinz und die Stanleysche Expedition geboten.
Dreizehn Jahre hindurch hatte Emin Pascha ohne wesentliche Zuschüsse von der egyptischen Regierung zu erhalten, meist in friedlicher Arbeit die Geschicke des Landes geleitet und dasselbe der Kultur näher gebracht, bis in den letzten Jahren von 1887 an seine Position schwankend geworden war. Es wirkte hierzu besonders der Umstand mit, daß die ihm unterstellten egyptischen Soldaten, welche seit 5 Jahren den Sold von ihrer Regierung nicht erhalten hatten, und gerade in dieser Zeit die Grenzen der Äquatorialprovinz gegen die Scharen des Mahdi in fortwährenden Kämpfen verteidigten, allmählich eine begründete Unzufriedenheit zu zeigen begannen. Ebenso bestand nach Casatis Angabe eine weit verbreitete Unzufriedenheit unter den Offizieren gegenüber den Maßregeln des Gouverneurs. Die Unmöglichkeit, aus eigenen Mitteln und unter den sich steigernden Schwierigkeiten die Provinz zu halten, hatte Emin an die[S. 124] Hochherzigkeit der Engländer appellieren lassen. Dr. Felkin, dem Freunde Emins, war es gelungen, bei einer Reihe englischer Kapitalisten, besonders aber bei Sir William Mackinnon, dem Hauptaktionär der englisch-ostafrikanischen Gesellschaft, Interesse für Emin Pascha oder wohl richtiger für seine Äquatorialprovinz zu erwecken und eine Hilfsexpedition unter Stanleys Kommando ins Werk zu setzen.
Unter Mißachtung der Vorschläge von Schweinfurth und Junker sowie Thompson wählte Stanley bekanntlich die Congoroute. Alle die Nachteile, welche er von dem östlichen, von den genannten Afrikaforschern empfohlenen Wege befürchtet hatte, stellten sich bezüglich der Verpflegung der Karawane, des Gesundheitszustandes, der Desertion von Trägern, der Schwierigkeit des Weges und der Feindseligkeiten der Eingeborenen auf dem von ihm selbst gewählten Wege in weit höherem Maße ein. Im April 1888 erhielt Emin Pascha durch einen Brief Stanleys die erste Nachricht vom Anrücken der Hilfsexpedition, auf die er in der letzten Zeit sehnsüchtig gewartet hatte, und von der er eine Befestigung seiner Macht und Beruhigung der unzuverlässigen Elemente erwartete. Der Pascha faßte den Entschluß, mit Casati Stanley entgegenzuziehen und ihn an der Grenze der Äquatorialprovinz zu erwarten. Auf seinem Dampfer Khedive fuhr der Gouverneur über den Albertsee und in dem Stanleyschen Lager zu Cavalli fand die gegenseitige Begrüßung statt.
Der Pascha erkannte bald, daß durch die Ankunft der Expedition, von der er für sich und insbesondere für sein Verhältnis zu seinen Leuten so viel erwartet hatte, seine Lage wenig verändert wurde. Das Einzige, was der Provinz von Nutzen sein konnte, waren die mitgebrachten Remington-Patronen. Im übrigen litt die Hilfsexpedition selbst Mangel an allem und der Pascha war es, der mit den Vorräten seiner Provinz der englischen Expedition aushelfen mußte. Casati hatte Emin Pascha geraten, ohne Rückhalt zu Stanley über die Lage der Provinz und über die Zerwürfnisse, die zwischen dem Gouverneur und den Parteien eingetreten waren, zu sprechen, sowie seine Ohnmacht nach den Ereignissen der letzten Zeit einzugestehen. Emin hat indes wohl den Rat des Freundes nicht befolgt[S. 125] und es vermieden, sich mit der nötigen Offenheit Stanley anzuvertrauen, vielleicht um seinen Namen vor diesem Manne des ihn umgebenden Nimbus nicht zu entkleiden.
Da Stanley das Gros der Expedition mit den Hauptvorräten im Lager zu Jambuja am Aruwimi, außerdem eine große Anzahl von Kranken im Fort Bodo zurückgelassen hatte, schickte er sich nach verhältnismäßig kurzer Zeit an, wieder nach dem Aruwimi aufzubrechen, um die zurückgebliebenen Leute und Vorräte herbeizuschaffen. Während dieser Zeit sollte der Pascha diejenigen seiner Beamten und Soldaten, welche geneigt wären nach Egypten zurückzukehren, in Cavalli vereinigen, um hier Stanleys Ankunft zu erwarten und mit ihm aufzubrechen. Die Bitte des Pascha, mit ihm die verschiedenen Stationen seiner Provinz auf dem Dampfer Khedive zu besuchen, schlug Stanley ab mit der Begründung, daß er eilig nach Jambuja zurückkehren müsse. Sein Aufenthalt am See dauerte indes ungefähr 4 Wochen. Es ist zu bedauern, daß Stanley auf die Bitte Emins nicht eingegangen ist. Zweifellos wäre das persönliche Erscheinen Stanleys von einer ungleich größeren Wirkung auf die Truppe und die Bevölkerung gewesen. Stanley wäre in der Lage gewesen, die Truppen nicht nur durch die Macht seiner Persönlichkeit, sondern auch durch die bei ihm zur Meisterschaft ausgebildete Art zu verhandeln davon zu überzeugen, daß er im Auftrage ihres Souveräns des Khedive nach der Provinz gekommen sei, um sich mit eigenen Augen von der Lage der Sache zu überzeugen und entweder Hilfe in Gestalt von Munition zurückzulassen oder aber die Leute nach Egypten zu führen.
Wenn man nun Stanley auch nicht ohne weiteres die Verweigerung der Bitte Emins verübeln kann, — hatte er doch das eigentliche Gros der Expedition im Lager bei Jambuja zurückgelassen und fühlte sehr wohl selbst heraus, daß mit dem, was er dem Pascha mitgebracht hatte, gar nichts geleistet sei, — so ist es ebenso als verfehlt zu betrachten, wenn er später auf die wiederholte Bitte Emins, wenigstens einen seiner Offiziere zurückzulassen, Herrn Mounteney Jephson mit dieser Mission beantragte. Jephson hatte nur ganz oberflächliche Kenntnis von den Machtbefugnissen Stanleys, denn bei der[S. 126] Natur Stanleys, welche mit der Verantwortung auch gleichzeitig das Ende aller Fäden in Händen behalten wollte, war thatsächlich keiner seiner Offiziere mit dem ganzen Umfang der Stanleyschen Aufträge bekannt. Jephson war ferner nicht die Persönlichkeit, um selbständig auftreten oder bei irgend welchem Mißtrauen der Leute bindende Versicherungen geben zu können. Die Anwesenheit Jephsons trug zur Verbesserung der Lage der Truppen jedenfalls nicht bei.
Es ist außerordentlich schwierig, ein bestimmtes Urteil über das Verhältnis Emins zu seinen Truppen abzugeben. Alle darüber vorhandenen Veröffentlichungen Stanleys, Casatis, Jephsons lassen den inneren Zusammenhang nicht erkennen und erscheinen lediglich als persönliche Urteile der Verfasser. Emins Ansicht ging und geht auch heute noch dahin, daß durch die Art und Weise des Auftretens der Stanleyschen Expedition die Mißhelligkeiten zwischen ihm und seinen Truppen erst verursacht worden seien. Es ist wahrscheinlich, daß der Pascha sich hierin täuscht und daß Casatis Urteil der Wahrheit am nächsten kommt. Andererseits ist aber nicht zu verkennen, daß die großen Erwartungen, welche Emin selbst bei seinen Soldaten von der Stanleyschen Entsatz-Expedition erweckt hatte, durch das Erscheinen derselben in halb verhungertem und zerlumptem Zustande, sehr herabgemindert wurden, ja daß sogar ein begreifliches Mißtrauen bei den Leuten entstand. Der Umstand, daß Stanley und seine Begleiter Engländer waren, konnte die üble Wirkung auf die Truppe nicht hervorgebracht haben, — war doch Gordon und andere Gouverneure im Sudan durch den Khedive selbst eingesetzt worden. Der ganze Aufstand der Eminschen Truppen macht den Eindruck einer Militärrevolte, welche durch Intriguen sich benachteiligt glaubender Offiziere in Szene gesetzt wurde. Auch der Casatische Bericht läßt dies erkennen; in demselben findet man sogar an eigentlichen inneren Gründen überall nur persönliche Mißgriffe angegeben, welche Emin den Offizieren gegenüber begangen haben soll. In der That herrschte unter einem großen Teil der Leute des Pascha eine bittere Stimmung gegen ihn.
Von einer ganz besonderen Wichtigkeit für uns Deutsche ist das Verhalten Emins Stanley und seinen Anerbietungen[S. 127] gegenüber. Stanley und seine Offiziere versuchten zwar nach ihrer Ankunft am Albertsee und auch später auf dem ganzen Marsche beim Pascha den Glauben zu nähren, als ob die Expedition lediglich aus humanitären Rücksichten seinetwegen und für die mit ihm von Egypten abgeschnittenen Beamten und Truppen unternommen worden sei. Niemand wird bestreiten, daß viele, ja die meisten Mitglieder des englischen Emin Pascha-Entsatz-Komitees von rein humanitären Rücksichten geleitet wurden. Aber es gab in diesem Comité doch eine Reihe von Namen, deren Träger zu eng mit afrikanischen Interessen verknüpft waren, um nicht gewisse praktische Nebenabsichten, sei es auf die Person Emins, sei es auf seine Provinz oder auch auf beides zusammen, vermuten zu lassen. Es sind dies die Mitglieder der englisch ostafrikanischen Gesellschaft, denen ein Mann wie Emin und eine Provinz wie die seine notwendig als höchst begehrenswerte Ziele erscheinen mußten.
In der That wird diese Absicht einer Gebietserweiterung der englisch-ostafrikanischen Gesellschaft durch die dem Pascha von Stanley gemachten Anerbietungen bestätigt. Stanley hatte nach seinem eigenen Bericht und nach der Erzählung Emins diesem drei Vorschläge zu machen. Der erste derselben war, — dem vom Khedive erhaltenen Auftrage gemäß, — die Provinz aufzugeben, mit dem Teil der Offiziere, Soldaten und Beamten und ihren Familien, welche die Rückkehr nach Egypten wünschten, unter Führung Stanleys aufzubrechen und diesem nach Egypten zu folgen.
Das zweite Anerbieten machte Stanley im Namen des Königs der Belgier. Emin sollte, falls er es vorzöge, in seiner Provinz zu bleiben, seine Dienste dem Kongostaat widmen und sein Land als Vorposten dieses Staates gegen den Sudan halten. Als Verwaltungskosten wollte der Kongostaat hierfür jährlich circa 240000 Mark aufwenden. Dem Pascha, welchem die Stellung eines Generalgouverneurs mit dem Range eines belgischen Generals angeboten wurde, wurde ein Jahresgehalt von 1500 Pfd. St. ausgesetzt.
Das dritte Anerbieten, von dem Stanley allerdings behauptete, daß er zu demselben nicht direkt ermächtigt sei, sondern daß er es nur mache in der Absicht, dem Pascha zu[S. 128] helfen und in der zuversichtlichen Erwartung, daß seine Abmachungen vom Comité und der englisch-ostafrikanischen Gesellschaft genehmigt würden, zielte auf folgendes ab: Wenn die Soldaten sich weigern sollten, nach Egypten zurückzukehren, so sollte Emin die zuverlässigsten unter ihnen nach der Nordost-Ecke des Viktoria-Nyanza führen und dort eine feste Station für die englisch-ostafrikanische Gesellschaft begründen. Stanley würde mit seiner Expedition selbst die Station vollenden helfen, die Munition und mitgenommenen Vorräte dorthin bringen lassen und erst dann mit seiner Hilfsexpedition den Pascha verlassen, wenn dessen Stellung eine gesicherte sei. Der Pascha sollte ein gutes Jahresgehalt von der Gesellschaft beziehen und als Gouverneur das Netz der Stationen vom Viktoriasee nach Mombassa hin vorschieben, während andererseits der Vertreter zu Mombassa durch Vordringen von der Küste aus dem Pascha in die Hände arbeiten würde.
Die Lage Emins diesen Vorschlägen gegenüber war keine leichte. Seine Hoffnungen auf genügende Unterstützung durch die Stanleysche Expedition waren zerstört, ein Verbleiben in der Provinz mit den vorhandenen Kräften legte nach dem Ferman des Khedive dem Pascha allein alle Verantwortung für jetzt und die Zukunft auf die Schultern, die Disziplin der Truppen, ohnehin erschüttert, war durch das Erscheinen der Stanleyleute in ihrem kläglichen Zustande noch mehr in Frage gestellt.
Wenn ein Teil der Truppen geneigt schien, dem Schreiben des Khedive Glauben zu schenken und mit Stanley abzuziehen, so standen diesen mindestens ebensoviel Stimmen gegenüber, welche von Verrath, Verkauf an England u. dergl. mehr sprachen. Immer aber blieb die Verantwortung allein dem Pascha überlassen. Es kann nicht Wunder nehmen, wenn unter solchen Verhältnissen eine definitive, einheitliche Entscheidung unmöglich schien, wenn eine anscheinend unverhältnismäßige Zeit im Parlamentieren verstrich. Dem Pascha kann man daher auch nicht ganz Unrecht geben, wenn er den Ausbruch der bekannten Militärrebellion lediglich auf diesen Zwiespalt der Meinungen innerhalb seiner Truppen zurückführt, da er eben eine Macht auf dieselben nicht mehr hatte. Der weitere Verlauf ist bekannt.
[S. 129]
Ende Januar 1889 kamen Boten von Stanley an mit der Nachricht seiner Ankunft am Südwestufer des Albert Nyanza. In den Briefen an den Pascha und Jephson machte Stanley insbesondere Jephson heftige Vorwürfe, daß dieser weder allein noch mit Emin nach Cavalli gekommen sei, um dort von der endgültigen Entscheidung Emins Mitteilung zu machen, wie auch, daß jener nicht, wie verabredet, Soldaten und Lebensmittel für den Küstenmarsch in Cavalli vereinigt habe. In Anbetracht der Verhältnisse wie der inzwischen erfolgten Gefangennahme waren diese Vorwürfe natürlich durchaus unbegründet, da dem Pascha jede Aktionsfreiheit genommen war und ihm wohl nicht die Möglichkeit offen stand, willkürlich seinen Aufenthaltsort von Tunguru nach Cavalli zu verlegen.
Alles, was die Stanleysche Expedition dem Pascha jetzt zuführen konnte, waren 30 Kisten Remington-Patronen und ein großer Teil egyptischer, durch den Transport schlecht gewordener Uniformen. Die Lage der Äquatorialprovinz war natürlich hierdurch um nichts geändert.
Nachdem Stanley Kenntnis von den Vorfällen in der Provinz während der Zeit seiner Abwesenheit erhalten hatte, wäre es, so ist häufig behauptet worden, seine Pflicht gewesen, Emin Pascha in seiner Provinz aufzusuchen und hätte er sich nicht darauf beschränken dürfen, Jephson den Befehl zu schicken, ins Lager der Hilfsexpedition zu kommen, und dem Pascha anheimzugeben, falls er nach Egypten zurückkehren wolle, mit den ihm gleich Gesinnten in spätestens 20 Tagen nach Cavalli zu marschieren. Ob Stanley richtig gehandelt hat oder nicht, ist schwer zu entscheiden. Es ist sehr wohl möglich, daß wenn er nach den andern Stationen der Provinz geeilt wäre, sich durch das Erscheinen seiner Expedition bei der Unzuverlässigkeit und der offenen Feindseligkeit vieler Offiziere die Lage noch verworrener gestaltet hätte, als sie ohnehin schon war.
Ein Teil der Aufständischen in der Provinz, namentlich der Egypter, welche die Absicht hatten, in ihre Heimat zurückzukehren, wandte sich jetzt an den Pascha mit der Bitte, zwischen ihnen und Stanley zu vermitteln. Infolgedessen wurden die zur Rückkehr bereiten Mannschaften im Stanleyschen Lager vereinigt.
[S. 130]
Der Tag des Abmarsches wurde endlich nach vielem Hin- und Herdebattieren endgültig auf den 10. April 1889 festgesetzt und so befand sich Emin in dem moralischen Zwange, entweder Stanley unbedingt zu folgen mit einem Teil seiner Leute oder aber hier zu bleiben und dadurch dem andern Teil gegenüber wortbrüchig zu erscheinen.
Der Pascha empfand diese Zwangslage sehr bitter, und es erschien ihm persönlich trotz der Rebellion gegen ihn als eine Untreue gegen die Zurückbleibenden, wenn er Stanleys Vorschlag annahm. Er entschied sich erst, als das fast einstimmige Urteil der Europäer und seiner um ihn versammelten Offiziere ihn über seine Gewissensbisse beruhigte. Der Einzige, welcher jetzt gegen den Entschluß des Aufbruchs sich aussprach, war Casati. Die Gründe aber, die er selbst in seinem Buch angiebt, können nicht als stichhaltige anerkannt werden.
So brach denn nun am 10. April die Expedition auf. Von Seiten des Pascha kamen hinzu 182 Männer und 369 Frauen und Kinder, die nach Egypten zurückkehrten und insgesamt 397 Lasten mit sich führten. Eine größere Anzahl von Trägern war aus der Äquatorialprovinz gestellt. —
Nach dieser notwendigen Abschweifung wenden wir uns wieder nach Mpapua zurück.
Es wurde bereits unserer Dyssenteriekranken zu Mpapua Erwähnung gethan. Die Ankunft der Stanleyschen Expedition brachte uns Gelegenheit, die schwer erkrankten Patienten, besonders den Lieutenant v. Medem und den Unteroffizier Kröhnke sachverständiger zu behandeln, als es bis dahin hatte geschehen können.
Emin Pascha und Dr. Parke nahmen sich sofort in der hilfsbereitesten Weise der Kranken an. Der Pascha, dessen erster Gang gleich dem gerade damals in der bedenklichsten Weise kranken von Medem galt, traf persönlich alle Anordnungen und belehrte mich und besonders den in Mpapua zurückbleibenden Feldwebel Hoffmann über die richtige Behandlung der Dyssenterie. Unsere eigene Methode war ebenso, wie die der englischen Missionare, eine ganz verkehrte gewesen. Wir hatten das Hauptmittel gegen diese Krankheit, Ipecacuana, in großen statt in kleinen Dosen angewandt, so[S. 131] daß es nicht als Stopfmittel, sondern als Brechmittel wirkte, wie es unter Umständen beim Fieber angewandt wird.
Es ist besonders anzuerkennen, daß Stanley sofort und gern sich bereit erklärte, den Weitermarsch seiner Expedition im Interesse der gefährlich erkrankten Deutschen der Station so lange aufzuschieben, bis eine merkliche Besserung in dem Befinden derselben eingetreten und begründete Aussicht auf vollkommene Genesung der Patienten vorhanden sei.
Beim Aufbruch der Expedition war Lieutenant von Medem bedeutend gestärkt und auf dem Wege der Besserung, Kröhnke konnte bereits ausgehen und der Verfasser, der am leichtesten erkrankt war, war vollkommen marschfähig.
Allerdings bekam ich unterwegs noch einen Rückfall, von dem mich aber ein vom Pascha und den französischen Missionaren empfohlenes Radikalmittel, zweimalige Anwendung eines Klystirs von Karbollösung (15 Tropfen Karbolsäure auf 1/2 l Wasser) schnell und vollkommen wieder herstellte.
Leider bekam auch von Medem etwa 14 Tage später, nachdem er bis dahin in erfreulicher Besserung gewesen war, einen Rückfall. Die angewandten Mittel halfen nichts mehr, und er erlag der Krankheit, im Innern Afrikas das erste Opfer unter den Europäern der Wißmannschen Schutztruppe. Diese hatte in ihm einen verdienten energischen Offizier und das Offizierkorps derselben einen der besten Kameraden zu betrauern.
Während der Rasttage der Expedition zu Mpapua standen alle europäischen Mitglieder derselben, gleichviel ob Engländer, Italiener, Franzosen oder Deutsche, in ungezwungenstem geselligen Verkehr mit der Station. Wir boten ihnen Gelegenheit, sich die Station, die Soldaten beim Exerzieren, bei ihren Nationaltänzen, bei der Arbeit u. s. w. anzusehen und ernteten einstimmiges Lob.
Am 13. November früh fand der Aufbruch von Mpapua zur Küste statt. Da es mir oblag, die Expedition durch das deutsche Gebiet nach der Küste zu führen, in der Vertretung des Reichskommissars die Interessen der Eingeborenen, unserer Schützlinge, im Auge zu haben und gleichzeitig der Expedition[S. 132] Stanleys auf jede mögliche Weise Vorschub zu leisten, so brach ich mit zehn Sudanesen und drei Trägern für mein Gepäck, Zelt, Kochgeschirr u. s. w., an der Tête der ganzen Kolonne, selbstverständlich unter deutscher Flagge, auf und behielt folgende Marschordnung bis zur Küste bei. Hinter meinen Leuten folgte in der Regel Casati, der mich, nachdem er in Mpapua in freundschaftlichen Verkehr mit mir getreten war, gebeten hatte, vorn bei meiner Expedition marschieren und der deutschen Flagge als der Flagge einer befreundeten Nation folgen zu dürfen. Hinter diesem fanden sich dann in der Regel einige Weiber aus der Karawane der Eminschen Offiziere und Beamten ein, darunter einige wirklich hübsche, ziemlich hellfarbige Gesichter. Dann folgte die kleine Karawane der französischen Missionare, hierauf Stanley mit Emin und seiner Expedition in der früher bereits erwähnten, von ihm gewöhnlich befolgten Marschordnung. Später schlossen sich dann mir von Usagara an in jedem Dorfe noch eine Menge Eingeborene an, da der Weg damals noch nicht als ganz sicher nach der Küste galt und sie die Macht der nach Bagamoyo rückenden Expedition zu ihrem eigenen Schutze benutzen wollten. Diese kleinen, von den verschiedenen Dörfern Usagaras und Ukamis mitziehenden Karawanen, die sämtlich kleine deutsche Karawanenflaggen mit sich führten, verstärkten die Expedition im ganzen um über 1200 Mann.
Wie in Mpapua, so gestaltete sich auch auf der Expedition der Verkehr mit den Europäern zu einem äußerst angenehmen, besonders auch mit Stanley, der gegen den Verfasser stets die größte Liebenswürdigkeit zeigte und der auch stets der besten Laune war. Der Verkehr mit ihm bot sehr viel Anregendes, da Stanley stets in seiner lebhaften Weise vieles aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen über seine Reisen zum Besten gab. Über seine Offiziere, die ihn während des letzten Zuges zur Befreiung Emins begleitet und mit ihm Afrika durchquert hatten, äußerte sich Stanley wiederholt zum Verfasser aus freien Stücken auf das anerkennendste. Manche Schwierigkeiten, die während des Marsches durch Reibereien der Sansibariten Stanleys mit den Eingeborenen oder den Sudanesen entstanden, wurden stets durch die Intervention[S. 133] Stanleys und des Verfassers beigelegt und kann auch in dieser Beziehung das Entgegenkommen Stanleys nur anerkannt werden. Verfasser sieht sich veranlaßt, bei den sonstigen in dieser Beziehung vielfach erhobenen Vorwürfen gegen Stanley gerade dieses hervorzuheben.
Dem deutschen Offizier mußte während dieser Expedition die Thatsache besonders auffallen, daß jeder der englischen Offiziere auf dem Marsche seinen eigenen Haushalt führte. Jeder einzelne ließ für sich allein kochen und aß allein, während es bei uns als selbstverständlich gilt, daß das Leben und die Mahlzeiten nach Möglichkeit gemeinsam geführt werden und der einzelne sich der Allgemeinheit unterordnet. Daß der Pascha allein für sich lebte, da seine Mahlzeiten in türkischer Weise bereitet wurden und er auch für seine Tochter zu sorgen hatte, daß ebenso die französischen Missionare und Casati für sich lebten, war ja eher verständlich. Indessen wurde die Geselligkeit dadurch erhöht, daß wir uns auf dem Marsche häufig gegenseitig zu den Mahlzeiten einluden und jeder das, was er hatte, gern mit den andern teilte. Auch wurden teils von Stanley, teils von mir, besonders nachdem wir Proviant und Getränke von der Küste erhalten hatten, gemeinsame Mahlzeiten arrangiert, bei denen wir, die Vertreter verschiedenartiger Nationen, auf das geselligste verkehrten.
Einer der angenehmsten Gesellschafter, desgleichen zweifellos eine der hervorragendsten Persönlichkeiten unserer Karawane war der nun verstorbene Pater Schynse. Von hohem Wuchs, angenehmem, sanftem und gewinnendem Gesichtsausdruck merkte man ihm, sobald er zu sprechen anfing, an, daß man es mit einem Manne von unbeugsamer Energie, schnellem Entschluß und großer Thatkraft zu thun hatte. Man konnte meinen, man hätte einen jener alten Mönche vor sich, welche, ohne im Glaubenseifer erstarrt zu sein, die Kulturträger in allen Staaten Europas gebildet haben. Solcher Gestalten trifft man viele in Ostafrika. Der alte Père Étienne in Bagamoyo, der Bruder Oskar, der Père Delpèche, der Pater Bonifacius sind Männer, welche niemand vergessen wird, der je zu ihnen in Beziehung trat. Bei allen[S. 134] begegnete man gleichmäßig einem tiefen Verständnis für Land und Leute, sowie für die politischen Verhältnisse. Alle zeichneten sich durch gleiche Offenheit und Ehrlichkeit in Bezug auf die von ihnen erreichten oder erstrebten Erfolge aus, wenn das Gespräch darauf kam. Nie fielen sie jemandem durch ihre Religionsübungen lästig. Daß der eine oder andere, wie besonders der Bischof Monseigneur de Courmont und der Pater Schynse durch ihre geistigen Eigenschaften hervorragten, verlieh dem Verkehr mit ihnen besonderen Reiz. Dabei waren die meisten dem geselligen Leben und körperlichen Uebungen sehr zugethan; einzelne unter ihnen zeichneten sich durch besondere Passion für das edle Waidwerk aus, wie Schynse und Bruder Oskar, deren Büchse manches Wild in Afrika zum Opfer fiel.
Unser erster Marsch führte uns, nachdem wir die östlichen Hügelketten von Ugogo passiert hatten und auf der andern Seite in das Thal von Tubugue hinabgestiegen waren, zu dem gleichnamigen Dorfe der wohlbewässerten Landschaft. Dort angekommen, suchte der Verfasser einen Lagerplatz für die gesamte Expedition aus, ebenso Plätze für die Zelte Emins, Stanleys, Casatis, der englischen Offiziere, der französischen Missionare, für unsere Soldaten, die Kompagnien Stanleys, die Träger und die Lasten. Stanley selbst erklärte sich, nachdem eine prinzipielle Einigung über die Dauer der täglichen Märsche erzielt worden, von vornherein mit allen speziell von mir getroffenen Anordnungen einverstanden. Er hatte ursprünglich eine Vorliebe für die Mamboia-Route gehabt, hatte aber den Vorstellungen des Verfassers, der die zwar etwas längere Straße über Kondoa wegen der hier leichteren Ernährung der großen Karawane empfahl, nachgegeben. Der Gabelpunkt der beiden Straßen, der Mamboia- und der Kondoa-Route, war bereits am ersten Marschtage dicht bei Tubugue passiert. Es erfolgte Tags darauf der Weitermarsch nach Dambi.
Das hier bezogene Lager, an einem Waldbächlein unter schattigen Bäumen wildromantisch gelegen, gefiel Stanley so gut, daß er den Pater Schynse bat, von demselben zur Erinnerung für ihn und die Expeditionsmitglieder eine Photographie[S. 135] aufzunehmen. Er bat den Pascha und mich, mit ihm in die Mitte zu treten, um uns herum gruppierten sich die übrigen Europäer. Leider erwies sich die Platte als zu alt und feucht, um eine gute Photographie hervorzurufen. Besser fiel ein später in Msua von Schynse gemachter Versuch aus, der den Mitgliedern der Expedition eine lebendige Erinnerung an jene interessante Zeit darbot.
In den nächsten Tagen wurden die hohen, dem Mukondogua-Thal vorgelagerten Usagara-Berge passiert und dann das Mukondogua-Thal erreicht. Von diesem Thale ab begann wieder ein durchaus friedlicher Verkehr mit der Bevölkerung des Landes, die sich von nun an stets sehr zutraulich erwies und zunächst durch Abgesandte mit dem Verfasser in Verbindung trat. Die Jumbes kamen uns meist schon unterwegs entgegen, zeigten ihre Schutzbriefe vor, hißten in den Ortschaften die deutsche Flagge und fragten nach unseren Anordnungen. Die Verpflegung der großen Karawane geschah auf diese Weise ohne Schwierigkeiten und die Eingeborenen bezeigten ihren guten Willen noch dadurch, daß sie den Europäern überall Erfrischungen, in Gestalt des Pombe, des einheimischen Bieres aus Hirse anboten.
Im Mukondogua-Thal, das wir gerade in der schönsten Zeit passierten, als die alljährlichen Grasbrände vorüber waren und die Landschaft im jungen Grün erblühte, äußerte Stanley seine Befriedigung darüber, daß er sich auf seiner ersten Reise in seinem Werk so günstig über die Fruchtbarkeit Usagaras ausgesprochen habe. Allerdings nimmt dieselbe abseits von den Flußthälern bedeutend ab, und es ist hier in den Bergen nicht überall lohnender Boden zum Anbau von wertvollen Produkten zu finden.
In Muinisagara wurde ein Rasttag von den französischen Missionaren dazu benutzt, einen Besuch in Longa, einer Station der katholischen Mission vom heiligen Geist zu machen. Die dortigen Brüder sandten uns in ihrer gastfreien Weise Gemüse aus ihrem Garten und einiges von dem wenigen, was sie sonst hatten, wie Wein und Brot.
Hinter Kondoa verließen wir den Lauf des Mukondogua und traten in die Makata-Ebene ein, wo wir mehrere Flüsse,[S. 136] zunächst den Makatafluß, den Wiansibach und den Gerengere passierten. Der Verfasser persönlich hatte Gelegenheit auf dem Marsche in diesem wildreichen Thale eine größere Anzahl großer und kleiner Antilopen, darunter eine Elenantilope, zur Strecke zu bringen. — Stanley erzählte bei dieser Gelegenheit, daß, als Verfasser dicht bei Udewa hinter einander mit seiner Doppelbüchse von einem Fleck aus 5 Swala-Antilopen niedergestreckt hatte, ihm seine Leute gesagt hätten, wenn von den Deutschen immer so geschossen würde, dann würden von Buschiris Rebellen bald nur wenige noch übrig sein. In Makata erreichte uns eine große bereits vorher angekündigte Proviantkarawane, welche der Reichskommissar mir besonders für Emin Pascha, Stanley und die Expedition gesandt hatte, so daß von da an bis zur Küste, namentlich da auch Stanley mehrere Tage später von seinem englischen Comité noch viel Proviant erhielt, geradezu Üppigkeit und Überfluß bei uns herrschten.
Nachdem wir dann noch in Morogro die dortige französische Missionsstation zu besuchen Gelegenheit hatten, ging es über die Berge von Ukami nach Msua. Dort trafen wir die Expedition des Freiherrn von Gravenreuth, der von Wißmann zur Bestrafung der rebellischen Ortschaften auf einige Wochen ins Innere geschickt worden war und zugleich den Auftrag hatte, wenn er sie treffen sollte, die Stanleysche Expedition willkommen zu heißen und Grüße vom Reichskommissar zu übermitteln. Das Wiedersehen wurde bei einer gemeinsamen Tafel gefeiert, bei welcher uns die vorher von Wißmann geschickten Vorräte trefflich zu statten kamen.
Der Gravenreuthschen Karawane hatten sich mit seiner Erlaubnis zwei amerikanische Reporter, darunter auch der vom Newyork-Herald, Visitelli, angeschlossen, welche seit geraumer Zeit in Sansibar auf die Ankunft Stanleys und Emins lauerten und sich gegenseitig das Leben sauer machten. Noch an demselben Tage gingen Boten mit langen Telegrammen über die Expedition nach der Küste ab, und der Draht trug die Nachricht über die ganze zivilisierte Erde.
Während Gravenreuth dann weiter nach Westen zog, folgten natürlich die Reporter mir und der Expedition und es[S. 137] wurden ihnen in den nächsten Tagen auch immer wieder Boten zur Verfügung gestellt, um ihre Zeitungen mit Nachrichten über die Weiterbewegung der Expedition zu versehen. Visitelli selbst hatte vom Reichskommissar die Erlaubnis erhalten, die amerikanische Flagge zu Ehren Stanleys bei der Begrüßung in der Expedition mitzuführen. Im übrigen vermehrte er die Zahl der angenehmen Gesellschafter in der Expedition, denn er verband mit einer rührenden Anhänglichkeit an anregende Getränke eine vorzügliche Laune.
Am 4. Dezember Vormittags kamen wir am Kingani an, bis wohin uns der Reichskommissar persönlich entgegen geritten war. Hier erfuhren wir von ihm selbst seine inzwischen erfolgte Beförderung zum Major. Auf den von Wißmann mitgebrachten Pferden und Maultieren ritten sodann dieser selbst, Emin Pascha, Stanley, Casati und der Verfasser der Expedition voraus nach Bagamoyo, während die französischen Missionare nachfolgten und Lieutenant Stairs die Stanleysche Expedition am Nachmittage nach Bagamoyo hineinführte.
Die Station war für den Empfang der Gäste festlich geschmückt, und Salutschüsse aus ihren Geschützen wie den auf der Rhede liegenden Kriegsschiffen begrüßten die Reisenden. Der Korvettenkapitän Voß, damals der älteste Kommandant der in Ostafrika stationierten Kriegsschiffe, kam im Auftrage S. M. des deutschen Kaisers, um Stanley und Emin zu beglückwünschen. Auch die Engländer hatten zu dem gleichen Zwecke ein Kriegsschiff und eine Deputation vom Generalkonsulat entsandt.
In den Räumen des sogenannten Ratuhauses, welches als Messe hergerichtet war, wurde das Frühstück serviert, dem besonders von uns eifrig zugesprochen wurde. Emin selbst machte seinen Studentenjahren alle Ehre; er zeigte sich über den ihm zu Teil gewordenen Empfang und das so lange entbehrte Zusammensein mit den Deutschen, die mit Stolz auf ihn blickten, sehr erfreut. Die Verehrung und Begeisterung, welche ihm von allen Seiten entgegengetragen wurden, seine Zuvorkommenheit und sein Bestreben, jedem freundlich Rede zu stehen, läßt es nicht Wunder nehmen, daß der Pascha bis zu dem um 6 Uhr beginnenden Diner, das[S. 138] den Reisenden zu Ehren vom Reichskommissar gegeben wurde, wacker durchhielt.
Der Verlauf dieses Festessens und sein trauriger Abschluß ist ja bekannt.
Obwohl dem Sekt reichlich zugesprochen wurde und die Wogen der Begeisterung hoch genug gingen, war doch von irgend einem Übermaß nichts zu bemerken. Auch bei Emin war, wenn er sich auch natürlich durch die genossenen Getränke und die Aufregung des Tages so zu sagen in etwas vorgerückter Stimmung befand, von Trunkenheit, wie man wohl angenommen hat, keine Rede. Nach Aufhebung der Tafel begab er sich, um auszuruhen, in ein neben der Messe gelegenes Zimmer. Als er dieses bald darauf wieder verlassen wollte, sah er bei seinem schwachen Augenlicht ein Fenster mit sehr niedriger Brüstung für die offene Thür an, stolperte über die Brüstung und stürzte hinaus. Nur dem Umstande, daß er zunächst auf ein Wellblechdach fiel und dann erst auf die harte Erde, wie seiner guten Natur und der überaus sorgsamen Pflege, die ihm zu Teil wurde, ist es zuzuschreiben, daß sein Leben erhalten blieb.
Major Wißmann, Stanley mit seinen Offizieren, Casati und ich saßen noch an der Tafel zusammen, als ein Neger heraufkam und uns die Mitteilung machte, daß ein Europäer unter jenem Fenster blutüberströmt auf der Straße in bewußtlosem Zustande gelegen habe, und daß die Eingeborenen eben im Begriff seien, ihn nach dem Lazarett zu bringen; er glaube, der Verunglückte sei der Pascha. Wißmann, Stanley und ich brachen natürlich sofort auf und kamen gerade im Lazarett an, als Dr. Brehme, der Stationsarzt von Bagamoyo, der eben von einer Revision der Wachen zurückgekehrt war, mit Schwester Auguste Herzer und Fräulein von Borcke dabei war, den Pascha zu untersuchen. Er gab uns wenig Hoffnung. Am nächsten Tage berieten gemeinsam die anwesenden Ärzte über die Behandlung des Schwerverletzten; es waren dies außer Dr. Brehme der Assistenzarzt Dr. Lotsch von S. M. S. »Sperber« und Dr. Parke von der Stanleyschen Expedition. Die Ansicht der deutschen Ärzte ging dahin, daß ein Bruch der Schädelbasis vorliege und im großen und[S. 139] ganzen die Aussicht, Emin am Leben zu erhalten, eine ziemlich geringe sei, während Dr. Parke die Verletzungen für weniger schwer und für nur äußerlich erklärte.
Es erscheint, wie dem Verfasser von Ärzten mitgeteilt wurde, ganz unverständlich, wie Dr. Parke sich gegenüber den klar hervortretenden Symptomen seine Ansicht hat bilden können. Der Blutausfluß aus dem Ohre, die mehrtägige Bewußtlosigkeit, endlich Lähmungserscheinungen im Gesicht sprachen mit so großer Deutlichkeit, daß die Diagnose des Hospitalarztes Dr. Brehme unumstößlich feststand. Es griff die Annahme Platz, daß politische Momente für Stanley maßgebend waren, den Transport Emins nach Sansibar auf jede Gefahr hin möglich erklären zu lassen. Der gesamte spätere Heilungsverlauf bestätigte die deutsche Diagnose, obwohl die Heilung selbst mit einer die deutschen Ärzte überraschenden Schnelligkeit vor sich ging. Sie ist wesentlich dem Umstande zuzuschreiben, daß infolge des Vorschlags der Ärzte auf Anordnung Wißmanns einer der kleinen Dampfer des Reichskommissariats täglich von Sansibar nach Bagamoyo Eis für den Kranken brachte. Von einer Übersiedelung desselben nach Sansibar, die Stanley wünschte und Dr. Parke auf Grund seiner optimistischen Ansicht für möglich erklärte, wurde Abstand genommen, da sich die deutschen Ärzte entschieden dagegen aussprachen.
Am zweiten Tage nach dem Unfall wurde die Stanleysche Expedition nach Sansibar übergeführt, und zwar Stanley mit seinen Leuten auf den deutschen Kriegsschiffen »Sperber« und »Schwalbe«, die Leute des Pascha auf englischen Schiffen. Casati zog es vor, bei seinem alten Freunde und Leidensgenossen in Bagamoyo zu bleiben und siedelte erst später nach Sansibar über, als der Zustand Emins keinen Anlaß mehr zu Befürchtungen bot.
Emin Pascha, mit welchem ich naturgemäß während des Marsches zur Küste in engere Beziehungen getreten war, hatte gewünscht, mich in Bagamoyo in seiner Nähe zu behalten und so übertrug mir bis auf weiteres der Kommandant die bisher von Gravenreuth verwaltete Stellung des Distriktschefs im Küstenbereich von Bagamoyo, welche wegen Gravenreuths Abmarsch[S. 140] ins Innere unbesetzt war. Dieselbe umfaßte die Stationen Bagamoyo unter Hauptmann Richelmann und Daressalam unter Chef Leue.
Die deutschen Ärzte forderten, daß alle äußeren Einwirkungen nach Möglichkeit vom Pascha ferngehalten werden sollten, auch Besucher, die vielleicht auf seine Zukunft bestimmend einzuwirken versuchen und ihn so erregen könnten. Eine Einigung mit Dr. Parke war nicht zu erzielen. Da indes die deutschen Ärzte die Majorität hatten, und im Grunde doch Dr. Brehme als Chefarzt des Lazaretts die Hauptverantwortung trug, beschloß ich, nach ihrem Dafürhalten zu handeln und ordnete an, daß die von Dr. Brehme und Dr. Lotsch getroffenen Maßregeln aufs strikteste innegehalten würden, und der Pascha nur Besuche empfangen dürfe, welche der Chefarzt für zuträglich hielt. Als nach einigen Tagen Emin zum Bewußtsein kam und sein Zustand eine, wenn auch langsame Wendung zum Besseren nahm, erklärte er sich selbst hiermit vollkommen einverstanden. Speziell wurde der englische Generalkonsul Sir Evan Smith, welcher mit seiner Gemahlin dem Pascha im Lazarett die Aufmerksamkeit eines Besuches erweisen wollte, von Wißmann, dem ich über meine Anordnungen nach Sansibar berichtete, und der persönlich oft nach Bagamoyo kam, um sich des Pascha in jeder Weise anzunehmen, bewogen, von seinem Vorhaben Abstand zu nehmen. Erst etwa vierzehn Tage nach dem Unfall wurde im Beisein Wißmanns und der Ärzte, sowie in meiner Gegenwart dem Generalvertreter der englisch-ostafrikanischen Gesellschaft, Mackenzie, wie einigen Offizieren Stanleys und dem Kapitän eines zur Abholung Emins und der Sudanesen vom Khedive geschickten egyptischen Dampfers gestattet, den Pascha auf einige Minuten zu besuchen, wobei jedoch politische Erörterungen, die wohl besonders von Mackenzie beabsichtigt waren, unterbleiben mußten.
[S. 141]
Gerücht von einem Vorstoß Buschiris nach der Küste. — Gravenreuth trifft Vorkehrungen dagegen. — Nachricht, daß Buschiri mit mehreren tausend Mafiti Usaramo verwüstet. — Die Marine besetzt Bagamoyo und Daressalam. — Marsch des Expeditionskorps unter Gravenreuth gegen Buschiri. — Marschbefehle. — Buschiri angeblich bei Wasinga. — Wasaramo als Hilfstruppen. — Greuel der Mafiti. — Wasinga verlassen. — Abteilung Bülow trifft nicht ein. — Zusammentreffen mit den Mafiti bei Jombo. — Gefecht bei Jombo. — Einnahme der Mafiti-Lager. — Zersprengung der Mafiti. — Buschiri entkommt. — Wegen Munitionsmangel Rückkehr nach Bagamoyo. — Abteilungen Richelmann und von Bülow noch im Innern. — Gravenreuth bricht wieder dahin auf. — Rückkehr der Abteilungen nach Daressalam.
Zur Zeit, als sich Wißmann noch in Mpapua befand, drangen Gerüchte nach Bagamoyo, daß Buschiri, der im Innern, besonders unter den Mafiti und Wahehe, zahlreiche Anhänger gefunden habe, wieder im Vorrücken nach der Küste begriffen sei. Er solle die Ansicht hegen, daß nach der Entfernung Wißmann's mit dem Expeditionskorps von der Küste diese von Truppen entblößt sei und daß sich infolgedessen für ihn günstige Gelegenheit zu einem Handstreiche biete. Obwohl dieser Fall ja, wie früher erwähnt wurde, von vornherein von Wißmann für durchaus möglich gehalten und in Erwägung gezogen war, maß man zunächst den Nachrichten wenig Glauben bei; für alle Fälle aber traf der Stellvertreter Wißmanns, Chef v. Gravenreuth, die nötigen Vorkehrungen. Durch die Anordnungen des Reichskommissars war er in den Stand gesetzt, die von vornherein aus den Stationen für etwaige kleinere Expeditionen und Angriffe abgeschiedene Spezialreserve noch[S. 142] durch Abkommandierung von Truppen aus den nördlichen Stationen zu verstärken und so ein größeres Expeditionskorps zu formieren. Diese Vorkehrungen Gravenreuths erwiesen sich als durchaus zweckmäßig, denn es wurde bald durch Kundschafter und durch die von allen Ecken und Enden nach Bagamoyo herbeiströmenden Wasaramo die Nachricht vom Anrücken Buschiri's bestätigt und noch dahin erweitert, daß dieser mit mehreren Tausenden Mafiti einen großen Teil der Ortschaften Usaramos verwüstet und massenhaft Leute hingemordet, auch nicht einmal die unmenschlichen Grausamkeiten und Scheußlichkeiten der Mafiti, welche diese zu verüben pflegen, verhindert habe. Gravenreuth bat um Unterstützungen, die ihm auch gewährt wurden: die Marine besetzte Bagamoyo und Daressalam, was Gravenreuth ermöglichte, mit dem gesamten Expeditionskorps zu operieren.
Dieses Expeditionskorps formierte Gravenreuth in drei Abteilungen. Die Führung der einen übernahm er selbst, marschierte von Daressalam über Pugu und Kola auf Usungula zu, um von dort aus auf Wasinga und Jombo vorzudringen, wo Buschiri den Aussagen der flüchtigen Wasaramo nach sich verschanzt haben sollte.
Eine zweite Kolonne sollte unter Führung des Herrn von Bülow von Bueni halbwegs Madimola marschieren, um zu verhüten, daß die Mafiti nach dem Süden hin, speziell nach Daressalam zu ausbrächen.
Die dritte Abteilung unter Hauptmann Richelmann sollte sich nach Dunda wenden, dort die Kingani-Ebene beobachten und Patrouillen nach Madimola, Usungula und Jombo entsenden, um so die Fühlung mit der Abteilung Gravenreuth aufrecht zu erhalten. Beide Abteilungen sollten am 18. früh auf Jombo marschieren, welchen Ort dann alle drei Kolonnen vereint angreifen sollten.
Die einzige Kolonne, welche Gefechte zu bestehen hatte, war die des Herrn von Gravenreuth, deren Verlauf wir jetzt darstellen wollen:
In der Nacht vom 15. zum 16. marschierte die Abteilung von Daressalam mit Magnesia-Fackeln ab. Die Abteilung bestand aus ca. 90 Sudanesen, Zulus und Suaheli, von Europäern befanden sich bei derselben Lieutenant von[S. 143] Perbandt, von Behr, von Frankenberg, Albrecht, Schiffsoffizier Wiebel und verschiedene Unteroffiziere. Da in Eilmärschen marschiert werden sollte, war für Proviant fast garnicht gesorgt und nur genügende Munition mitgenommen.
Die Abteilung legte in zwei Tagen fast 100 Kilometer zurück. Unterwegs empfing von Gravenreuth verschiedene Meldungen über die Stellung Buschiris, welche alle mit mehr oder weniger Bestimmtheit Wasinga als das Hauptlager Buschiris angaben. Gravenreuth forderte die flüchtigen und in den verschiedenen Ortschaften ansässigen Wasaramo auf, seine Abteilung zu begleiten, verteilte auch einige dazu mitgenommene Gewehre und forderte von den Wasaramo, daß sie nach eventuellem Gefecht ihm bei der Verfolgung der Mafiti behilflich sein sollten. Im Lager am Kingani waren bereits etwa 600 Wasaramo, welche das Gefecht mitmachen wollten. Von diesem Lager aus wurden Patrouillen an die Abteilungen Richelmann und von Bülow geschickt, welche diesen mitteilen sollten, daß Buschiri in Wasinga stände, und dieselben beorderten, dorthin aufzubrechen. Diese Patrouillen kamen jedoch nicht an, sondern wurden zum Teil versprengt, zum Teil von Mafitis aufgegriffen, so daß die Meldung nicht in die Hände der betreffenden Unterführer gelangte.
Gravenreuth brach in der Nacht von genanntem Lager auf, um sich direkt nach Wasinga zu begeben. Auf diesem Wege schon traf die Abteilung auf Zeichen, daß die Mafiti-Horden denselben Weg vor kurzer Zeit marschiert waren: Dörfer waren zerstört, Felder verwüstet, die Kokospalmen vernichtet. Massenhaft wurden Leichen von Weibern, Kindern und Männern vorgefunden, zum Teil in der gräßlichsten Weise verstümmelt.
So fand die Abteilung an Bäumen aufgehängt Kinder, unter deren Köpfen man Feuer angemacht und die so langsam zu Tode geröstet waren, Weiber mit abgeschnittenen Brüsten und sonstigen ekelhaften Verstümmelungen; Männer hatten zum Teil als Zielscheibe von Messern und Lanzen gedient und hingen zerfetzt an Büschen und Bäumen; Kinder lagen mit zerschellten Schädeln neben ihren toten Müttern: die ganze Gegend war in einen Pest- und Leichengeruch gehüllt. Durch den Anblick dieser Scheußlichkeiten wurden sowohl Europäer[S. 144] wie schwarze Soldaten, ja sogar die Zulus, deren Kampfesart noch am meisten derjenigen der Mafitis ähnelt, so entrüstet, daß sie alle kaum erwarten konnten, den Mafitis im Kampfe zu begegnen und die unschuldig hingemordeten Wasaramo zu rächen. Auf die begleitenden Wasaramo hatte der Anblick einen derartigen Eindruck gemacht, daß nach Verlauf von wenigen Stunden kein einziger dieser tapferen Bundesgenossen mehr zur Stelle war.
Des Morgens gegen 10 Uhr wurde Wasinga erreicht, ohne daß eine Meldung der Abteilung Bülow oder Richelmann eintraf. Wasinga wurde stark befestigt, aber bereits von Buschiri und den Mafitis verlassen vorgefunden. Im Schutze des Ortes lagen die Reste eines ungeheueren Feldlagers, welches auf eine nach Tausenden von Mafitis zählende Menge schließen ließ.
Die Abteilung marschierte nun weiter auf Jombo und hatte beinahe schon die Hoffnung, mit Mafitis zusammenzutreffen, aufgegeben, da die Meldung zu bestimmt auf Wasinga hindeutete.
Der Tag war ungeheuer heiß, Wasser war auf dem ganzen Wege nicht zu finden, und der permanente Leichengeruch wirkte beklemmend auf die marschierende Abteilung. Gegen 12 Uhr wurde eine kurze Mittagsrast unter 2 Mango-Bäumen, die den Verwüstungsversuchen der Mafiti Widerstand geleistet hatten, abgehalten. Hier traf die Abteilung auf einen kleineren versprengten Trupp der Kolonne Bülow, welcher angab, daß Bülow sich in nächster Nähe befinde. Die Meldung erwies sich jedoch als falsch, vielmehr stellte sich heraus, daß der türkische Offizier und seine Leute ohne Erlaubnis aus Schlappheit von der Kolonne zurückgeblieben waren. Genannter türkische Offizier erhielt den Befehl, zur Abteilung Bülow zu marschieren und demselben anzubefehlen, an seinem Platze zu halten, bis die Abteilung Gravenreuth herankäme.
Noch war die Patrouille kaum eine halbe Stunde abmarschiert, als in nächster Nähe des Rendezvous-Platzes Lärm ertönte und Schüsse fielen. Atemlos stürzte ein Mann der Patrouille herbei und meldete, daß eine Horde Mafitis dieselbe überrumpelt, zwei Mann getötet und einen mit der Lanze verwundet hätte.
[S. 145]
Herr v. Gravenreuth befahl sofort an die Gewehre, Lieutenant von Perbandt übernahm die Avantgarde, die Herr von Behr bald darauf verstärkte. Die Abteilung stieß auch bald auf vagabondierende Mafiti, die jedoch nach einigen Salven unter Zurücklassung von 10 Toten das Weite suchten. Gravenreuth folgte den weichenden Mafitis, doch war bald jede Spur derselben verschwunden, und wurde der Marsch auf Jombo und Bagamoyo fortgesetzt.
Gegen 4 Uhr nachmittags traf die Kolonne in einem Palmen-Wäldchen ein, in welchem v. Gravenreuth sich entschloß zu lagern, um der mittlerweile ganz erschöpften Truppe Ruhe zu gönnen. In der Nähe des Platzes stand ein Dorf in Flammen, und wir glaubten, daß die Abteilung Bülow auf den Feind gestoßen sei. Lieutenant v. Behr erhielt den Befehl, mit seinem Zuge dorthin zu marschieren, die Gegend zu rekognoszieren und Herrn v. Bülow mit seiner Abteilung zu Gravenreuth zu beordern. Es wurden Posten ausgestellt und Vorbereitungen für das Lager getroffen.
Bald jedoch ertönte aus der Postenkette wie aus der Abteilung von Behr lebhaftes Gewehrfeuer. Auch die lagernde Abteilung sah überall im Grase auftauchende, mit kriegerischem Kopfputz geschmückte, nackte Gestalten.
Sofort wurden die Gewehre zur Hand genommen und Schiffsoffizier Wiebel mit einigen Leuten zur Bagage beordert. v. Gravenreuth ging mit der Abteilung v. Perbandt in die Postenkette. Von hier sah man auf einige 100 Meter Entfernung das befestigte Mafiti-Lager, auf welches v. Behr mit seiner Abteilung losging. Dieses Lager wurde, trotzdem fortwährend noch außerhalb befindliche Mafiti-Banden anstürmten, genommen. Dabei drangen die Mafitis wiederholt bis in die Schützenkette ein und stachen mit ihren Speeren Leute aus derselben nieder. v. Behr war schon vorher in der Nähe des erwähnten brennenden Dorfes auf eine Horde Mafiti gestoßen, hatte sie aber sogleich mit einigen Salven begrüßt und nach dem jetzt eroberten Lager vor sich hergetrieben.
Mittlerweile war die Kolonne bei der Bagage unter dem Schiffsoffizier Wiebel in eine bedenkliche Lage gekommen. Die Mafiti hatten bereits einige von den wenigen Soldaten verwundet[S. 146] und drangen hart auf dieselben ein, um sich der Bagage zu bemächtigen. v. Gravenreuth, der das fortwährende Feuern von dort hören konnte, schickte daher Lieutenant von Perbandt mit einer kleinen Abteilung zurück, um Wiebel zu entsetzen und die Bagage heranzuziehen.
Lieutenant von Perbandt, der auf dem Wege dorthin fortwährend von Mafitis umzingelt und belästigt wurde, kam noch gerade zur Zeit, um Wiebel aus fataler Lage zu befreien und die Bagage glücklich in das Mafitilager zu bringen.
Dort sammelte sich die ganze Abteilung Gravenreuth, und gerade wollten sich die braven Sudanesen und Zulus mit der näheren Besichtigung und Plünderung der Hütten beschäftigen, als schon wieder größere Haufen von Mafiti auf das Lager eindrangen. Araber und Belutschen beschossen aus weiter Entfernung mit ihren langen Flinten die sich rangierenden Soldaten.
Durch eine kleine Schlucht von den Deutschen getrennt, lag noch ein zweites kleineres Rebellenlager, welches aber ebenfalls bereits verlassen war.
Da für die kleine Gravenreuthsche Abteilung das zuerst genommene Lager zu groß zur Verteidigung gegen die nachdrängenden Mafitis war, wurde dasselbe in Brand gesteckt und das andere bezogen. Auch hierhin drängten die Mafiti nach, wurden aber durch einige Salven verscheucht und hielten sich nun in respektvoller Entfernung in kleineren und größeren Trupps, die Abteilung Gravenreuth beobachtend.
In dem genommenen Lager waren verschiedene gefangene Wasaramo, Männer und Weiber, von Gravenreuth befreit und einiges Rindvieh erbeutet worden. Außerdem fanden sich in der Hütte Buschiris Briefe an die umwohnenden Häuptlinge vor, worin er dieselben aufforderte, mit ihm vereint am folgenden Tage Bagamoyo anzugreifen.
Die Mafiti, die mittlerweile durch die große Menge von Toten und Verwundeten, die sie auf dem Platze gelassen hatten, überzeugt worden, daß ihre Schilde aus Rinds- und Zebrahaut doch nicht einen Schutz gegen die deutschen Geschosse, wie ihnen Buschiri weiß gemacht hatte, gewährten, und welche außerdem all ihr zusammengestohlenes Gut in Flammen aufgehen[S. 147] sahen, zogen sich nach dem Kingani zurück. Buschiri konnte sie nicht zu erneutem Ansturm sammeln.
Mittlerweile hatte sich bei der Abteilung Gravenreuth herausgestellt, daß für den Mann nur noch 5 Patronen vorhanden waren und Gravenreuth beschloß deshalb, sich näher an Bagamoyo heranzuziehen, da er für die Nacht einen neuen Angriff der Mafiti befürchtete. Nach etwa einstündigem Marsche, — die Dunkelheit fing bereits an, einzubrechen, — kam von flüchtigen Wasaramo die Meldung, daß zwischen Bagamoyo und der Abteilung sich noch Mafiti-Horden aufhielten. v. Gravenreuth, der die Abteilung nicht der Gefahr aussetzen wollte, im Busch von den gemeldeten Mafitis bei Dunkelheit überfallen zu werden, bezog eine günstige Position, und zwar bivouakierte die ganze Abteilung in Schützenlinie, die Europäer auf Posten, die Nacht hindurch jeden Augenblick einen Angriff erwartend.
Die Soldaten waren dermaßen erregt, daß in der Nacht auf jedes Geräusch, sei es auch durch einen Schakal oder eine Hyäne verursacht, Salven abgegeben wurden. Nur unter großer Mühe der Europäer konnte dem Geschieße ein Ende gemacht werden.
Die Nacht verlief ohne den erwarteten Angriff. Wie sich später herausstellte, waren die Mafiti, nachdem sie sich von ihren ungeheuren Verlusten überzeugt hatten, in wilder Flucht und ohne anzuhalten, bis nach den Kingani-Furten geströmt und dabei noch zum Teil von der Abteilung Richelmann, die in Dunda stehen geblieben war, beschossen worden.
Am nächsten Morgen kam die Abteilung Gravenreuth endlich dazu, nach 24stündigem Fasten an ihres Leibes Notdurft und Nahrung zu denken. Die im Lager erbeuteten Ziegen waren in der Nacht, da sie zu großen Lärm machten, abgestochen worden und wurden nun von den ausgehungerten Soldaten verspeist.
Nach dem Abkochen marschierte Gravenreuth nach Bagamoyo weiter. Es zeigte sich, daß thatsächlich die Mafiti schon bis in die Nähe von Bagamoyo gestreift hatten, denn auch dort waren Felder und Äcker verwüstet und Leichen von Ermordeten, wenn auch nicht mehr in so großer Zahl, gefunden worden.
[S. 148]
Gegen Mittag kam die Abteilung in Bagamoyo an, wurde von der dort befindlichen Marineabteilung, die Bagamoyo besetzt gehalten hatte, aufs herzlichste begrüßt und beglückwünscht und von der Bevölkerung Bagamoyos und den dahin geflüchteten massenhaften Wasaramo mit stürmischem Jubel empfangen. Hier erfuhr v. Gravenreuth erst, daß Richelmann, der durch Brieftauben-Post mit Bagamoyo verbunden war, noch in Dunda stand, während von v. Bülow keine Nachricht vorhanden war. v. Gravenreuth gönnte seiner Abteilung nur bis zum nächsten Morgen Ruhe, deren sie sehr bedurfte, erneuerte die Munition und brach noch vor Tagesanbruch nach Dunda auf, um womöglich eine wirksame Verfolgung der Mafiti aufzunehmen.
In Dunda angekommen, fand er dieses von Richelmann besetzt, auch war vor Kurzem die Abteilung Bülow, die nicht halbwegs Madimola, sondern ganz dorthin marschiert war, da der Befehl falsch oder undeutlich geschrieben war, dortselbst angelangt. Die Patrouille mit den Befehlen an Hauptmann Richelmann war, wie schon erwähnt, nicht angekommen, sondern aufgefangen und versprengt worden.
In Dunda hatte der allgemein beliebte Schlachtenmaler Weidmann bereits Skizzen der dort stattgefundenen Szenen aufgenommen. Weidmann hat, nebenbei gesagt, nicht nur als Schlachtenbummler an zahlreichen der damaligen Gefechte teilgenommen, sondern sich in jeder Weise durch Übernahme der Proviantmeister-Geschäfte und andrer Funktionen nützlich zu machen gesucht.
v. Gravenreuth blieb mit der Hälfte seiner Abteilung und mit Richelmann in Dunda und ließ von dort aus die Kingani-Ebene absuchen, wobei noch verschiedene Mafitis in die Hände der Soldaten fielen. v. Bülow und v. Perbandt erhielten den Auftrag, die Mafitis bis nach dem mehrere Tagereisen entfernten Pangiri zu verfolgen. Doch wurde Pangiri trotz der anstrengendsten Eilmärsche bereits von den Mafiti verbrannt und seit kaum einer halben Stunde verlassen vorgefunden, ein Zeichen, welche Panik sich derselben nach dem Gefecht von Jombo bemächtigt hatte. Von dort marschierten die genannten Abteilungen nach Daressalam, ohne noch auf Mafiti zu stoßen,[S. 149] und bemerkten hier, daß die vor den Mafiti geflüchteten Wasaramo schon wieder zum Teil in ihre Dörfer zurückgekehrt waren.
Durch sein kühnes Vorgehen hatte Gravenreuth Buschiri abermals energisch zurückgeschlagen, Usaramo von der Plage der Mafiti befreit und der an der Küste eingerissenen Panik mit einem Schlage ein Ende gemacht.
Als Wißmann von Mpapua zurückkehrte — er war auf die Nachricht der Mafiti-Gefahr mit Dr. Bumiller und einer kleinen Abteilung dem unter Zelewski folgenden Gros vorangeeilt — empfing ihn die Siegesnachricht, welche im Verein mit dem, was er selbst im Innern erreicht hatte, einen wesentlichen Schritt vorwärts bedeutete und freiere Entfaltung aller Kräfte zuließ.
Indes konnte sich Wißmann nicht in jeder Weise mit Gravenreuths Vorgehen einverstanden erklären. Er mißbilligte entschieden die Teilung des Expeditionskorps in drei Kolonnen, von denen ja nur die eine wirklich hatte eingreifen können, während die Richelmannsche nur auf kleine und vereinzelte Trupps von Flüchtigen gestoßen war, und die dritte nur zur Verfolgung hatte verwandt werden können. Leicht hätte diese Schwächung bei der von Gravenreuth nicht geahnten Tapferkeit der Mafiti ihm verhängnisvoll werden können. Die Teilung erschien auch deswegen nicht angebracht, weil die Nachrichten über die Stellung der Gegner keineswegs so genau waren, daß man daraufhin hätte operieren können. Ein Vorgehen mit der gesamten Macht auf Jombo, allerdings vielleicht auf einem Umwege, um die Möglichkeit eines überraschenden Überfalls für sich zu haben, und dann in nächster Nähe des Feindes eine Teilung zum Angriff von verschiedenen Seiten her, wie es ja Gravenreuth mit seiner eigenen Kolonne gemacht hatte, wäre für das gesamte Korps das Richtigste gewesen.
Indes der Erfolg war da, und das Verdienst, die Küste verteidigt und die Mafitis aufs eklatanteste geschlagen zu haben, gebührt ohne Zweifel Gravenreuth mit seinen Offizieren und Unteroffizieren, wie auch vor allen Dingen der Kaltblütigkeit und Bravour unserer Sudanesen. Hätten diese bei Jombo[S. 150] versagt, so wäre das Expeditionskorps vernichtet gewesen. Als ich auf dem Rückmarsch mit der Stanley-Eminschen Karawane in Msua mit dem Freiherrn v. Gravenreuth zusammentraf, erzählte er mir von den damals noch frischen Ereignissen, wobei er den Erfolg außer der Tapferkeit der Soldaten besonders der Ruhe seiner Offiziere von Perbandt und von Behr zuschrieb.
[S. 151]
Revisionsreise des Reichskommissars nach allen Stationen. — Bana Heri im Hinterland von Sadani. — Der Verkehr wird durch seine Leute behindert. — Gefährdung der französischen Mission Mandera. — Expedition gegen Bana Heri unter v. Zelewski. — 600 Wassukuma als Hilfstruppe. — Selbständiges Vorgehen der Wassukuma nach Mandera. — 200 irreguläre Wadoë und Wakuara aus unserer Seite. — Kleineres Expeditionskorps unter Gravenreuth zur See in Sadani; Zelewski auf dem Landwege. — Hauptboma Bana Heris bei Mlembule bleibt unentdeckt. — Besetzung von Mkwadja. — Anlage einer Station daselbst. — Vorstoß des Dr. Schmidt von Pangani nach Magila. — Einwohnerschaft auf deutscher Seite. — Buschiri im Innern isoliert. — Gerücht, Buschiri wolle sich mit Bana Heri und Simbodja verbinden. — Dr. Schmidt mit kleinem Expeditionskorps in Gewaltmärschen ins Innere, um Buschiri den Weg zu verlegen. — Einnahme des Dorfes Masiro. — Buschiri entkommt abermals. — Die Eingeborenen überall freundlich gesinnt. — Buschiri vom Jumbe Magaya gefangen. — Rückmarsch nach der Küste. — Buschiris Verhör, Verurteilung und Tod. — Die aufständischen Bagamoyo-Jumbes werden verurteilt. — Günstige Entwicklung der Verhältnisse auf den Küstenstationen. — Neue Rüstungen Bana Heris. — Rekognoszierungstour des Verfassers gegen Bana Heri im Hinterland von Sadani. — Angriff auf die Boma von Mlembule. — Rückmarsch nach der Küste. — Wißmann zieht alle verfügbaren Streitkräfte zusammen zum Angriff auf Bana Heri. — Mlembule in heftigem Gefecht erobert. — Bana Heri zieht sich nach Palamakaa zurück. — Einrichtung der Station Sadani unter dem Verfasser. — Rekognoszierungsexpeditionen unter von Gravenreuth und dem Verfasser. — Expedition des Dr. Schmidt zu Simbodja. — Anlage eines Postens am Kilimandscharo. — Gefechte um Palamakaa. — Eroberung der Boma. — Zersprengung der Macht Bana Heris. — Kleinere Expeditionen um Pangani. — Uebergabe Bana Heris in Sadani.
Die nächstliegende Aufgabe des Reichskommissars nach seiner Rückkehr aus dem Innern und nach Erledigung der[S. 152] laufenden Geschäfte war eine Revisionsreise an der Küste. Ihr Zweck war eine Besichtigung der Stationen, auf denen Wißmann durch den Augenschein sich von den inzwischen gemachten Fortschritten überzeugen wollte, um seine weiteren Pläne nach dem Zustande der Stationen und der etwaigen Notwendigkeit der Besetzung derselben einzurichten.
Das Ergebnis dieser Besichtigung war ein sehr erfreuliches. Überall war wie vor der Expedition so auch während derselben wacker an dem Ausbau der Stationen weiter gearbeitet worden; die Beziehungen der Stationschefs zur Bevölkerung waren im weiteren Umkreise auf einen Teil des Hinterlandes ausgedehnt, speziell das Hinterland von Bagamoyo und Daressalam war nach Besiegung der Mafitis vollkommen beruhigt. Wißmann konnte telegraphisch nach Berlin berichten, daß die große Karawanenstraße von Bagamoyo nach den Seen wieder für den Verkehr offen stände.
Nur im Hinterlande von Sadani ließen die Verhältnisse noch sehr vieles zu wünschen übrig. Hier hatte sich der bereits früher erwähnte Bana Heri, der Machthaber von Usegua festgesetzt, jeden Verkehr mit der Küste unterbrochen und brandschatzte die aus Unkenntnis den Sadani-Weg benutzenden Karawanen. Boten von Mpapua, die auf dem kürzeren Wege durch Usegua nach Bagamoyo gingen, Leute der französischen Mission wurden von ihm gefangen genommen und ihrer Waren beraubt. Später, nach der Einnahme der Hauptstellung Bana Heris fanden wir in seiner Hütte verschiedene von ihm abgefangene Briefe von uns und von der Station Mpapua vor. Selbst der Dhau-Verkehr vor Sadani und im Wami wurde durch Bana Heris Leute unsicher gemacht.
Major Wißmann beschloß daher ein abermaliges Vorgehen gegen Bana Heri und setzte den Beginn der Unternehmungen gegen ihn ursprünglich auf den 10. November fest; doch veranlaßte die Bitte der französischen Mission Wißmann, die Unternehmung schon früher zu beginnen, da die Missionsstation Mandera in Usegua von den Scharen Bana Heris aufs ernsteste gefährdet wurde.
Der Führer des Expeditions-Korps, Chef v. Zelewski, erhielt Befehl, mit dem aus vier Kompagnien formierten Korps[S. 153] direkt auf Mandera vorzugehen, sämtliche feindliche und befestigte Dörfer anzugreifen und zu zerstören, um dadurch Bana Heri seiner Stützpunkte im Hinterlande zu berauben, die Mission zu sichern und den Verkehr wieder zu ermöglichen. Dem Expeditionskorps wurde die früher bereits erwähnte Karawane der Wassukuma unter ihrem Führer Tscherekesa beigegeben, da dieser mit den erwachsenen Wassukuma sich bereitwilligst in gleicher Weise, wie es früher während des Aufstandes die Waniamuesi gethan, zur Verfügung der Deutschen stellte.
Während der Zeit der Anwesenheit der Karawane in Bagamoyo hatte Tscherekesa Gelegenheit gehabt zu sehen, daß gute von ihm geleistete Dienste von uns anerkannt wurden, daß es die erste Aufgabe des Reichskommissariats in jener Zeit war, Handel und Wandel nicht nur an der Küste, sondern besonders im Hinterland an den großen Karawanenstraßen wieder zu heben, daß er somit seinen Vorteil auf unserer Seite zu suchen habe. Außerdem hatten die Wassukuma zu Bagamoyo vielfach Gelegenheit zu Verdienst. Besonders aber hatte die Art und Weise mitgewirkt, mit der es der stellvertretende Stationschef zu Bagamoyo, Hauptmann Richelmann verstanden, mit der Karawane und den Leuten umzugehen.
Das zwischen uns und den Wassukuma hergestellte gute Verhältnis war um so bemerkenswerter, als bei Ausbruch des Aufstandes gerade Tscherekesa, der Führer jener Karawane, sich bereit erklärt hatte, seine Macht auf die Seite der Rebellen zu stellen. — Daß bei dem Entschluß Tscherekesas, unter Zelewski nach Usegua mitzuziehen, auch zum großen Teil Rücksichten auf Gewinn, auf gute Beute und Plünderung mitsprachen, ist ja natürlich.
Die Wassukuma, welche er stellte, 600 an der Zahl, wurden mit Vorderlader-Gewehren und genügender Munition versehen und in einzelne Trupps eingeteilt, von denen jeder, um ihn als unseren Freund kenntlich zu machen, eine schwarz-weiß-rote Flagge mit sich führte.
Die Wassukuma hatten auf dem Wege nach Mandera zwischen dem Expeditionskorps und der Küste zu marschieren und hatten ebenfalls den Auftrag, überall wo sie Widerstand[S. 154] fänden, einzuschreiten und die Dörfer gründlich zu zerstören.
Auf der andern Seite des Expeditionskorps, also westlich desselben marschierte ein ebenfalls aus freiwilligen Irregulären bestehender Trupp von 200 Wadoë und Wakuara.
Wir haben bereits früher erwähnt, daß auch diese zuerst auf Seiten der Rebellen standen, aber nach den ersten Siegen Wißmanns den Frieden von uns erbaten und nun offen auf unserer Seite gegen ihre einstigen Verbündeten kämpften. Auch sie erhielten von uns Gewehre und Munition und hatten die Aufgabe, die Expedition Zelewski in ihrer linken Flanke zu sichern.
Sämtliche Hilfstruppen waren, wie erwähnt, dahin instruiert, daß sie angreifen sollten, wo ihnen mit Feindseligkeiten entgegengetreten würde; gegen Befestigungen sollten sie selbständig vorgehen, und nur, wenn sie sich außer Stande sähen, mit Erfolg eine zu starke Boma anzugreifen, sollten sie Meldung an den Chef von Zelewski erstatten, damit dieser dann mit dem Expeditionskorps selbst eingreifen könnte.
Außer diesem unter der Führung von Zelewski stehenden Expeditionskorps von vier Kompagnien, hatte der Reichskommissar noch ein kleineres Expeditionskorps aus der bis dahin am stärksten besetzten Station Pangani herausgezogen und unter den Befehl des Chefs von Gravenreuth gestellt. Dieses kleine Expeditionskorps wurde am 8. November auf dem Dampfer »München« eingeschifft und nach Sadani gebracht, wo auch die Kriegsschiffe auf Bitten des Reichskommissars zusammengezogen waren, um eventuell für das Eingreifen an der Küste mit zur Verfügung stehen zu können.
Die Landung zu Sadani fand noch am Tage der Ankunft, den 8. November statt, und zwar nach Verabredung mit dem ältesten Offizier der Marine, Kapitän Voß, gemeinsam mit einem Landungscorps der kaiserlichen Marine.
Der der Landung entgegengesetzte Widerstand von Seiten der Rebellen war nur sehr gering. Die landenden Truppen erhielten Feuer von einer fünf Mann starken Patrouille, die sich indessen sofort auf Ndumi zurückzog. Auch das Terrain um Sadani selbst war frei von Rebellen, die, von Westen[S. 155] durch das starke Expeditionskorps und die Irregulären bedrängt, in nördlicher Richtung davonzogen. Es wurde infolgedessen von dem gelandeten Expeditionskorps der Schutztruppe ein Platz für das Lager ausgewählt und dies in der bei uns auf Märschen üblichen Weise hergestellt. Während der Nacht wurde von einem flüchtig vorbeiziehenden Rebellentrupp noch eine Salve ins Lager hineingeschossen, jedoch ohne Erfolg.
Tags darauf, den 9. November traf das Expeditionskorps unter Zelewski in Sadani ein. Schon vom frühen Morgen an wurde, da sein Eintreffen an diesem Tage erwartet wurde, eifrig nach ihm vom Lager bei Sadani aus ausgeguckt.
Um 10 Uhr Vormittags erblickte man in dem in weiter Ferne aufsteigenden Rauch eines angezündeten Dorfes das erste Zeichen des Herannahens der Expedition. Bald darauf bezeichneten weiter aufsteigende Rauchwolken den Weg der verschiedenen Teile der Expedition Zelewski, bis um 2 Uhr auch Ndumi, das letzte Dorf in der Nähe von Sadani, zwei Stunden von diesem entfernt, in Flammen aufging. Es war dies derjenige Ort, in dem Wißmann im Jahre 1883 nach seiner ersten Durchquerung Afrikas von Bana Heri aufs freundlichste empfangen und bewirtet wurde, derselbe Ort, wo auch der Verfasser nach schwerer Verwundung auf seiner im Eingang dieses Buches geschilderten Expedition von den Eingeborenen freundlich aufgenommen und speziell von Bana Heri und seinem Sohne Abdallah gastlich bewirtet wurde. Der planmäßige Widerstand Bana Heris und der Fanatismus seiner Leute hatte indes diese rauhe, in solchen Fällen in Afrika aber notwendige Art der Kriegsführung, die in der planmäßigen Verwüstung des Landes und dem Niederbrennen der Dörfer besteht, heraufbeschworen.
Nach seinem Eintreffen berichtete Chef von Zelewski, daß er auf seinem Marsche bis nach Mandera, der Südgrenze Useguas, alles friedlich gefunden habe. Von da ab habe er fünf zum Teil stark befestigte Dörfer unter Verlust von zwei Toten und fünf schwer Verwundeten eingenommen. Der Feind habe große Verluste gehabt und flüchte nach Norden.
Die Hilfstruppen hatten ebenfalls Gelegenheit gefunden, an einzelnen Plätzen einzugreifen. Sie waren auch, wie sich allerdings[S. 156] erst später herausstellte, auf die im folgenden zu erwähnende Boma Bana Heris in Mlembule gestoßen, dort aber zurückgeschlagen worden. Da ihnen diese Stellung der Rebellen zu stark erschien, als daß sie annahmen, dieselbe würde von uns genommen werden, und da sie sofort das Hasenpanier ergriffen hatten, glaubten sie am schlauesten zu handeln, wenn sie überhaupt über diese Befestigung nichts verlauten ließen. So blieb uns, da auch Zelewski selbst nichts von jener Stellung Bana Heris erfuhr, dieser überaus feste Stützpunkt und die darin befindliche bedeutende Macht vor der Hand gänzlich verborgen. Der letztere Umstand wirkte zur Ausführung einer Maßregel mit, welche sich später als Mißgriff erwies.
Die Nachricht, daß Sadani von Bana Heri und seinen Leuten wieder besetzt sei, hatte sich als falsch erwiesen; ein kaum nennenswerter Widerstand war hier gefunden worden. Das Lager von Mlembule blieb in Folge der Dummheit der Irregulären unbekannt. Ein großer Teil des Handels mußte naturgemäß jetzt statt nach Sadani nach Mkwadja gehen und so beschloß der Reichskommissar, statt Sadani den letzteren Platz zu besetzen. Chef Freiherr von Gravenreuth sollte mit der Kompagnie, die am 8. in Sadani gelandet war, und den Wassukuma die Küste entlang nach Mkwadja marschieren, und Zelewski mit seinem Expeditionskorps, das von 48 Stunden 32 marschiert und gefochten hatte, am nächsten Tage dorthin folgen, während der Kommandant selbst beabsichtigte, nach Erledigung der in Sansibar und Bagamoyo seiner harrenden Arbeiten am 13. November nach Mkwadja zu kommen. Für die Besetzung dieses Ortes sprach noch der Umstand, daß von Mkwadja ein starker Schmuggel nach Sansibar und Pemba hin betrieben wurde.
Der Marsch Gravenreuths ging, da die Dörfer an der Küste alle verlassen waren, von Sadani aus in friedlichster Weise von statten. Schwierig indes war das Passieren der vielen sich zwischen Sadani und Mkwadja von der Küste ins Land hineinziehenden Creeks. Die beiden ersten derselben konnten durchwatet werden, während ein dritter Creek, der sich unmittelbar südlich von Mkwadja befindet, größere Hindernisse bot. Eine vorausgesandte Patrouille unter dem Chef Frhrn.[S. 157] von Bülow und Premierlieutenant Böhlau versuchte den Creek zu durchschwimmen, aber sowohl die beiden genannten Offiziere, wie auch einige Askaris wurden durch den starken Strom ins Meer hinausgetrieben und nur der großen Schwimmfertigkeit der betreffenden gelang es, das Land wieder zu erreichen; ein Askari ertrank. Erst beim Eintritt von Niedrig-Wasser konnte der tiefe und breite Creek passiert werden.
Unmittelbar darauf wurde von der Kompagnie unter Gravenreuth der Ort Mkwadja, in dem sich einige Araber festgesetzt hatten, welche die Spitze der Expedition mit einem anhaltenden Feuer empfingen, genommen und die Aufständischen daraus vertrieben. Die Befestigungsarbeiten in der Station wurden sogleich in Angriff genommen und durch die thatkräftige Unterstützung der Marine unter dem liebenswürdigen, stets entgegenkommenden Kapitän Voß sehr gefördert. 60 Mann von der Schutztruppe unter dem Kommando des Chefs von Bülow, der sechs Wochen später durch Lieutenant von Perbandt ersetzt wurde, blieben als Besatzung zurück.
Schon vor dieser Zeit hatte von Pangani aus, wo um die englische Missionsstation Magila herum eine große Ansammlung von Rebellen stattgefunden hatte, der dortige Stations-Chef Dr. Schmidt einen siegreichen Vorstoß unternommen. Nachdem er sich durch Kundschafter über die örtlichen Verhältnisse genau informiert, hatte er mit 100 Mann das Rebellenlager, welches nach den Angaben der Eingeborenen 1000 Mann in sich bergen sollte, durch einen überraschenden Bajonettangriff genommen und die Gegner mit einem Verlust von 30 Toten geworfen, während diesseits nur Verwundungen zu verzeichnen waren. Dieser Erfolg wirkte bestimmend auf die Bewohner des Hinterlandes von Pangani ein, die von nun an ihren Vorteil darin sahen, zur Station zu halten. Auch Simbodja, der durch die Gefangennahme des Dr. Meyer und Baumann bekannte, mächtige Häuptling im Hinterlande von Pangani, hatte seine Absicht kund gegeben, sich dem Reichskommissar zu unterwerfen.
Buschiri war durch den Erfolg Gravenreuths bei Jombo vollkommen isoliert worden. Die Mafiti, welche bis dahin fest an einen Sieg Buschiris geglaubt und nun seinetwegen[S. 158] so starke Verluste erlitten hatten, außerdem ihren beim Einfall in Usaramo gemachten Raub nicht einmal hatten in Sicherheit bringen können, waren seine Feinde geworden und er mußte versuchen, sich ihrer Rache zu entziehen.
Buschiri wandte sich zunächst nordwärts und hielt sich in Nguru versteckt. Während dieser Zeit gelang es uns nicht, irgend welche sicheren Nachrichten über seinen Aufenthalt zu erhalten. Es wurde bereits die Befürchtung laut, es könne ihm gelungen sein, unter Umgehung von Mpapua nach Tabora durchzukommen, um hier den Widerstand der Araber gegen uns zu organisieren. Da plötzlich traf in Pangani die Nachricht ein, Buschiri wolle sich mit Bana Heri und dem Häuptling Simbodja verbinden und mit diesen die Station Pangani angreifen. Diese Nachricht wurde durch den uns freundlich gesinnten Häuptling Mohammed Soa dahin berichtigt, daß Buschiri sich in Muenda an der Grenze von Nguru mit den noch bei ihm gebliebenen Arabern und 50 Eingeborenen in einem Lager verschanzt, und daß er zu Simbodja Boten gesandt habe, um diesen zu einem gemeinsamen Vorstoß gegen die Küste zu überreden. Der Stationschef von Pangani, dessen Thätigkeit die überaus schnelle und günstige Entwickelung der Verhältnisse um Pangani insbesondere zuzuschreiben ist, erkannte, daß, wenn Buschiri im Hinterlande einen Stützpunkt für seine Pläne fände, die größte Gefahr vorhanden sei, daß alles bisher Erreichte mit einem Schlage wieder vernichtet würde.
Um dieser Gefahr vorzubeugen, setzte Dr. Schmidt ein Expeditionskorps aus der Stationsbesatzung zusammen und brach mit diesem am 2. Dezember in Eilmärschen von Pangani auf, um Buschiri den Weg nach Masinde zum Häuptling Simbodja zu verlegen. Nach zwei Gewaltmärschen kam die Expedition im Dorfe des Häuptlings Masiro an, welcher Buschiri mit Lebensmitteln unterstützt und ihm einen Esel geschenkt hatte. Das Dorf wurde zerstört und der Weitermarsch nach Muenda fortgesetzt. Kurz vor diesem Platz machte Schmidt Halt, erteilte dem Lieutenant Ramsay den Befehl mit einem Teil des Expeditionskorps das Lager nach Westen hin zu umgehen und von der Westseite aus dann gegen[S. 159] dasselbe vorzudringen, während er sich selbst mit dem Gros des Expeditionskorps an der Ostseite hielt.
Der Angriff wurde für Mitternacht festgesetzt. Niemand sollte außer im äußersten Notfall einen Schuß abgeben, jeder Lärm, jedes Geräusch sollte vermieden werden, um die Überrumpelung möglichst vollständig zu machen. Dr. Schmidt drang mit den Askaris von der Ostseite ein. Diese hatten den Befehl, sofort auf die durch Ortskundige gezeigte Hütte Buschiris vorzudringen und diesen hierin festzunehmen. Aber ein planloses Schießen der Askaris warnte den Rebellenführer und gab ihm abermals Gelegenheit, noch im letzten Momente zu entkommen. Ohne die von Dr. Schmidt aufs strengste verbotene Schießerei wäre der Coup vollkommen gelungen und Buschiri schon damals in unsere Hände gefallen. Von den eindringenden Truppen wurden die Leute im Lager, soweit sie nicht im letzten Augenblick noch entflohen waren, niedergemacht, und es zeigte sich am nächsten Morgen, daß der Feind 28 Tote, darunter viele Araber auf dem Platze gelassen hatte. Von unserer Seite wurde ein Zulu und zwei Suaheli leicht verwundet.
Tags darauf zog Dr. Schmidt nach Manamgato, einem Orte in der Nähe von Muenda, wohin Buschiri geflüchtet und wo er von den Eingeborenen erschlagen sein sollte. Bei der Rekognoszierung der Leiche stellte es sich indes heraus, daß es nicht Buschiri, sondern einer der andern, in seiner Begleitung befindlich gewesenen Araber war. Dr. Schmidt ging sodann mit zwei Kompagnieen nach Makororo zurück, um von hier aus weitere Nachforschungen anzustellen. Bereits vorher hatte Schmidt in der ganzen Umgegend bekannt gemacht, daß es verboten sei, Buschiri aufzunehmen, daß derjenige, welcher dies dennoch thäte, von ihm als Rebell behandelt würde, wer ihn dagegen festnehme, solle reichlich belohnt werden.
Am 7. Dezember traf denn auch die Nachricht von Jumbe Magaya ein, daß Buschiri zu Quamkoro an der Grenze von Nguru gefangen genommen sei. In zweitägigem Parforcemarsch ging es nun nach Quamkoro. Der Jumbe kam der Expedition schon entgegen und führte dann Dr. Schmidt und die Offiziere der Expedition sofort nach der Hütte, in der Buschiri gefangen lag. Bei der Flucht aus der Boma von[S. 160] Muenda hatte Buschiri alles verloren und blos sich selbst, nur mit einem Lendentuch bekleidet, gerettet. In diesem Zustande fand man ihn in der dunklen Hütte vor, Hände und Füße mit schweren Eisenketten gefesselt, den Hals in eine Sklavengabel eingezwängt. Die herbeikommenden Askaris, welche mehrfach gegen Buschiri gefochten hatten, erkannten ihn sofort, und Dr. Schmidt unterhielt sich mit Buschiri, der bereitwillig über alles Auskunft erteilte und seiner Verwunderung über das plötzliche Erscheinen der Deutschen hier an der Grenze von Nguru Ausdruck gab.
Der Marsch nach der Küste wurde am nächsten Morgen angetreten und hierbei selbstverständlich Buschiri sowohl auf dem Marsche wie im Lager auf das sorgfältigste stets von Europäern bewacht. Für den Marsch wurde ihm ein Esel als Reittier gegeben, zu beiden Seiten gingen Soldaten; in der Nacht schlief Buschiri im Zelte des Führers der Expedition, in welchem sich gleichzeitig die Lagerwache mit einem Europäer befand.
In Pangani wurde Dr. Schmidt mit dem Expeditionskorps natürlich auf das freudigste begrüßt und allseitig zu seinem nicht zu unterschätzenden Erfolge beglückwünscht.
Dieser Erfolg war dadurch nicht geringer geworden, daß die Eingeborenen schließlich Buschiri selbst ausgeliefert hatten; Schmidt hatte es eben verstanden, die Bevölkerung so für sich zu gewinnen, daß sie endlich gegen den früher so mächtigen Rebellenführer Partei nahm.
Da Schmidt schon während des Marsches durch Eilboten Nachricht nach der Küste und von da an den Reichskommissar gesandt hatte, kam Wißmann tags nach der Ankunft des Expeditionskorps in Pangani an und begab sich sofort in das Gefängnis zu Buschiri. Der Rebellenführer antwortete auf die Fragen des Reichskommissars völlig unbefangen und gab alle Auskunft über die gegen uns gelieferten Gefechte sowohl wie über die Organisation des Aufstandes gegen die ostafrikanische Gesellschaft und die Absichten, welche er selbst (Buschiri) hierbei verfolgt hatte. Eine längstgehegte Vermutung unsererseits erhielt durch Buschiris Angaben Betätigung, nämlich, daß er vom Sultan von Sansibar zum Vorgehen gegen die[S. 161] Deutschen ermutigt, ja daß ihm von demselben sogar angeboten worden sei, er solle nach gutem Erfolge zum Vezir der Küste gemacht werden. Belege für die Wahrheit dieser Aussage konnte Buschiri indes nicht beibringen. In Verlegenheit geriet er, als ihm seine großen Schandthaten vorgehalten wurden, besonders sein Verhalten gegen den in den ersten Kapiteln erwähnten Handwerker Dunia, dem er seiner Zeit die beiden Hände abhacken ließ. Trotz allem glaubte Buschiri fest, daß er vom Reichskommissar begnadigt werden würde; er hatte sogar gebeten, ihn als Offizier in die Schutztruppe einzustellen, und versprochen, er würde dann ebenso wacker für uns kämpfen, als er früher gegen uns gefochten hätte.
Nach dem langen Verhör im Gefängnis durch den Reichskommissar bat Buschiri bei Eintritt der Abenddämmerung, als es Zeit wurde zum mohammedanischen Sechsuhrgebete, ihn allein zu lassen, damit er den Vorschriften seiner Religion gerecht werden könnte.
Am folgenden Tage wurde ihm sein Todesurteil bekannt gemacht, das er, obgleich es ihm unerwartet kam, doch gefaßt entgegennahm. Die Hinrichtung war auf den 15. Dezember, nachmittags 4 Uhr angesetzt. Dicht bei der Station in Pangani war auf einem freien Platz ein Galgen hergerichtet worden; um ihn herum nahmen die Truppen Aufstellung. Nach der Ankunft des Kommandanten mit seinem Stabe wurde Buschiri aus dem Gefängnis vorgeführt. Die feste Haltung, welche er bis dahin bewahrt hatte, verließ ihn hier vollständig. Als das Todesurteil durch den Adjutanten Dr. Bumiller verlesen war, und eben der Kopf des Verurteilten durch die Schlinge gesteckt werden sollte, verlangte Buschiri nochmals den Reichskommissar zu sprechen: er habe noch sehr wichtige Enthüllungen zu machen. Diese Enthüllungen bestanden nur darin, daß er alle seine Schuld auf seinen treuesten Anhänger, den bereits öfter erwähnten Komorenser Jehasi, abwälzen wollte. Insbesondere behauptete er, Jehasi sei es gewesen, der mit Makanda zusammen die Mafiti geholt und zum Vorgehen gegen die Küste bewogen habe. Buschiri glaubte hierdurch sein Leben zu retten, erreichte jedoch nur, daß er, nachdem er namentlich bei Beginn des Aufstandes und in vielen Kämpfen Zeichen[S. 162] seiner Bravour und seines Organisationstalentes gegeben hatte, nun angesichts des Todes als Feigling der Verachtung anheimfiel.
Viel gefaßter zeigten sich die meisten anderen zum Tode durch den Strang verurteilten gläubigen Mohammedaner. Verfasser selbst hat die meisten, nachdem sie den Kopf freiwillig in die Schlinge gesteckt hatten, noch die Worte sagen hören: »Ich sterbe als guter Mohammedaner!«
Daß gegen Buschiri keine Gnade geübt wurde, war natürlich. Der ganze Aufstand hatte sich an seinen Namen geknüpft; solange er lebte, lag immer die Gefahr nahe, daß sich auf ihn die Hoffnungen der Unzufriedenen richten und in ihm eine Unterstützung finden würden. Seine Begnadigung wäre zudem ohne den geringsten Wert für uns gewesen; denn eine Macht hatte Buschiri nur nach seinem ersten ephemeren Erfolge im Aufstand gehabt; als der Erfolg sich von ihm abwandte, war er ebenso einflußlos wie früher. Die großen Araber ließen ihn fallen und nur besitzloses Gesindel scharte sich um ihn. Seine Angaben, daß er gute Verbindungen zu den Aufständischen von Kilwa und zu Bana Heri hätte, und daß er daher dem Reichskommissar von großem Nutzen sein könne, waren erlogen. So lag kein Grund für den Reichskommissar vor, dem Rebellenführer die wohlverdiente Strafe zu erlassen.
Im Lager Buschiris waren noch die Bagamoyo-Jumbes Bomboma, Malela und Pori mit 30 Männern und 200 Weibern und Kindern gefangen genommen und auf ihren Wunsch vom Reichskommissar von Pangani nach Bagamoyo geschickt worden. Von den Gefangenen wurden nach stattgehabter Untersuchung drei, nämlich Bomboma, Malela, weil sie sich bis zuletzt erbittert und verstockt gegen uns gezeigt hatten, und endlich derjenige Mann unter den Anhängern Buschiris, der, wie jetzt festgestellt wurde, im April dem Handwerker Dunia die Hände im Lager Buschiris abgeschlagen hatte, zum Tode durch den Strang verurteilt und am Galgen bei der Station Bagamoyo aufgeknüpft. —
Inzwischen hatte auch Herr von Gravenreuth auf seiner bereits erwähnten Expedition, unterstützt von Leuten, welche ihm der bereits früher erwähnte Häuptling Kingo von Morogro[S. 163] gestellt hatte, im Innern auf Buschiri gefahndet. Gravenreuth nahm den Aussagen der Kundschafter zufolge an, daß Buschiri weiter im Innern von Usegua und Nguru sich aufhalte. Einige Dörfer, die zu Buschiri und Bana Heri gehalten hatten, wurden bestraft. Im übrigen hatte Gravenreuth die französischen Missionsstationen Tununguo, Morogro und Mhonda besucht und überall, sei es durch strafendes Einschreiten, sei es durch friedliches Schauri für die Stärkung unseres Ansehens im Innern gewirkt.
Auch auf allen andern Küstenstationen entwickelten sich die Verhältnisse in durchaus befriedigender Weise. In Tanga war es dem Stationschef Krenzler gelungen, durch einen friedlichen Zug bis zur englischen Missionsstation Magila die Ruhe vollkommen zu sichern, und er hatte den Küstenplatz Tangata besetzt. In Pangani, wo nebenher die Stationsarbeiten gut vorgeschritten waren und ihrer Vollendung entgegengingen, bewiesen die eben erwähnten Ereignisse und die Stimmung der Eingeborenen, welche sich ja schließlich selbst gegen die Rebellen wandten, am besten die dort gemachten Fortschritte. Der im Bezirk von Daressalam noch unsichere Küstenplatz Kisiju wurde von Chef Leue und Lieutenant Johannes genommen und ein berüchtigter Araber gefangen, der in Daressalam aufgehängt wurde. An Stelle des in Mpapua verstorbenen Lieutenant v. Medem wurde im Januar 1890 der Chef v. Bülow als Stationschef nach Mpapua geschickt.
In der zweiten Hälfte des Dezember 1889 drangen Nachrichten über weitere Rüstungen Bana Heris im Hinterlande von Sadani und Mkwadja zu unsern Ohren. Wißmann, der um diese Zeit des Pascha wegen öfters nach Bagamoyo kam, erteilte mir den Auftrag, ein Expeditionskorps aus den in Bagamoyo verfügbaren Kräften und einem Teil der in Pangani befindlichen Expeditionstruppen zusammenzustellen und mit diesem eine Rekognoszierung im Hinterlande von Sadani und Mkwadja zu unternehmen, wenn möglich Bana Heri zu schlagen und nach Süden abzudrängen. Es standen mir zur Verfügung an Offizieren die Herren Chef v. Bülow, Lieutenant Johannes, Lieutenant Fischer und Deckoffizier Illich; ferner eine Anzahl deutscher Unteroffiziere und 250 Soldaten.[S. 164] Ein Teil wurde unter Bülows Führung von Bagamoyo nach Mkwadja gebracht, der andere von mir in Pangani, wohin ich mich am 24. Dezember begab, in der Weihnachtsnacht eingeschifft und am Vormittag des 25. Dezember ebenfalls in Mkwadja gelandet.
Am Nachmittag desselben Tages trat ich mit meiner vollzählig versammelten und mit Patronen, sonst aber nur mit dem allernotwendigsten Proviant (Zelte, Feldbetten, Reittiere u. s. w. wurden nicht mitgenommen) versehenen Expedition den Vormarsch nach Westen an. Die Zusammensetzung war folgende: Suaheli-Askari unter Deckoffizier Illich, eine Zulu-Kompagnie unter Chef v. Bülow, dazu Lieutenant Fischer, die kombinierte Sudanesen- und Zulu-Kompagnie unter Lieutenant Johannes, das Maxim-Gun unter Feldwebel Schulte. Während des größten Teils der Nacht wurde marschiert, in der Absicht überall möglichst unverhofft zu erscheinen. Diese Absicht wurde jedoch vereitelt, denn die Leute Bana Heris hatten durch Kundschafter schon von unserer Landung in Mkwadja erfahren und erwarteten uns. Sie warfen sich uns immer in kleinen Trupps entgegen, belästigten uns in unsern Lagern und Ruheplätzen bei Tage und bei Nacht, wurden aber überall in die Flucht gejagt. Immerhin gewannen sie auf diese Weise ganz genaue Kenntnis von unsern Bewegungen.
Am 26. Dezember nachmittags wurde Lieutenant Fischer von einem so schweren Sonnenstich betroffen, daß er von uns eigentlich schon aufgegeben wurde. Nur der aufopfernden Pflege des sehr verdienten Lazarettgehülfen Grucza gelang es, ihn durchzubringen, so daß er, wenn auch in bewußtlosem Zustande, mit uns einige Tage später an der Küste ankam und von dort nach Sansibar überführt werden konnte. Wir machten inzwischen mehrere Gefangene und zwangen diese, uns Führerdienste zu leisten, wobei sie wiederholt den vergeblichen Versuch machten, uns irre zu führen. Das wurde erst anders, als wir ihnen etwas unsanft bedeuteten, sie möchten im eigenen Interesse nicht mehr vom rechten Wege zur Boma Bana Heris, die wir als Ziel im Auge hatten, abweichen. Sie behaupteten indessen alle, eine solche Boma gebe es überhaupt nicht, Bana Heris Leute seien alle zerstreut.
[S. 165]
Als ich, nachdem ich von der ursprünglich westlichen Richtung nach Süden abgebogen war, am späten Nachmittag des 27. Dezember mit der Tête der Expedition auf den Höhen nördlich von Mlembule eintraf, erhielten wir plötzlich heftiges Feuer, und zwar wie wir aus dem Pfeifen der Kugeln hörten, zum größten Teil aus Hinterladern (fast alles Snider-Gewehre) von sämtlichen die Höhe umgebenden Waldlisieren. Ich ließ die bei mir befindliche Abteilung, die Askari unter Illich, das Feuer gegen die Rebellen sofort eröffnen, und das Maxim-Gun, das gleich dahinter folgte, durch den Feldwebel Schulte in Thätigkeit setzen. Auch die Abteilungen unter Bülow und Johannes entwickelten sich, sobald sie herangekommen waren, und es gelang bald, die westlichen und südlichen Lisieren zu säubern, wobei die Rebellen sehr erhebliche Verluste erlitten.
Schon begann ich zu glauben, die Mitteilung unserer gefangenen Führer, die Leute Bana Heris seien im Gelände überall zerstreut und hätten ihre Hauptmacht nicht in einer befestigten Stellung versammelt, sei richtig, da die Rebellen sich uns in dem allerdings sehr coupierten, aber doch nicht befestigten Terrain mit Feuerwaffen entgegenstellten. Ich sandte Herrn von Bülow mit 50 Mann zur Verfolgung der in hellen Haufen fliehenden Feinde nach Süden, und Lieutenant Johannes nach Westen. Ich selbst setzte mit den übrigen Soldaten der Kompagnie von Bülow, den Askaris und dem Maxim-Gun das Feuer gegen die im Osten und Südosten noch standhaltenden Gegner fort. Als ich endlich auch diese in ungeregelter Flucht in der Richtung auf Sadani zu davoneilen sah, wollte ich eben die Verfolgung dahin aufnehmen nachdem ich den übrigen Abteilungen sowie der hinter uns befindlichen, von den Sudanesen gestellten Bedeckung für den bewußtlosen Lieutenant Fischer und dem Gepäck unter Führung eines Europäers Sadani als Sammelpunkt angegeben. Da eilte plötzlich ein ganzer Haufen Zulus von der Bülowschen Kompagnie aus der gegenüberliegenden Lisiere heraus. Außerdem kam ein Mann mit einer schriftlichen Meldung von Herrn von Bülow, seine Abteilung habe sich plötzlich bei der Verfolgung der Fliehenden vor einer starken Buschboma befunden; er habe sofort durch die noch offene Thür hineinstürmen wollen, habe[S. 166] aber heftiges Feuer erhalten und dabei den Sergeanten Ludwig und vier Zulus verloren. Die andern Zulus seien, durch diesen plötzlichen Verlust und das heftige Feuer entmutigt, feige geflohen; er allein mit acht Zulus halte noch vor der Boma.
Da Lieutenant Johannes mit seiner Abteilung weiter westlich noch mit der Säuberung des Geländes beschäftigt war, waren nur disponibel die Askari, 50 Zulus und das Maxim-Gun; mit diesen eilte ich sofort an die Stelle, wo die Boma sein sollte, Herrn von Bülow zu Hilfe. Dieser hatte inzwischen unter dem heftigsten feindlichen Feuer auf seinen Schultern den gefallenen Sergeanten Ludwig bis etwa 50 Schritt von der Boma zurückgetragen.
Angesteckt von der Mutlosigkeit und Verzagtheit ihrer Kameraden waren auch meine eigenen Zulus durchaus nicht vorzubringen, ja nicht einmal zum Ausschwärmen in gerader Linie zu bewegen. Das Feuer des Maxim-Gun und unsere Salven schienen ohne jede Wirkung auf die Boma zu sein, obgleich wir, Bülow, Illich, Schulte mit dem Geschütz und ich nur etwa 25 Schritt von den Pallisaden entfernt standen, deren Thür inzwischen wieder verbarrikadiert war. Das ununterbrochene Schnellfeuer aus der Boma heraus auf uns, die wir ganz ungedeckt auf dem schmalen zur Boma führenden Pfade standen, hatte trotz der lächerlich geringen Entfernung minimale Wirkung, da die Kugeln alle viel zu hoch gingen. Der Eintritt der Dämmerung, bis zu der wir vor der Boma feuernd gestanden hatten, — d. h. wir Offiziere und Unteroffiziere und die Suaheli Askari, während die Zulus weiter hinten vorsichtig gedeckt lagen —, sowie auch unsere Verluste machten unsern schleunigen Abmarsch in freieres Terrain nötig. Glücklicherweise traf bald die Abteilung Johannes ein; dieselbe erhielt, da sie am meisten intakt und ohne Verluste war, auch zur Hälfte aus den aufs Beste bewährten Sudanesen bestand, den Befehl, den Rückzug zu decken. Die Arrieregarde aus den Sudanesen schlug die Rebellen, welche das Gelände geschickt benutzend auf uns noch feuerten, zurück, und war so trotz der unter den Zulus, dem Hauptkontingent meiner Truppe, eingerissenen Panik ein durchaus geordneter[S. 167] Rückzug ermöglicht. Weiter östlich in freierem Terrain blieben wir dann vollkommen unbehelligt und setzten unsern Marsch über Sadani nach Mkwadja fort, das wir am Nachmittage erreichten. Hier erfüllten wir die traurige Pflicht, dem braven Sergeanten Ludwig die letzten militärischen Ehren zu erweisen. Außer ihm waren auf unserer Seite noch neun Mann gefallen, ebensoviel waren außerdem verwundet. Die Verluste der Rebellen betrugen nach ihrer eigenen späteren Angabe ungefähr 50 Tote und eine Masse Verwundeter.
War das Gefecht auch ein unglückliches gewesen, so war doch ein Zweck meiner Expedition erreicht, nämlich die Stellung Bana Heris zu rekognoszieren, welche bisher noch von keiner unserer Expeditionen berührt worden war. Bald fand sich eine Fahrgelegenheit nach Sansibar, mit der ich Lieutenant Johannes absandte, um Major Wißmann Bericht zu erstatten und den Lieutenant Fischer ins Lazarett überzuführen. In seinem Bericht an den Reichskanzler über dieses erste Gefecht bei Mlembule sagt der Reichskommissar unter anderm:
»Wenn dieses Gefecht als für uns ungünstig verlaufen hingestellt werden muß, so kann man der Truppe, die einen Kranken und einen toten Weißen und neun verwundete Soldaten aus dem Gefecht trug und sich bei Dunkelheit geordnet zunächst zur Küste hinab und am nächsten Tage nach Mkwadja zurückzog, in Berücksichtigung ihres erst kurzen Bestehens Anerkennung nicht versagen. Sobald ich Meldung über oben berichtetes Gefecht erhielt, traf ich Maßregeln zum nachhaltigen Angriff auf Bana Heri.«
Wißmann zog alsbald alle disponibeln Truppen vor Sadani zusammen und es kam zu uns S. M. S. »Sperber«, um uns mit den intakten Truppen von Mkwadja an Bord zu nehmen und auf die Rhede nach Sadani zu bringen. Die Truppen wurden gelandet, ohne daß die Rebellen uns zu hindern oder auch nur zu stören versucht hätten. Wißmann suchte sogleich einen Platz für die sich als notwendig erweisende Station aus, und wir befestigten daselbst zunächst das von den gesamten Truppen bezogene Lager in provisorischer Weise. Im Ganzen hatten wir 500 Soldaten zur Verfügung, 40 Europäer und fünf Geschütze (ein Maxim-Gun, zwei 4,7 cm und zwei 6 cm Geschütze).[S. 168] Die Leute wurden in zwei Bataillone eingeteilt, das eine bestehend aus einer Sudanesen- und drei Zulu-Kompagnien unter Chef von Zelewski, das andere unter meinem Kommando, zusammengesetzt aus zwei Sudanesen-Kompagnien und den vereinigten Suaheli-Askari. Die Tage bis zum 3. Januar 1890 wurden dazu benutzt, die Truppen ordentlich einzuexerzieren und in die Hand ihrer zum Teil neuen Führer zu arbeiten. Besondere Mühe wurde natürlich nach den Erfahrungen bei Mlembule auf die Zulus verwendet.
Eine von mir mit Lieutenant Johannes und 80 Mann unternommene Rekognoszierung konstatierte, daß die Rebellen uns in der bewußten Buschboma erwarteten. Der 4. Januar war vom Reichskommissar zum Angriff bestimmt worden. Die Marschordnung war folgende: 1) 2. Bataillon unter meinem Kommando, 2) Artillerie unter Chef Krenzler, 3) 1. Bataillon unter von Zelewski.
Um 4 Uhr morgens brachen wir von Sadani auf, und kurz nach 6 Uhr trafen wir in Mlembule ein. Mit einem Bajonettangriff nahm ich zunächst eine unterhalb der Bana Heri'schen Buschboma gelegene ehemalige Befestigung ein, deren Palissaden die Aufständischen niedergerissen hatten, damit wir bei unserm Angriff hier nicht einen Stützpunkt und Deckung fänden. Um diese trefflich gelegene Position, von der aus einzelne Teile der Boma bequem zu sehen waren, entwickelte Wißmann seine Truppen. Unmittelbar bei jener Befestigung marschierte ich mit meinem Bataillon auf, rechts davon die Artillerie und Zelewski. Wir erhielten heftiges Feuer, wieder meist aus Hinterladergewehren, aus der etwa 400 m entfernten Boma und hatten auch gleich einige Verwundete. Es folgte ein 3-1/2stündiges Feuergefecht, teils Zugsalven, teils Einzelfeuer der Europäer; letzteres besonders, wenn es darauf ankam, bei der Boma auftauchende feindliche Trupps wirksam zu beschießen; endlich Feuer der Artillerie, die sich zunächst mit Granaten einschoß und dann Shrapnels aus den 6 cm Geschützen aufsetzte, welche gute Sprengpunkte erzielten. Nichtsdestoweniger hielten die Aufständischen in der Boma aus; allerdings wurde nach 2-1/2 Stunden ihr Feuer etwas schwächer. Es war wie wir später erfuhren, auf den Abzug einer Waniamuesikarawane[S. 169] zurückzuführen, welche Bana Heri auf dem Sadani-Wege abgefangen und zu seiner Unterstützung mit Gewalt gezwungen hatte. Ein Teil der feindlichen Wasegua umging, gedeckt durch das Dickicht, welches unsern linken Flügel und die Boma deckte, unsere Stellung, so daß wir plötzlich von hinten Feuer erhielten. Wir brachten dieses aber mit einigen Salven sofort zum Schweigen. Das Feuer aus der Boma war immer noch heftig genug. In einzelnen Pausen hörten wir, wie es auch damals bei meinem ersten Angriff der Fall gewesen war, einen Vorbeter in der Boma zu Allah rufen, und die Menge von Zeit zu Zeit einfallen mit dem bekannten Allah Allah ill Allah.
Noch nie war uns während des Aufstandes ein solcher Fanatismus entgegengetreten. Bana Heri hatte es wohl verstanden, ihn zu schüren, und die Leute so zum Kampfeseifer gegen uns anzuspornen. Nach 3-1/2stündigem Feuer, als uns die Munition bereits knapp zu werden anfing, wurde die Sudanesen-Kompagnie des Zelewskischen Bataillons unter Führung des Lieutenants End nach links detachiert, um einen Weg, der nach der Boma führte, und den besten Angriffspunkt zu rekognoszieren. Der Süden und Südosten schien am wenigsten befestigt zu sein, während der Westen, wo wir das erste Mal angriffen, die stärkste Seite der Boma bildete. Als von der ersten Kompagnie die Meldung geschickt wurde, daß von der linken Flanke ein Weg nach der Boma führe, sandte mich der Major dahin, um nach Hinzutritt der Kompagnie End zu meinem Bataillon mit diesem den Sturm zu unternehmen. Bis zu meinem Eintreffen an der Boma, das ich möglichst gedeckt bewerkstelligen sollte, wollte er das gesamte Feuer der Artillerie und des Zelewskischen Bataillons gegen die Gegner richten, um sie noch im letzten Augenblick, soviel als möglich, zu erschüttern, und uns so den Sturm zu erleichtern. In dem Moment, wo ich an die Boma so nahe herangekommen wäre, daß ich mit dem Bajonett vorzugehen beabsichtigte, sollte ich durch dreimaliges Schwenken der vorangetragenen Fahne ihm ein Zeichen geben, daß das Feuer einzustellen sei. Wenn der Sturm gelungen sei, sollte ich die deutsche Flagge an den Palissaden aufpflanzen.
[S. 170]
Alles geschah wie verabredet. Wir gingen gedeckt im Grunde vor, bis wir 30 Schritt vor der Boma auftauchten und das Signal mit der Flagge gaben. Aus der Boma wurden wir mit einem anhaltenden Schnellfeuer empfangen, das mehrere Verwundungen herbeiführte, und zwar, da die Gegner diesmal zu tief schossen, nur Beinverwundungen. Ein Sudanese z. B. hatte vier Schüsse durch seine Beine. Nachdem wir noch eine Salve in die Boma geschossen hatten, ging es mit Hurrah vorwärts, worauf wir zunächst ebenfalls ein höhnisches Hurrah aus der Boma zurück erhielten. Es gelang jedoch, an verschiedenen Stellen Bresche zu reißen und in die Boma einzudringen, voran die zu meinem Stabe als Ordonnanz-Offiziere gehörenden Herren (Jahnke und v. Eltz) mit mir und die Europäer der unter uns rühmlichst bekannten Kompagnie End, gleich darauf Illich mit den Askari und die anderen Kompagnien.
Es war die härteste Arbeit, die bisher jemals bei der Einnahme einer feindlichen Stellung von den Truppen geleistet war. Bei unserem Eindringen flohen aber die letzten Gegner aus der Boma ins Dickicht der Umgebung. Die Freude über das Gelingen war unter den Soldaten so groß, daß sie, des Unterschiedes zwischen Offizier und Soldaten vergessend, alle zu uns, ihren Vorgesetzten, kamen und uns die Hände schüttelten, um sich gewissermaßen bei uns zu bedanken, während wir doch schließlich das, was wir geleistet, lediglich der Bravour unserer schwarzen Truppen, speziell der Sudanesen, zu verdanken hatten. In der Boma fanden wir eine große Anzahl Sprengstücke und Shrapnelkugeln, welche bewiesen, wie wirksam das Feuer unserer Artillerie gewesen war, und wie gut sich Chef Krenzler mit seinen Geschützen eingeschossen hatte.
Der Feind hatte sehr große Verluste gehabt, sodaß es zum ersten Male ihm nicht gelungen war, alle seine Toten mitfortzunehmen. Die intakteren Zulukompagnien wurden zur Verfolgung ausgesandt, die übrigens bei dem ungemein schwierigen Terrain von nur geringem Erfolge war, während wir an die Plünderung und Zerstörung der Boma gingen. Bei dem Gefecht hatten wir unsererseits 11 Verwundete, unter ihnen ein Europäer, der leicht verwundete Dr. Stuhlmann. Der[S. 171] Sergeant Tanner hatte das Unglück, daß ihm beim Laden eines Geschützes eine Granate den Arm zerriß. Tags darauf erlag er seinen Verletzungen.
Über die Boma sagt der Bericht des Reichskommissars folgendes:
»Die Boma war die stärkste, die ich je gesehen. Hinter 4 m hohen starken Palissaden waren mannshohe Erddeckungen aufgeworfen, die auch unseren Granaten widerstanden hatten. An den Ecken waren reguläre Bastionen erbaut, vor den Palissaden war ein freies Schußfeld von ca. 20 m, an das sich ringsherum die dichte, fast undurchdringliche Urwalddschungel schloß. Das Lager war bedeckt mit abgeschossenen Patronenhülsen, die bewiesen, daß der Feind hauptsächlich mit Hinterladern bewaffnet gewesen war. Der Feind hatte mit großer Bravour ausgehalten, jeder Baum in der Boma hatte eine große Anzahl von Schüssen aufzuweisen; die Shrapnels und Granatsplitter lagen überall im Lager umher. Leichen, die man nicht mehr hatte in den Wald schleppen können, zeigten Massen von Wunden.«
Und weiter:
»Der Kampf von Mlembule ist der erbittertste, den ich während der Zeit meines Wirkens hier geführt habe. Es erklärt sich dies aus folgenden Gründen. Bei der ersten kriegerischen Expedition, die ich durch Süd-Usegua gehen ließ, war die beschriebene Befestigung Mlembule nicht gefunden worden. Bana Heri hatte dagegen wahrscheinlich geglaubt, daß sie uns zu stark gewesen sei, um sie anzugreifen. Der Glaube an die Uneinnehmbarkeit hatte sich gesteigert durch den bereits gemeldeten abgeschlagenen Angriff meiner Truppen am 27. Dezember. Vor acht Jahren hatte Bana Heri die Truppen des Sultans Said Bargasch geschlagen. Bana Heri ist niemals besiegt worden. Er erkannte die Oberhoheit des Sultans von Sansibar an, soweit es ihm paßte, und erhielt jährlich Geschenke vom Sultan. Er hat sich nie Wali, sondern stets Sultan von Usegua genannt, und hatte, was besonders merkwürdig ist, während der Zeit des Aufstandes begonnen, eine Art religiöses Band um seine Anhänger zu schlingen. Aus diesen Gründen hat auch wohl Bana Heri meine mehrmals wiederholte Aufforderung, mit mir in Friedensverhandlungen zu treten, zurückgewiesen.[S. 172] Daß er Sadani nicht halten konnte, begründete er durch das große Übergewicht unserer Kriegsschiffe, wie überhaupt an der ganzen Küste die Ansicht herrschte, daß wir wohl unter den Geschützen der Marine oder mit weißen Soldaten ihnen überlegen seien, aber nicht im Lande, bis ich durch die Reise nach Mpapua und mehrere Gefechte im Innern ihnen diese Hoffnung nahm. Jetzt ist der Glaube an die Unbesiegbarkeit Bana Heris gründlich zerstört. Man hielt überall Mlembule für uneinnehmbar und kannte die große und besonders wohl bewaffnete Macht Bana Heris. Ein Zeichen dafür, wie ergeben die Südusegua ihrem Fürsten waren oder wie sehr sie ihn bisher fürchteten, ist der Umstand, daß es solange Zeit gelang, uns über den Verbleib und die Maßnahmen Bana Heris zu täuschen. Wir erfuhren stets, er treibe sich flüchtig im Lande umher, während er mit großem Fleiß und Geschick seine Befestigungen verstärkte. Außer der Besetzung von Sadani lasse ich die Schlupfwinkel für Dhaus an der Küste durch stationierte Fahrzeuge beobachten. Die Munition wird Bana Heri ziemlich ausgegangen sein.«
In den ersten Tagen nach der Erstürmung der Boma zu Mlembule ließ Wißmann den größten Teil des Expeditionskorps noch in Sadani versammelt, um, wie er es überall bei der Anlage von Stationen gethan, ihn zu den Befestigungsarbeiten heranzuziehen. Das war hier um so notwendiger, als der seit einiger Zeit gänzlich eingeäscherte Ort und die Umgegend im Umkreise von mehreren Meilen vollkommen von Menschen verlassen war, und der Platz nur von den Europäern und Truppen der Station wie einigen wenigen farbigen Handwerkern, die wir von andern Plätzen her engagiert hatten, bewohnt wurde. Ich erhielt den Befehl über die Station Sadani und wurde zugleich Chef des neu begründeten Distrikts der Stationsbereiche von Sadani und Mkwadja. Derselbe wurde im Süden durch den Wami begrenzt, wo der Distrikt Bagamoyo begann. Da Sadani nur als kleine Station geplant war, wurde die Umfassung ziemlich klein erbaut, und der Raum innerhalb derselben nach Möglichkeit für die Unterbringung der Europäer und der nötigen Gebäude ausgenutzt. In zwei Monaten gelang es mir, die Bauten im großen und ganzen fertig zu stellen.
[S. 173]
Während Wißmanns Abwesenheit von Bagamoyo hatte der Kommandant des »Sperber«, Kapitän Voß, — der überhaupt in der ganzen Zeit seiner Anwesenheit den Reichskommissar und uns alle aufs liebenswürdigste unterstützt und das regste Interesse für unsere Kolonien bewiesen hat — selbst mit seinem Landungscorps die Station besetzt gehalten und es so Wißmann ermöglicht, mit allen seinen Truppen bei Mlembule einzugreifen. Vor Mkwadja, der Station des Herrn von Perbandt, die unter Umständen ebenfalls einem Angriff Bana Heris ausgesetzt sein konnte, lag die »Schwalbe«, unter dem ebenfalls in den ostafrikanischen Küstenkämpfen vielgenannten und verdienten Korvettenkapitän Hirschberg. Sperber und Schwalbe wechselten sich bei der vom Reichskommissar erbetenen Blockierung der Küste in der nächsten Zeit ab, und sind uns auch sonst vielfach von Nutzen gewesen. So hatten wir zum Beispiel Gelegenheit kameradschaftlichen Verkehr zu pflegen, und in Krankheitsfällen ward uns von Bord aus öfters ärztliche Hilfe zu Teil, da wir in unserm Distrikt Sadani keinen Arzt hatten. —
Um über die weiteren Bewegungen Bana Heris zur Klarheit zu gelangen, und den Sieg bei Mlembule auszunutzen, wurde Herr von Gravenreuth mit 120 Mann und einer Verstärkung durch irreguläre Truppen zur Rekognoszierung von Bagamoyo aus abgeschickt. Von meiner Stationsbesatzung hatte ich ihm 50 Mann abgegeben, sodaß mir nur noch 80 Mann übrig blieben. Ich erhielt den Auftrag, soweit ich vermochte, die Verbindung mit Herrn v. Gravenreuth aufrecht zu erhalten, und ihn von Sadani aus, wenn er es wünschte, zu unterstützen. Durch Patrouillen hatte ich festgestellt, daß Bana Heri in einem 5 Stunden von Sadani entfernten Dorfe, namens Palamakaa, seine Leute gesammelt hatte. Gravenreuth marschierte zunächst nach der Missionsstation Mandera und teilte mir von hier aus durch Boten seine Absicht mit, am 29. Januar die Rebellen in Palamakaa anzugreifen. Ich machte mich daher schleunigst mit 30 Mann und 3 Europäern, dem Lieutenant v. Arnim, Herrn von Nettelblatt, der als freiwilliger Krankenpfleger auf meiner Station war, und dem Feldwebel Kay, dorthin auf den Weg, um zu rekognoszieren.[S. 174] Als Führer dienten wieder unterwegs aufgegriffene Eingeborene. Ich kam, wie beabsichtigt, am 29. früh dort an, dem Tage, an dem Gravenreuth, seinem Schreiben gemäß, ursprünglich angreifen wollte. Da ich jedoch nirgends etwas von ihm gewahrte, blieb mir nichts übrig, als nach einigem Aufenthalte nach Sadani zurückzukehren. Hier fand ich die Schwalbe vor, und war so in der Lage, ohne zu große Sorge um die Sicherheit meiner Station, im ganzen 40 Mann aus der Besatzung herauszuziehen, mit denen ich mich alsbald wieder auf den Weg machte, in der Annahme, daß Gravenreuth sich vielleicht durch unvorhergesehene Hindernisse verspätet habe und doch noch nach Palamakaa kommen werde. Als ich auf einem andern Wege auf der Höhe von Palamakaa anlangte, wurden wir aus den Büschen heraus von einem größeren auf uns einstürmenden Trupp angegriffen, schlugen denselben jedoch durch gutgezielte Salven zurück. Von Herrn von Gravenreuth war wieder nichts zu sehen und zu hören. In Sadani empfing ich von ihm einen Brief aus Mandera, vom 28. vormittags, er habe von Mandera aus auf dem Wege nach Palamakaa einige kleinere zu Bana Heri haltende Ortschaften genommen, sei bereits am 28., nicht wie er ursprünglich wollte, am 29. auf den Höhen von Palamakaa angekommen, und dort heftig von den Rebellen, die er auf 1200-1400 Mann schätze, angegriffen worden. Dabei sei Sergeant Bauer schwer verwundet worden. Durch die Stärke der gegnerischen Stellung, besonders aber durch die numerische Überlegenheit der Feinde, sowie den Umstand, daß die Zulus abermals versagten, sei er zum Rückzuge auf Mandera genötigt worden, der ihm, als sein erstes Zurückweichen, freilich bitter genug angekommen sei. Er müsse unter diesen Umständen auch ein gemeinsames Vorgehen gegen Bana Heri für zwecklos erachten, und wolle nach Bagamoyo eilen, um von dort aus Wißmann zu berichten. Es müsse wieder mit allen verfügbaren Truppen eingegriffen werden. Lieutenant Langheld war von Herrn von Gravenreuth zu Mandera in der Missionsstation zum Schutze derselben mit einer kleinen Besatzung zurückgelassen worden.
Einige Zeit vorher hatte der Reichskommissar das Expeditionskorps unter dem Kommando des Chefs Dr. Schmidt[S. 175] von Pangani aus zu Simbodja abmarschieren lassen, der ja, wie früher erwähnt, eine friedliche Einigung mit uns wünschte. In Begleitung von Dr. Schmidt befand sich der Kilimandscharo-Reisende Ehlers, welcher mit Geschenken Sr. Majestät des Kaisers zum Sultan Mandara wollte und Herr von Eltz, welcher im Auftrage Wißmanns den kleinen Posten am Kilimandscharo befehligen sollte.
Dr. Schmidt hatte zunächst in Lewa, der bekannten Tabaksplantage, eine Besatzung von 10 Mann unter Lieutenant von Behr zurückgelassen zum Schutze der Angestellten der Plantagengesellschaft, welche ihre Arbeiten wieder aufnehmen wollte. Von hier aus zog Schmidt weiter nach Masinde, dem Hauptsitze Simbodjas, wo er am 6. Februar eintraf.
Die Verhandlungen führten dazu, daß Simbodja sich vollkommen unterwarf, 1000 Rupies in Geld und circa 2800 Rupies in Elfenbein als Strafe für die Gefangennahme des Dr. Meyer und Dr. Baumann zahlte, die in seinen Händen befindlichen Hinterlader zurückgab und sich zum Gehorsam und zur Heeresfolge gegen uns verpflichtete. Andererseits wurde ihm die verantwortliche Beaufsichtigung des nördlichen Teils von Usambara übertragen gegen ein Gehalt von 100 Rupies oder etwa 150 Mark monatlich. Die deutsche Flagge, welche Simbodja von nun an zu führen hatte, wurde in Masinde gehißt.
Darauf ging Dr. Schmidt auf der großen Karawanenstraße weiter bis Gonja. Von hier aus zog dann Herr Otto Ehlers sowie Herr von Eltz auf dem von nun an sicheren Wege zum Sultan Mandara weiter. Von Gonja bog Dr. Schmidt nach dem Umba ab und kehrte von dort nach der Küste zurück. Er wurde hier bereits sehnlichst erwartet, da seine Truppen in der Aktion gegen Palamakaa mit verwandt werden sollten.
Der Reichskommissar zog alle verfügbaren Truppen wiederum in Sadani zusammen, so daß daselbst eine Macht von insgesamt 700 Mann mit 5 Geschützen versammelt war. Um, wenn möglich, überraschend zu erscheinen, wurde in der Nacht vom 8. zum 9. März um 11 Uhr der Abmarsch angetreten, in folgender Ordnung:
[S. 176]
1. Avantgarde: die aus dem Distrikt Sadani herausgezogene Stationsbesatzung (Rochus Schmidt);
2. 1. Bataillon (Dr. Schmidt);
3. 2. Bataillon (von Gravenreuth);
4. 3. Bataillon (von Zelewski).
Um 5 Uhr morgens trafen wir vor Palamakaa ein. Palamakaa ist ein Komplex von zehn Dörfern, welche alle in einem weiten, von den Usegua-Bergen umzogenen Thale liegen. Die ersten Dörfer, auf welche wir stießen, waren verlassen. Befestigungen wurden durch die absuchenden Patrouillen nicht gefunden und es wurde uns durch Gefangene bestätigt, daß größere Befestigungen nicht vorhanden seien. Die Gegner, durch die Erfahrung von Mlembule belehrt, daß sie auch in der stärksten Boma uns auf die Dauer keinen Widerstand leisten könnten, zogen es vor, das dortige sehr coupierte Terrain zu Kämpfen in einzelnen Abteilungen gegen uns auszunutzen.
Die uns entgegengeworfenen Trupps wurden mit leichter Mühe einzeln zurückgeschlagen und die im Thale gelegenen Ortschaften nach einander zerstört.
Am Nachmittag des 9. März wurde, nachdem alle unsere Abteilungen an den verschiedensten Stellen ins Gefecht gekommen und überall siegreich gewesen waren, ein gemeinsames Lager in etwas erhöhter Stellung bezogen, um von hier aus die Bewegungen des Gegners zu rekognoszieren.
In dieser für uns günstigen Stellung wurden wir noch am selben Tage von mutig und schneidig, aber vollkommen sinnlos draufgehenden Rebellentrupps von mehreren Seiten angegriffen, die aber, wennschon sie eine Zeit lang das Feuer gegen uns unterhielten, leicht abgewiesen wurden. Auch hier operierte Wißmann entweder mit Salvenfeuer, oder bei günstigen Gelegenheiten mit Einzelfeuer der Europäer.
Am späten Nachmittage wurden starke Patrouillen nach verschiedenen Richtungen hin ausgesandt, welche die noch auftauchenden Rebellen zurücktrieben und die noch nicht zerstörten Ortschaften einnahmen und verbrannten, bis auf eine verhältnismäßig stark besetzte, im Dickicht belegene Position, gegen die eine nur aus Schwarzen bestehende Abteilung nichts auszurichten vermochte. Hierhin wurde am Morgen des[S. 177] nächsten Tages Herr von Gravenreuth mit seinem Bataillon abgeschickt, der denn auch nach einer kurzen Beschießung mit Granaten und dem Maxim-Gun die Position nahm und den Gegner, soweit es das Gelände zuließ, verfolgte.
Der größte Teil der andern Truppen wurde zur Absuchung der weiteren Umgebung benutzt, doch wurden nur noch vereinzelt Rebellen angetroffen. Es stellte sich heraus, daß der Feind in den einzelnen Abteilungen, in denen er uns angegriffen hatte, nach den verschiedensten Richtungen abgezogen war und die Gegend verlassen hatte. Er hatte 40 Tote: 30 davon waren beim Sturm auf unser Lager gefallen, während bei uns nur der Oberbüchsenmacher Bauernschmidt, dem der Daumen der rechten Hand abgeschossen war, und vier Sudanesen verwundet waren.
Die meisten Aufständischen waren bereits vor dem eben beschriebenen Gefecht weggezogen, die noch vorgefundenen wurden auf etwa 400 geschätzt. Bana Heri selbst sagte später aus, daß er sich in der ganzen Zeit versteckt gehalten habe, weil er nach dem verunglückten Angriffe Gravenreuths einen Angriff der ganzen Schutztruppe wie bei Mlembule vorausgesehen habe.
Lebensmittel waren zu Palamakaa nur noch wenig vorhanden und die Stimmung der Eingeborenen wandte sich immer mehr und mehr von Bana Heri ab. Es wurde ihnen verboten, ihn in ihren Dörfern aufzunehmen und die Rebellen mit Lebensmitteln zu unterstützen.
Lieutenant Langheld war in Mandera mit einem Trupp von 50 Mann postiert worden und hatte den Befehl erhalten, auf flüchtige Trupps der Aufständischen zu fahnden; es gelang ihm auch, eine Schaar von Arabern und Wasegua zu zersprengen.
So konnte, da das Terrain von Palamakaa gesäubert war und eine weitere Verfolgung aussichtslos erschien, am 10. März der Rückmarsch nach der Küste angetreten werden, auf dem wir leider vier schwere und einige leichte Fälle von Hitzschlag hatten und zwar meist bei den erst vor einigen Tagen eingetroffenen Europäern. Es verstarben infolgedessen die Unteroffiziere Gombert und Witzick, welche dann in Sadani beerdigt wurden.
[S. 178]
Der aus Deutschland mit dem Transport neuer Offiziere und Unteroffiziere eingetroffene Major Liebert hatte am Gefechte bei Palamakaa in der Begleitung des Majors Wißmann teilgenommen und bereiste in der folgenden Zeit mit dem Reichskommissar sämtliche Stationen, um auf Grund dessen, was er sah und hörte, im Stande zu sein, die nächste Vorlage betreffs der Schutztruppe vor dem Reichstage zu vertreten. Auf dieser Besichtigungstour war ihm auch Gelegenheit gegeben, selbst mit einem Trupp farbiger Offiziere gegen einen Häuptling, der sich gegen den in Lewa stationierten Offizier aufgelehnt hatte, im Verein mit Dr. Bumiller einzuschreiten.
Mit Bana Heris Macht im Hinterlande von Sadani war es, wie erwähnt, nach jenem Gefecht bei Palamakaa zu Ende. Dazu zwang ihn und seine Leute der Hunger, mit uns in Unterhandlungen zu treten, die durch den neu eingesetzten Jumbe von Mkwadja vermittelt wurden.
Da der Reichskommissar den Einfluß Bana Heris auf die Bevölkerung von Usegua ausnutzen wollte, wurde ihm anbefohlen, sich mit seinen Leuten an einem bestimmten Tage auf der Station Sadani einzufinden. Der Befehl über Sadani war nach dem Gefecht bei Palamakaa auf den Lieutenant Sigl übergegangen. Der Verfasser hatte zu dieser Zeit den Auftrag erhalten, im Verein mit Dr. Stuhlmann die Expedition des Dr. Emin Pascha, welche in einem besonderen Kapitel behandelt werden wird, Soldaten, Träger und Lasten zusammenzustellen.
Im Auftrage des Reichskommissars sollte Herr von Gravenreuth in Sadani die Verhandlungen wegen der Übergabe Bana Heris zu Ende führen. Korvettenkapitän Valette, der älteste Offizier der Marinestation, hatte auf die Bitten des Reichskommissars dem Kommandanten des »Sperber« den Befehl erteilt, nach Sadani zu gehen, um dort für den allerdings von vornherein ziemlich unwahrscheinlichen Fall, daß der mit bedeutender Macht heranrückende Bana Heri ein falsches Spiel triebe, zur Hand zu sein. Die Besatzung der Station Sadani bestand nur aus 50 Mann, dem Stationschef Sigl, Lieutenant von Arnim, Dr. Freiherr von Nettelblatt[S. 179] und 3 Unteroffizieren. Der »Sperber« hatte den ausdrücklichen Befehl, nach 24 Stunden wieder nach Sansibar zurückzukehren.
Am 3. April nachmittags fuhr Gravenreuth auf der »München« nach Sadani hinüber. In seiner Begleitung befanden sich der Wali von Pangani, Soliman ben Nassr, durch den im Verein mit dem uns ergebenen Jumbe von Mkwadja Bana Heri die Unterwerfungsverhandlungen mit dem Reichskommissar geführt hatte, und Bana Omari, ein Sohn Bana Heris. Nach der Ankunft in Sadani begab sich Bana Omari sofort ins Innere in die Gegend von Palamakaa, um Bana Heri die Nachricht von der Ankunft Gravenreuths zu überbringen mit der Aufforderung, sich nun selbst in Sadani zwecks der näheren Verhandlungen einzufinden. Bereits in den letzten Tagen hatte sich in der Station von Sadani eine Reihe von Leuten Bana Heris eingefunden, da derselbe nicht mehr in der Lage war, seine Anhänger zu ernähren. Der Hunger trieb dieselben, sich an uns Deutsche an der Küste zu wenden. Sie wurden auf der Station aufgenommen, untergebracht, verpflegt, leisteten drei Tage lang wahrhaft unglaubliches im Essen und Schlafen und meldeten sich dann zur Arbeit.
Am 4. April, Freitags, traf der »Sperber« vor Sadani ein; am Sonnabend kamen Boten von Bana Heri mit der Nachricht, derselbe könne erst am nächsten Tage erscheinen, da er krank sei und nur langsam marschieren könne. Da er aber auch an diesem Tage, dem Ostersonntag, bis Mittag nicht erschienen war, mußte der »Sperber« infolge des erhaltenen Befehls abdampfen und nach Sansibar zurückkehren. Fast in demselben Augenblick, als der Sperber Anker aufging, erschien im Gelände hinter der Station der Jumbe von Mkwadja mit zwei Begleitern und der Meldung, daß Bana Heri ihnen auf dem Fuße folge. Gleich darauf sah man von der Station aus eine lange Menschenreihe sich auf diese zu bewegen, voran eine weiße Fahne, das Zeichen des Friedens. Der Schall der Negertrommel wurde gehört. Dann erschien eine zweite weiße Fahne, gleich darauf von andrer Seite her ein dritter Trupp: — Bana Heri war im Anrücken.
[S. 180]
Die ganze Gesellschaft hielt zunächst vorsichtig in dem Bett eines nur zur Regenzeit Wasser enthaltenden Flusses dicht bei der Station. Omari, Bana Heris Sohn, löst sich aus den Reihen und begiebt sich nach der Station hin, aus der ihm schon der Stationschef Sigl und Lieutenant von Arnim entgegengehen. Er erhält die Weisung, Bana Heri habe sich mit seinen ganzen Truppen in der Ebene hinter der Station zu lagern. Innerhalb der Station war alles bereit. Die Geschütze waren geladen, ebenso standen die Soldaten fertig, doch war Europäern und Sudanesen streng verboten, sich auf den Bastionen und an der Brustwehr zu zeigen, um nicht den Leuten Grund zum Mißtrauen und zur Furcht zu geben, und so im letzten Augenblick ein allgemeines Ausreißen zu veranlassen.
Es wälzt sich nun die ganze Masse in die Ebene, etwa 400 Mann an der Zahl. Voran geht eine seltsame Gestalt, von dem Kopfe stehen nach beiden Seiten zwei mächtige, aufgerichtete Adlerflügel ab, den Rücken bedeckt ein Löwenfell, perlengestickte Bänder hängen vom Körper herab, — so trippelt der Zauberer und Vortänzer, denn er ist es, in kurzem Trabe und in Schlangenlinien vor dem Zuge her, beschreibt Kreise und läuft unermüdlich hin und her. Ihm folgen drei Trommler, auf mächtigen Gomas (Negertrommeln) einen langen Wirbel schlagend, dann die weißen Fahnen, ihnen nach die Krieger, Araber, Belutschen, Sklaven, Waniamuesi, Wasegua, alle möglichen Stämme. Die meisten Leute sind sehr gut, viele Araber prächtig gekleidet, einige Neger befinden sich im Kriegsschmuck mit aufgerichteten Federbüscheln bedeckt. Fünf buntgeschirrte Esel befinden sich im Zuge. Fast alle Leute sind mit Gewehren bewaffnet, nur etwa dreißig tragen Speere oder Bogen und Keulen. So bewegt sich der Zug auf die Station zu. Da der ihnen angewiesene Platz gerade unter der Mündung des großen Feldgeschützes liegt, — für den Neger ein höchst verdächtiger Umstand, — so bitten sie, im Grunde des oben erwähnten trockenen Creeks lagern zu dürfen.
Hier findet das unvermeidliche, unendliche Schauri statt: Stationschef Sigl und der Wali von Pangani verhandeln mit[S. 181] Bana Heri. Dieser wieder macht Schauri mit seinen Leuten, das länger als drei Viertel Stunden dauert. Endlich kommt es zu einem Resultat. Stationschef Sigl meldet Herrn von Gravenreuth, Bana Heri ließe seinen Salaam sagen und bitte um die Erlaubnis, ihn selbst begrüßen zu dürfen. Er sei in ganz friedlicher Absicht gekommen; was ihn beträfe, so sei der Krieg aus und vorbei, und er unterwerfe sich allem. Zu bitten habe er folgendes: Er sei heute mit seiner besten Macht gekommen, um in möglichst feierlicher Weise seine Unterwerfung zu erklären; nun habe er noch 500 Mann in seinem Lager bei Palamakaa, ebenso seien dort die Weiber und die Kinder und das ganze Gepäck. Zu essen hätten sie garnichts, Munition ebensowenig. Herr von Gravenreuth möge gestatten, daß er selbst mit einer Abteilung wieder abzöge, um jenes Lager herbeizuholen, bezw. die Leute in ihre Dörfer zu entlassen. Die andern Abteilungen sollten in der Nähe sich niederlassen dürfen. Es möchten ihnen Schutzbriefe gewährt werden.
Alle Punkte wurden zugestanden. Sogleich kam das ganze Lager auf die Beine und im feierlichen Zuge in der vorher beschriebenen Ordnung nähert sich die Menge dem vorderen Eingange zum Fort. Der Zauberer und die Fahnenträger pflanzten sich im Hofe auf und Gravenreuth begiebt sich mit den übrigen Europäern hinunter an den äußeren Eingang. Hier harrte Bana Heri, sein Sohn Abdallah, Omari, Jehasi, mehrere Araber, 14 Jumbes und die ganze Macht.
Bana Heri selbst trägt ein gelbseidenes Araberhemd, den Kopf von einem blauen, glatt anliegenden, hinten zu einem Knoten geschürzten Tuche umwunden. Im Gürtel steckt der prächtige Maskatdolch. Als Herr v. Gravenreuth auf ihn zutrat, legte er die Hand zum Gruße an die Stirn, ergriff dann mit beiden Händen Gravenreuths Rechte und begrüßte ihn mit »Jambo, jambo sana, jambo sâânââ« (sei gegrüßt, sei herzlich gegrüßt, sei auf das allerbeste gegrüßt). Dann fügte er hinzu: »Ach, Herr, wäre ich doch Deinem Briefe gefolgt!« (Herr von Gravenreuth hatte ihn schon bei Ausbruch des Aufstandes zur Übergabe aufgefordert.) Das Ganze machte den Eindruck, als ob Bana Heri außerordentlich froh sei, den Krieg beendigt zu sehen. Mit großer Herzlichkeit schüttelte er allen Anwesenden[S. 182] die Hände. Dann bat er selbst nochmals, sogleich abziehen zu dürfen, was ihm erlaubt wurde, zumal ein schrecklicher Regen den Aufenthalt im Freien im Augenblick besonders lästig machte und alle bis auf die Haut durchnäßte. Bana Heri versprach noch, in spätestens vier Tagen wieder zurück zu sein, bat, sich wieder in Sadani niederlassen und vorher nach Sansibar kommen zu dürfen, um Major Wißmann seinen Salaam zu sagen. Er erhielt Reis und Matama und nach vielen herzlichen Danksagungen und Salaams zog er ab.
Abdallah, Omar, Jehasi und die Jumbes blieben im Fort zurück, um ihre Schutzbriefe zu erhalten. Jehasi erklärte sehr vergnügt, nun sei aller Krieg vorbei, sie hätten absolut nichts mehr zu essen gehabt. Dann sprach er voll Bewunderung von unserm Maximgeschütz, welches bei Palamakaa in Tätigkeit war, und dessen Wirkung er auf eigentümliche, hier nicht wiederzugebende Weise deutlich machen wollte. Das Geschütz sei ihm, obwohl er sich sehr gut auf Kanonen verstünde, absolut unerklärlich.
Bana Heri persönlich sandte später als äußeres Zeichen seiner Unterwerfung an den Reichskommissar sein arabisches Schwert.
Die Jumbes der Umgebung von Sadani, welche sich mit den Truppen eingefunden hatten, wurden mit Schutzbriefen versehen, und alles zog wieder ab, um sich in der nächsten Zeit in Sadani anzusiedeln und den Ort wieder aufzubauen.
Der Aufstand im Norden war mit der Unterwerfung Bana Heris erledigt. Im ganzen hatte letzterer nach dem Gefecht bei Palamakaa immerhin noch 1200 Leute gehabt, die sich nun, soweit sie nicht in Sadani selbst sich wieder ansiedelten, nach Mkwadja, Uwindji, Windi oder Mlembule wandten und alle unter der Kontrolle der Stationschefs von Sadani und Mkwadja standen.
Es ist sowohl in Afrika von eifrigen, mit den Verhältnissen nicht vertrauten Offizieren der Schutztruppe und Beamten wie in Deutschland vielfach darüber geklagt worden, daß Wißmann, der doch mit Buschiri kurzen Prozeß gemacht hätte, gegen Bana Heri eine allzu große Langmut bewiesen habe,[S. 183] und es wird die Milde, die er gegen Bana Heri und gegen den bereits früher erwähnten Simbodja hat walten lassen, ihm als Schwäche oder als Inkonsequenz ausgelegt. Ich habe schon bei Buschiri darauf hingewiesen, daß Gründe, diesen Rebellenführer zu schonen, absolut nicht vorlagen, weder Milderungsgründe für ihn, noch Nützlichkeitsgründe für uns. Bei Bana Heri und Simbodja lag die Sache anders. Abgesehen davon, daß Bana Heri, der die Übergabe-Verhandlungen, wie erwähnt, durch Soliman ben Nassr und den Jumbe von Mkwadja hatte führen lassen, eine Schonung seiner Person und der Leute, die sich dem Reichskommissar stellten, als Grundbedingung gestellt hatte, war für Wißmann ganz besonders die Absicht maßgebend, aus dem großen Einfluß, den Bana Heri in Usegua und Nguru ausübte, für uns Nutzen zu ziehen.
In dieser Berechnung hat sich der Reichskommissar nicht getäuscht. Bana Heri sowohl, wie seine viel schwieriger zu behandelnden Söhne haben sich nicht nur stets ruhig verhalten, sondern auch die vorher öfters beunruhigte Sadanistraße durch Usegua und Nguru in Ordnung gehalten. Verfasser selbst hat im vergangenen Jahre in Nguru, das durch Krieg stark heimgesucht war, durch die Benutzung des Einflusses Bana Heris und seines Sohnes Abdallah den Frieden auf die einfachste Weise wieder hergestellt.
Simbodjas Vergehen ist nur gewesen, daß er durch die Ereignisse an der Küste sich auch seinerseits im Innern zum Aufstand aufreizen ließ und dem Gebote Buschiris Folge leistete. Er folgte auch diesem Zwange, als er Dr. Meyer und Dr. Baumann auf Buschiris Befehl festnahm. Daß er dann ein Lösegeld auch für sich erpreßte, ist noch kein Grund, ihn zu opfern.
Das Urteil der mit den Verhältnissen im Hinterland von Pangani vertrauten Persönlichkeiten, — und das ist nicht das Urteil flüchtig das Land durchziehender Reisender, wie Dr. Meyer, sondern das Urteil der dort jahrelang thätigen Beamten und Offiziere, — geht dahin, daß der Einfluß Simbodjas uns von großem Nutzen ist und die Gegend vor den Übergriffen vieler kleiner Häuptlinge sichert. Voraussetzung dabei[S. 184] ist natürlich, daß Simbodja stets unsere Autorität vor Augen hat und gelegentlich ausdrücklich an dieselbe erinnert wird.
Erst später ist bekannt geworden, daß tatsächlich Mohammed ben Kassim, von dem noch an anderer Stelle gesprochen werden wird, mit 600 Mann aus Tabora und Udjidji zur Verstärkung Bana Heris herannahte. Wir hätten also noch ernste Kämpfe gegen Bana Heri zu bestehen gehabt, wenn nicht den Friedenswünschen desselben Gehör geschenkt worden wäre, und wir hätten uns dadurch der Möglichkeit beraubt, mit allen Mitteln an die Wiedereroberung des Südens zu gehen.
[S. 185]
Bedeutung Bagamoyos und der indischen Kaufleute. — Negerbevölkerung. — Station Bagamoyo. — Posten bei Mtoni. — Sicherung der Karawanenstraße durch die Station Mpapua. — Kleinere Posten. — Besetzung der Stationen. — Bauten. — Armierung. — Der Stationsdienst. — Machtbereich der Stationschefs. — Regelung des Karawanenverkehrs. — Viehankäufe. — Dienst der Gruppen auf den Stationen. — Die Rechtsprechung. — Verwendung der Walis und Akidas. — Verwendung mächtiger Häuptlinge im Innern. — Die deutschen Unteroffiziere.
Wir haben schon bei der Entwickelung der Geschichte des Aufstandes der Gründung einzelner Stationen Erwähnung gethan. Um ein richtiges Bild von der außerordentlichen Thätigkeit, welche hierbei seitens aller Angehörigen des Kommissariats entfaltet werden mußte, zu geben, um ferner den Plan Wißmanns zu verstehen, die Küste nicht nur wiederzuerobern, sondern ein für allemal militärisch und handelspolitisch zu sichern, muß auf die einzelnen Stationen an dieser Stelle eingegangen werden. Als wichtigste und erste derselben zählt naturgemäß Bagamoyo. In der Nähe der Kinganimündung in einer fruchtbaren Ebene Usaramos gelegen, hatte Bagamoyo vor dem Aufstand bereits die bei weitem höchste Bedeutung unter allen Küstenstädten erlangt. Hier mündet die große Karawanenstraße von Tabora und den Seen über Mpapua. Alljährlich erreichten etwa 80 Tausend Träger in Bagamoyo die Küste und zogen von hier wieder ins Innere hinein, der Stadt das Gepräge eines überaus regen Geschäftsverkehrs und Lebens verleihend.
Die Stadt selbst bestand bereits damals zum großen Teil aus Steinhäusern von mitunter bedeutendem Umfang, außerdem[S. 186] aus Negerhäusern, Lehmbauten oder einer Art Erdhütten, deren Herstellung in der Weise geschieht, daß ein Gerüst aus eng aneinander stehenden, harten Stämmchen aufgerichtet und wagerecht mit demselben Material überflochten wird, sodaß eine Unzahl kleiner Vierecke offen bleibt. Eine zweite Wand wird parallel zur ersten in derselben Weise aufgerichtet und der Zwischenraum mit fest gestampfter Erde ausgefüllt. Als Bedachung dienen Palmenblätter. Endlich bedeckten gewöhnlich ein Unzahl von Trägerhütten, lediglich aus Palmenzweigen erbaut, den Strand.
Die Bevölkerung der Stadt bildeten in erster Linie vornehme und reiche Araber, deren Schamben (landwirtschaftliche Plantagen) unmittelbar an Bagamoyo grenzten; ferner in weit größerer Zahl Inder und zwar Hindus, Mohammedaner, wenige Banianen. Die Inder haben in erster Linie den Kleinhandel und den Ladenverkauf in Händen und dienen ferner den indischen Großkaufleuten in Sansibar als Agenten, welche ihrerseits den Karawanenhandel, d. h. die Lieferung an Tauschartikeln und den Ankauf der gebrachten Produkte des Innern, vornehmlich Elfenbein, Sesam, Kopal und Erdnüsse völlig in ihre Hand gebracht hatten. Die eigentliche Negerbevölkerung Bagamoyos bestand nur zum geringsten Teil aus eingeborenen Wasaramos, zum bei weitem größeren Teil aus Mischlingsnegern der verschiedensten Stämme der Küste und des Innern, Mischlingen von Arabern und Negern, Suahelis und dergleichen mehr.
Die ständige Bevölkerung der Stadt dürfte etwa 15000 Seelen betragen, zu denen jedoch meist etwa 2-3000 gerade in Bagamoyo anwesende Träger, Waniamuesi oder Wassukuma, — häufig bedeutend mehr, — hinzukamen. So bildete Bagamoyo naturgemäß den Hauptkernpunkt des ganzen Aufstandes. Sein Name war bis in das tiefste Innere hinein bekannt. Der Begriff von Reichtum und Macht war mit ihm für jeden Neger unauflöslich verbunden. Es mußte daher natürlich die Hauptaufgabe des Reichskommissariats sein, diese Stadt dauernd in den deutschen Besitz zu bringen und vor jeder weiteren Berührung mit dem Aufstand ein für allemal zu schützen. Die Anlage der Station Bagamoyo wurde von vornherein in großartigem Maßstabe begonnen und durchgeführt.[S. 187] Zum eigentlichen Fort wurde ein umfangreiches, starkes Gebäude umgebaut, welches dem Inder Sewa Hadji gehörte, mit der Front nach dem Meere zu gelegen und nur durch einen etwa 300 Schritt breiten Raum davon getrennt. Ein aufgesetztes Stockwerk und ein angebauter Flügel gewährten Raum für die Unterbringung von Offizieren, Unteroffizieren und Bureaus. Um das Gebäude herum, teilweise daran sich anlehnend, zog sich eine starke Umfassungsmauer mit Eckbastionen; im Innern lehnten sich an diese Umfassungsmauer massive Wohnräume für die Besatzung. Die vordere Eckbastion des Forts bestrich mit ihren Geschützen die ganze Hauptstraße von Bagamoyo, wie denn überhaupt die Stadt unter das Feuer des Forts genommen werden konnte. Neben dem Hauptfort erhob sich am entgegengesetzten Ende der Stadt die sogenannte Zulukaserne, ein ebenfalls festes Steinhaus, in welchem das Expeditionskorps kasernierte.
Noch weiter nach Nordwesten war gegen die französische Mission hin der sogenannte Dundaposten, in einem kleinen kugelsicheren Steinhaus untergebracht.
Jedes einzelne der genannten Gebäude war mit einem starken Stacheldrahtzaun umgeben, das Schußfeld durch Rasieren der Bäume und Sträucher frei gemacht. Um eine noch größere Sicherheit für die gesamte Stadt herbeizuführen, hatte man in der ersten Zeit, als die Scharen Buschiris noch überall in der Nähe waren, die ganze Stadt mit einem Stacheldrahtzaun als erstes Hindernis gegen die Annäherung umgeben. Bagamoyo war ebenso wie alle anderen noch zu erwähnenden größeren Stationen für unsere afrikanischen Gegner durchaus uneinnehmbar.
Die Wichtigkeit des Platzes erforderte jedoch, daß auch der weitere Umkreis, besonders die dorthinführenden Straßen dauernd in unsern Machtbereich gebracht wurden. Eine Menge Karawanen waren bei Ausbruch des Aufstandes mit ihren Elfenbeinschätzen, mit Gewehren und Munition aus dem Innern nach Bagamoyo unterwegs. Es mußte dafür gesorgt werden, daß diese Karawanen den Aufständischen nicht in die Hände fielen und ihre Macht durch gangbare Werte und Waffen unterstützten.
[S. 188]
Der Reichskommissar beschloß daher von Anfang an auch die weitere Umgebung durch Posten zu sichern. Als wesentlichsten dieser Posten führen wir hier Mtoni an. Mtoni liegt an der Stelle, nur etwa 6 Stunden von Bagamoyo entfernt, wo die Karawanen den Kingani-Fluß zu überschreiten haben, und wäre dies für die Aufständischen der geeignetste Punkt für Angriffe gewesen. Hier wurde daher in einem aus Wellblech erbauten, durch Erdbewurf und Stacheldraht geschützten Hause ein Posten von 12 Sudanesen unter einem weißen Offizier und einem Unteroffizier untergebracht, welcher für den Schutz des Überganges vollkommen ausreichte. Um das früher übliche, zeitraubende Übersetzen der Karawane durch einen Einbaum (Eingeborenen-Canoe) aus der Welt zu schaffen, stellte der Reichskommissar ein großes Stahlboot zur Verfügung.
Von ausschlaggebender Bedeutung jedoch für die Sicherung der Karawanenstraße und die Erhaltung des Handels von Bagamoyo war die Station Mpapua. Wir haben bereits bei der Expedition nach Mpapua einige Streiflichter auf die Wichtigkeit des Punktes in strategischer Rücksicht geworfen. Mpapua bildet aber, und dies ist von ungleich größerer Bedeutung, den Hauptknotenpunkt aller Karawanenstraßen, welche aus dem Seengebiet zur Küste führen. Alle die vom ganzen Gebiet des Tanganjika über Tabora laufenden und dann nach verschiedenen Richtungen sich teilenden Karawanenwege vereinigen sich wieder in Mpapua. Auch die vom Südufer des Viktoria Nyanza und von der Westküste desselben aus Uganda, Unioro, Karagwe kommenden Karawanen wählen den Weg über Mpapua. Die Sicherung dieses Punktes war daher von der allergrößten Bedeutung. Daß Buschiri seine Wichtigkeit erkannt hatte, beweist sein Überfall der Station der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft.
Abgesehen von der Sicherung des Karawanenweges diente die Station aber auch zum Schutze der fruchtbaren und reichen Thäler von Inner-Usagara und bildete auf der andern Seite für Ugogo, das berüchtigte Räuberland im Westen, und für die Massais im Norden, sowie für Uhehe im Süden eine Kräftigung unseres Ansehens.
[S. 189]
Bei den damals vorhandenen Machtmitteln war die Begründung der Station Mpapua mit ihrer starken Besatzung ein erfreulicher, nach den damaligen Verhältnissen genügender Schritt zur Sicherung eines Küstenstreifens von mehr als 300 km Breite. Es war dies eine Aufgabe, deren Lösung durch Wißmann als ein Meisterstück richtiger strategischer Einsicht angesehen werden muß, denn die Besetzung von Mpapua und die Errichtung des Forts daselbst ist thatsächlich der erste Schritt zu einer wirklichen Beherrschung unseres Gebietes.
Zum Interessenbereich von Bagamoyo gehört ferner noch die kleine Station Bueni mit einer Besatzung von durchschnittlich 20 Sudanesen. Sie bildete gleichzeitig einen Beobachtungsposten für den südlich gelegenen Platz Kondutschi, von dem aus ein schwungvoller Schmuggelhandel sowie Sklavenausfuhr stattfand. Endlich ist dahin zu rechnen der kleine Beobachtungsposten bei Mandera, welcher hauptsächlich dem Schutz der dortigen Missionsstation bei den Wadoës diente.
Den südlichen Teil von Usaramo deckte als Hauptstation Daressalam mit einer Besatzung von 60-70 Sudanesen und einem kleinen Posten am Hafeneingang. Bei der größeren Sicherheit, welche in diesem vom Aufstand erst später und in geringerem Maße berührten Teile Usaramos geherrscht hatte, schien es unnötig, weitere befestigte Stationen hier anzulegen.
In Usegua indes schien stärkere Machtentfaltung durchaus geboten und die eigenartige Stellung, welche Bana Heri den Eingeborenen gegenüber einnahm, ließ ihn als einen gefährlicheren Gegner erscheinen, denn Buschiri selbst. Es lag in der ursprünglichen Absicht des Reichskommissars nach der mehrfachen Beschießung von Sadani die Stadt ganz vom Erdboden zu vertilgen und die Handelsbeziehungen nach Mkwadja, nördlich von Sadani und etwa 30 km entfernt, hinüberzuführen. Mkwadja erhielt daher eine ziemlich feste Station und 50 Mann Besatzung.
Die Absicht Wißmanns zeigte sich jedoch bald als undurchführbar. Araber sowohl wie besonders Karawanenführer und Träger hängen mit überaus großer Zähigkeit an dem einmal von ihnen begangenen Wege. Es zeigte sich außerdem noch[S. 190] während der Kämpfe, daß die Eingeborenen und Bana Heri selbst unmittelbar nach den Bombardements die Stadt immer wieder aufbauten. Bei letzterem kam, abgesehen davon, daß er Sadani nun einmal als angestammten Herrschersitz betrachtete, noch ein religiöses Moment hinzu: es befand sich dort das Grab seiner Mutter.
So stellte sich sehr bald die Notwendigkeit heraus, Sadani ebenfalls zur Militärstation zu machen. Während der Kämpfe gegen Bana Heri erhielt es eine Besatzung von 130 Mann und beherbergte zeitweise noch das Expeditionskorps; später wurde die Besatzung auf 50 Sudanesen vermindert.
In Usambara sind die Hauptstationen Pangani mit einem Posten in Rasmuhesa und einem zweiten Posten in Lewa, 25 km nordwestlich von Pangani, zum Schutz der dortigen Plantagen der Ostafrikanischen Plantagengesellschaft; endlich Tanga, letzteres ohne detachierte Posten. Zur Sicherung der Karawanenstraße, welche vom Kilimandscharo herunter nach Tanga oder Pangani führt, wurde am Kilimandscharo in Moschi, im Gebiet des uns befreundeten Häuptlings Mandara, ein Fort angelegt.
Die bisher genannten 14 Stationen und kleinen Posten bestanden bereits im Anfang des Jahres 1890 nach kaum dreivierteljähriger Thätigkeit des Reichskommissariats. Sie wurden insgesamt mit Besatzungen versehen aus dem damals noch nicht 1000 Mann starken ersten Soldatenkontingent; und zwar zählten die größeren Stationen zwischen 100 (Mpapua) und 40 (Tanga) Mann, die kleineren zwischen 20 (Moschi am Kilimandscharo, Bueni) und 10 (Mandera, Lewa). Außerdem waren noch Expeditionstruppen in der Gesamtstärke von 300 Mann vorhanden.
Sämtliche Stationen sind, — denn auch der sehr bewährte spätere Bauleiter Wilkens hat seine Schule erst in Afrika gemacht, — ohne Zuhilfenahme der gänzlich mangelnden Sachverständigen durch die Offiziere, Unteroffiziere und die schwarzen Truppen angelegt und vollendet worden. Die Eingeborenen wurden lediglich zu Handlangerdiensten, wie zum Stein- und Erdtransport herangezogen. Wenn auch in vielen Fällen der Kern der Stationen in einem oder mehreren[S. 191] Araberhäusern vorhanden war, so mußten diese Gebäude doch jedesmal mehr oder weniger umgebaut, für den Gebrauch der Europäer passend eingerichtet und ausgebessert werden. Umwallungen, Bastionen und Befestigungen mußten selbstverständlich erst geschaffen werden. Das Material an Steinen wurde aus den verfallenen oder zusammengeschossenen Araberhäusern der betreffenden Ortschaften genommen, teils aus den Korallenbänken gebrochen. Als Bauholz dienten sogenannte Boriti, harte Knüppel aus Mangrovestämmen. Provisorische Befestigungen oder Bauten wurden durchweg aus Wellblech in vollkommen zweckentsprechender Weise hergestellt.
Es mag gleich hier angeführt werden, daß nach der Herstellung geeigneter Wohnräume sich ein erheblich günstigerer Gesundheitszustand ergab, denn je zuvor. Die große Sterblichkeit unter den Beamten der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft vor der Zeit des Reichskommissariats ist zweifellos zum Teil auf die ungemein mangelhaften Wohnungsverhältnisse zurückzuführen. Nach der Erbauung der Forts mit ihren mitunter (wie in Bagamoyo und Daressalam) 15 Fuß hohen Zimmern und ihrer vorzüglichen Ventilation verminderten sich die Fiebererkrankungen in auffallender Weise.
Die Armierung der Stationen bestand aus 8 cm Feldgeschützen, 4,7 cm Geschützen, Revolverkanonen und Mörsern. Die Expeditionskorps führten 4,7 cm Geschütze und das Maximgeschütz mit sich, welche auseinander genommen und in einzelnen Stücken, die eine und zwei Trägerlasten bildeten, getragen wurden.
Eine besondere Berücksichtigung verlangte die Einrichtung des Stationsdienstes, welche am besten geeignet ist, das Vorurteil zu widerlegen, als ob es sich hier lediglich um eine Kriegsführung nach Landsknechtsart gehandelt habe, als ob, wie man in gegnerischen Kreisen in Deutschland so häufig behauptete, die Schutztruppe nur mit Morden, Sengen, Brennen und Aufhängen sich beschäftigt habe.
Die 7 großen Stationen standen jede unter einem Chef, dem die übrigen Offiziere untergeordnet waren. Die Zahl der letzteren schwankte je nach der Stärke und Wichtigkeit der Stationen, so zwar, daß dieselbe in Bagamoyo naturgemäß[S. 192] am stärksten sein mußte. Die Funktionen des Stationschefs waren in erster Linie die Instandhaltung der Station, ferner der Oberbefehl über die Stadt und die Umgebung derselben, Beaufsichtigung des Karawanenverkehrs, endlich die oberste Rechtsprechung in seinem Bezirk.
Wißmanns Absicht ging dahin, von vornherein den aus dem Innern kommenden Jumbes, Karawanenführern und Trägern klar zu machen, daß ein für allemal die Macht und Oberhoheit in deutschen Händen läge. Dafür gab es kein besseres Mittel als die Regelung des Karawanenverkehrs. Sämtliche Karawanen, welche Mpapua passierten, hatten bei dem dortigen Stationschef sich zu melden. Dort fand eine genaue Aufnahme der mitgeführten Waren, eine Zählung der Schußwaffen und Munition, sowie der Kopfzahl der Karawane, des mitgeführten Viehs u. s. w. statt.
Die Karawanenführer erhielten darüber eine Bescheinigung des Stationschefs und hatten dieselbe als Legitimation zunächst bei der Mtoni-Fähre zu präsentieren. Von der Fähre aus erhielten sie einen Sudanesen bis Bagamoyo mit, welcher den Begleitschein dem dortigen Stationsoffizier zur Prüfung vorzulegen hatte. Die Wirkung dieser Maßregel auf die Karawane, besonders auf die das Hauptträgerkontingent stellenden Waniamuesi und Wassukuma, sowie auf die Karawanenführer ist eine ganz erstaunliche gewesen und hat in außerordentlicher Weise zur Ausbreitung des deutschen Ansehens im tiefen Innern beigetragen. Allerdings brachte der Verkehr mit den Trägern und Führern der Karawanen unglaubliche Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten mit sich. Die Leute waren gewöhnt, sobald sie das Meer vor sich sahen, die Lasten ohne weiteres abzuwerfen, zum Strande hinabzueilen und sich ihre Laubhütte irgendwo aufzubauen, wo es ihnen gerade gefiel. Jetzt kam Ordnung in die Sache. Der Kirangosi (Karawanenführer) hatte sich mit den begleitenden Sudanesen auf der Station zu melden, die Karawane mußte ihre Lasten fein säuberlich nach den Warengattungen ordnen und niederlegen; das mitgeführte Vieh mußte in dafür errichtete Gehege gebracht werden; die Hüttenstadt endlich mußte an einem dazu bestimmten Platz am Strande möglichst ordentlich aufgebaut, resp. in Bagamoyo in[S. 193] neuerer Zeit das Lager bei der Karawanserei ordnungsmäßig aufgeschlagen werden. Dann begannen die endlosen Verhandlungen wegen Viehankauf. Es lag selbstverständlich im Interesse des Kommissariats, das aus dem Innern zur Küste geführte Vieh zur Vermeidung des Zwischenhandels von den Karawanen direkt zu kaufen. Einmal wurde dadurch eine außerordentliche Verbilligung in der Verproviantierung der Europäer erzielt, andrerseits waren die Chefs in der Lage, die Sudanesen vor Übervorteilung zu schützen. Endlich war immer ein Bestand für Expeditionszwecke zur Verfügung.
Das Kommando über die Stationsbesatzung lag unter der Oberleitung des Chefs in den Händen des diesem zugeteilten Offiziers. Der eigentliche Dienst der Truppe in den Stationen beschränkte sich, nachdem die schon früher beschriebene erste Ausbildung vollendet war, auf den Morgenappell um 6 Uhr, dann folgte Exerzierdienst bis 8 und noch einmal für ein bis zwei Stunden am Nachmittag. Der eigentliche Kasernendienst bestand lediglich im Putzen der Waffen und Waschen der Uniform, Instruktionsstunde fiel von selbst weg. Den wesentlichsten Teil der Zeit hatte die Garnison im Arbeitsdienst zuzubringen. Dieser Arbeitsdienst war naturgemäß sehr verschiedener Art und hing im Wesentlichen von dem Eifer des Stationschefs und seiner Untergebenen ab.
Die im Vorstehenden genannten Obliegenheiten waren die offiziellen, vom Reichskommissar den Chefs und Offizieren gestellten Aufgaben, welche unbedingt erfüllt werden mußten. Darüber hinaus aber blieb es jedem Chef überlassen, aus seiner Station zu machen, was er konnte, und gerade in dieser Beziehung entwickelte sich ein reger Wetteifer. Jeder versuchte, so viel als möglich die Umgebung des Forts zunächst zu einer reizvollen zu machen. Wege wurden gebaut, Gärten und Felder angelegt, Bäume gepflanzt, Akklimatisationsversuche angestellt und dergl. mehr. Bei allen diesen Arbeiten wurde die Besatzung herangezogen, und es ist gewiß als vortreffliche Eigenschaft unserer schwarzen Soldaten hervorzuheben, daß sie alle diese Arbeiten, allerdings unter dem Beispiel der weißen Unteroffiziere, für sich selbst zu einer Art Ehrensache machten und daß so der Wettstreit unter[S. 194] den Stationen sich innerhalb jeder einzelnen Besatzung wiederholte.
Wenn oben die Rechtsprechung durch den Chef angeführt wurde, muß hier eingefügt werden, daß sie nicht allein durch ihn geschah. Es wurde den Sitten und Gebräuchen, den religiösen und Rechts-Anschauungen der Leute durch Einsetzung der Wali und Akida Rechnung getragen. Sie wurden aus denjenigen vornehmen Arabern gewählt, welche beim Volk wohlangesehen und beliebt waren und von deren ergebener Gesinnung gegen uns wir überzeugt sein konnten. Sie bildeten demnach berufene Mittelspersonen zwischen den Stationschefs und der arabischen und eingeborenen Bevölkerung ebenso wie in manchen Beziehungen die Berater der ersteren. So nahmen sie gewissermaßen im Zivilleben eine Stellung ein, wie sie die farbigen Offiziere uns und der Truppe gegenüber hatten.
Die Funktion der Wali und Akida — den ersteren Namen führten sie in den größeren und bedeutenderen Plätzen, den letzteren in kleinen Orten, in denen nur eine geringe Besatzung und wenig Verkehr war — war zur Zeit der Beherrschung der Küste durch die Sultane von Sansibar die von größeren und kleineren Statthaltern. Selbstverständlich hat die jetzige Funktion dieser Leute hiermit nichts mehr zu thun. Sie sind lediglich Organe der örtlichen Behörden, der Stationschefs, und haben in der Rechtsprechung wie überhaupt in der Verwaltung nur diejenigen Obliegenheiten, die nach Lage der örtlichen Verhältnisse der betreffende Stationschef ihnen zuzuteilen für gut befindet.
Bei großer Überbürdung des Stationschefs wurde ein Teil der kleineren Gerichtsbarkeit den Walis insofern übertragen, daß sie die Urteile fällten, diese aber der Bestätigung der Chefs unterbreiten mußten. In manchen Stationen hatten die Walis noch eine Anzahl sogenannter Walisoldaten zu unterhalten, denen es oblag, notwendige Botendienste in der näheren und weiteren Umgebung zu verrichten, Vorladungen zum Schauri zu überbringen, auch Widerspenstige festzunehmen und dergleichen. Diese Walisoldaten sind insofern von großem Wert für uns gewesen, als sie den Verkehr zwischen uns und der eingeborenen Bevölkerung, soweit diese nicht in unmittelbarer[S. 195] Nähe der Station wohnte, bedeutend erleichterte. Außerdem erleichterten die Wali, ohne daß der deutsche Offizier und Beamte und die deutschen Soldaten sich bei jeder Kleinigkeit persönlich engagierten, in vielen Fällen eine Vermittlung, die immer viel eher zwischen dem Wali und der Bevölkerung möglich war.
Von den Walis verdienen einzelne Personen besonders erwähnt zu werden und zwar Soliman ben Nasr, welcher als Wali von Pangani dem dortigen Stationschef Dr. Schmidt nach der Einnahme von Pangani bei der Herstellung der Ruhe und Ordnung an diesem Platze durch sein Ansehen und ebenso später dem Reichskommissar, von Sansibar aus, zur Unterhaltung eines guten Einvernehmens mit den Arabern der gesamten Küste behilflich war; ferner der bekannte Schech Amer in Bagamoyo, welcher bei der großen Überbürdung der Chefs resp. Bezirkshauptleute von Bagamoyo diesen eine wertvolle Unterstützung war, besonders auch den hier in dieser großen Handelsstadt zusammenströmenden Arabern, Indern und Eingeborenen gegenüber große Repräsentationspflichten versah. Da diese Persönlichkeiten naturgemäß mehr im Leben des Volks selbst stehen als wir Europäer, und wir immer darauf angewiesen sind, durch unsere Vertrauenspersonen uns auf dem Laufenden zu halten und durch diese dem Volke näher zu rücken, so ist selbstredend die Loyalität und das Interesse der Wali für uns von höchster Wichtigkeit.
Daß solche Leute, die unter der Herrschaft der Sultane von Sansibar, wenn auch dort mehr indirekt, große Einnahmen gehabt haben, bei uns nach ihren Begriffen entschädigt werden müssen, ist selbstverständlich; und es kann nur als eine unerklärliche Kurzsichtigkeit und durchaus verfehlte Sparsamkeitsrücksicht bezeichnet werden, wenn, wie dies nach der Einrichtung des Gouvernements im vorigen Jahre geschehen ist, gerade diese bewährten, für uns so wichtigen eingeborenen Beamten in ihren Gehältern herabgesetzt wurden.
Es sei auch noch der an Stelle von Walis eingesetzten Persönlichkeiten im Innern gedacht, die an den Plätzen, wo keine Europäer sind, die Interessen des Reichskommissars vertraten,[S. 196] und die deswegen besonders wichtig für uns waren, weil man, falls sie notorische Macht ausübten, in ihnen immer Persönlichkeiten hatte, an die man sich bei vorkommender Unordnung halten und die man fassen konnte; aber auch Persönlichkeiten, die selbst für die Sicherheit ihrer Gebiete sorgten und daselbst die Ordnung aufrecht erhielten. Daß diese Leute, von denen wir hier in erster Linie Kingo von Morogro und den Häuptling Simbodja erwähnen, nicht immer absolut in europäischem Sinne regieren und auch nicht das deutsche Strafgesetzbuch kennen, ist selbstverständlich.
Sind doch alle Erfolge der Engländer auf das System zurückzuführen, die Eingeborenen in okkupierten Gebieten zunächst selbst herrschen zu lassen und diese hierfür sogar noch gut zu bezahlen. Die Eingeborenen empfanden die direkte Einmischung des Europäers unter Umständen hart, und zwar namentlich dann, wenn nicht die genügende Zahl von Landeskundigen und sonst geeigneten Persönlichkeiten zur Verfügung stehen.
Außerdem werden aber auch auf diese Weise große Ersparnisse erzielt, wichtig dann, wenn die Mittel zu einer genügenden Machtentfaltung, um direkt das Land zu beherrschen und zu verwalten, mangeln. Freilich ist die Behandlung mancher dieser Walis nicht leicht und erfordert Geschick und Takt, wie auch Strenge am richtigen Platze.
In der Besetzung der Stationen fanden unter den Offizieren naturgemäß häufig Veränderungen statt. Einmal forderten die Kriegszüge, Krankheitsfälle oder sonstige Rücksichten einen Wechsel der Chefs und Offiziere, oder aber es wurden untaugliche und wenig brauchbare Elemente kurzer Hand nach Europa zurückgeschickt und durch neue ersetzt.
Ein besonderes Lob verdient in jeder Beziehung das deutsche Unteroffizierkorps in Ostafrika. Die Stellung der Unteroffiziere war ja von vornherein eine eigentümliche, ja man kann sagen gänzlich isolierte. Die in Ostafrika anwesenden, nicht zur Schutztruppe gehörenden Europäer standen meistens nur im Verkehr mit den Offizieren, so daß Zivilverkehr für die Unteroffiziere selten oder nie vorhanden war. Die Ehrbegriffe, welche das Unteroffizierkorps aus Deutschland mitbrachte,[S. 197] verboten ihm von selbst den engeren Verkehr mit den unter ihnen stehenden Elementen. Auf der andern Seite ließ eben dieser Ehrbegriff sie stets den richtigen Takt, einerlei ob im dienstlichen Verkehr oder bei Festlichkeiten, beobachten und ließ sie ferner ihre Aufgabe als eine im Dienst des Vaterlandes zu leistende ansehen. Wenn diese Aufgaben grade bei den Unteroffizieren zuweilen weit über das Maß des Militärdienstes hinausgingen, so sind sie doch immer mit derselben Präzision, derselben Hingabe und demselben Geschick gelöst worden. Die Ausnahmen, welche allerdings vorkamen, können nur die Regel bestätigen.
[S. 198]
Lage und Entwickelung der nördlichen Stationen. — Major Liebert. — Reise des Generalkonsuls Dr. Michahelles nach Witu. — Einteilung des nördlichen Küstendistrikts. — Stationschefs im Norden. — Vermehrung der Schutztruppe. — Das neue Material erweist sich als minderwertig. — Neueinteilung der Schutztruppe. — Einexerzieren der neuen Söldner. — Verhandlungen mit dem Süden. — Rekognoszierungstour Wißmanns auf der »München« nach Kilwa. — Verhandlungen zur Mitwirkung der Marine. — Einschiffung und Einteilung der Truppen für den Süden. — Einnahme von Kilwa und Lindi. — Friedliche Besetzung von Mikindani. — Stationsgründungen im Süden. — Schlechter Gesundheitszustand der Truppen. — Verhandlungen mit den Eingeborenen. — Uebergabe der südlichen Stationen an die Chefs. — Allgemeine Lage bei der Urlaubsreise Wißmanns nach Deutschland.
Die Unterwerfung der Rebellen im nördlichen Teile unserer Küste und die Gewähr, welche die befestigten Stationen für eine dauernde und völlige Sicherheit der Städte und der Karawanenstraßen boten, erlaubten dem Reichskommissar, jetzt an die Lösung des zweiten Teils seiner Aufgabe zu gehen, an die Unterwerfung des Südens. Bevor der Leser jedoch in den eigentlichen Gang der Ereignisse daselbst eingeführt wird, möge es gestattet sein, noch einmal die Lage im Norden und eine Reihe von Thatsachen zusammenzufassen, welche in diese Zeit, — in die Monate März und April des Jahres 1890, — fallen.
In Tanga hatte sich die europäische Kolonie schnell vergrößert. Außer den Mitgliedern der ostafrikanischen und der Pflanzergesellschaft ließen sich einige Deutsche daselbst nieder, die aus privaten Mitteln Unternehmungen ins Leben rufen wollten. Der Missionar Krämer hatte die Gründung einer[S. 199] evangelischen Missionsstation in Angriff genommen; griechische Kleinhändler hatten sich dort, wie in allen von uns besetzten Küstenplätzen, etabliert und haben heute durch das mehrjährige Bestehen ihrer Geschäfte bewiesen, daß sie die Konkurrenz der Inder aushalten können.
An der Nordgrenze, in Muoa, wurde zwar noch viel Schmuggel getrieben, aber eine spätere Besetzung dieses Platzes war bereits ins Auge gefaßt. In Pangani hatte der, von Tanga dorthin versetzte Distriktschef Krenzler Nachricht von der Ankunft einer großen Sklaven-Karawane erhalten und es gelang ihm, obwohl die Sklaven, 207 an der Zahl, gleich auf die Schambas vertheilt worden waren, sie alle auf die Station bringen zu lassen. Wenn auch vernünftiger Weise gegen die äußerst milde Art der Haus- und Feldsklaverei nicht vorgegangen wird, so stand doch jede Zufuhr aus dem Innern, wie wir aus diesem Beispiel sehen, unter unserer Kontrolle. Am Kilimandscharo war Herr v. Eltz als Agent des Reichskommissars stationiert und seine Berichte über die Aufführung des dortigen Hauptsultans Mandara, sowie über das Fortschreiten des deutschen Einflusses lauteten günstig. Leider wird der Kilimandscharo alljährlich das Ziel vieler Sportexpeditionen, die für das Land einen Nutzen nicht haben, sondern besonders durch die planlose Ausrottung des Wildes nur Schaden anrichten.
Um Mkwadja und Sadani, wo fleißig am Wiederaufbau des Platzes gearbeitet wurde, waren nach dem Friedensschlusse mit Bana Heri die Verhältnisse ebenfalls geordnete. Bana Heri erhielt vom Reichskommissar ein Geschenk von 2000 Rupies als Beitrag zur Wiedererrichtung der Moschee.
Der Distrikts-Chef von Bagamoyo und Stellvertreter des Reichskommissars, Herr von Gravenreuth, mußte wegen der in letzter Zeit bei ihm wiederholt auftretenden, schweren Fieberanfälle, die er sich auf seinen Expeditionen und durch den aufreibenden Dienst zugezogen, Mitte April mit längerem Urlaub Ostafrika verlassen, das er leider nie wieder betreten sollte. Frhr. v. Eberstein, der mit großem Eifer und Erfolg die Verwaltungsabteilung geleitet hatte, trat ebenfalls einen wohlverdienten siebenmonatlichen Urlaub an.
[S. 200]
Im Februar des Jahres 1890 war der Major im großen Generalstabe, Liebert, welcher bisher in Berlin die Vertretung des Kommissariats innegehabt hatte, auf Befehl Sr. Majestät in Ostafrika eingetroffen, um sich an Ort und Stelle durch den Augenschein von der Lage der Dinge Kenntniß zu verschaffen und darüber Bericht zu erstatten. In seiner Begleitung befand sich ein Beamter des Auswärtigen Amtes, Tesch. Dieser sollte dem Reichskommissar und den Chefs über die Art und Weise der Rechnungsführung, wie man sie auf dem Auswärtigen Amt wünschte, Instruktionen erteilen. Die Thätigkeit des Herrn Tesch war, wie wir gleich bemerken wollen, obwohl er sich mit großem Eifer dieser Arbeit unterzog, von keinem Erfolge begleitet. Man stellte sich eben die Verhältnisse von Deutschland aus ganz anders vor, als sie in Wirklichkeit waren. Es wurde daher bald die Sendung einer Revisions-Kommission angeordnet.
Besonders bemerkenswert ist während dieser Zeit die Entsendung eines Detachements der Schutztruppe in der Stärke von 60 Mann unter dem Kommando des Chefs Theremin und in Begleitung des General-Konsuls Dr. Michahelles nach Witu. Nachdem im Monat März von Sr. Majestät Schiff »Carola« die deutsche Flagge an der Wubuschi-Mündung gehißt worden war, hatte der General-Konsul Befehl erhalten, sich an Bord eines Kriegsschiffes nach Lamu zu begeben, um von hier aus mit jener erwähnten Begleitmannschaft dem Sultan von Witu Geschenke zu überbringen und formell die deutsche Schutzherrschaft zu erklären. Es erregte dieses Vorgehen damals ganz besondere Freude, denn man schloß daraus, daß nun auch dort energisch etwas für die weitere Entwickelung jener Kolonie, welche bis dahin recht stiefmütterlich behandelt worden war, gethan werden würde. Leider sollte diese Hoffnung durch das deutsch-englische Abkommen auf das bitterste getäuscht werden. Der Führer des Detachements, Chef Theremin hatte die Expedition nach Witu bereits in leidendem Zustande angetreten. Nach seiner Rückkehr mußte der anerkannt tüchtige Offizier in Sansibar in das dortige Hospital aufgenommen werden und erlag bald einer zu einem unbedeutenden Magenleiden hinzutretenden Bauchfellentzündung.
[S. 201]
Wir erwähnten früher bereits, daß für die Verwaltung des nördlichen Küstendistrikts eine Einteilung in drei Distrikte, nämlich Bagamoyo, Sadani und Pangani vorgenommen worden war. Diese Einteilung hatte ihre großen Schattenseiten. Bei der mangelhaften Verbindung der den Distriktschefs unterstellten Küstenplätze entstanden nur Schwierigkeiten für den dienstlichen Verkehr, welche die Verwaltung schwerfällig machten. Man sah infolgedessen, besonders da im Süden wegen der meist noch viel größeren Entfernung der Stationen von einander sich eine gleiche Maßregel noch weniger empfahl, von der Distrikts-Einteilung ab und griff wieder zu der ursprünglich stattgehabten Einteilung in Stationen, denen folgende Herren vorstanden:
Tanga: Chef Richelmann, der indes bald wieder durch Krenzler ersetzt wurde, da Richelmann die Station Sansibar und das Bureau des Reichskommissariats zu übernehmen hatte.
Pangani: nach der Versetzung Krenzlers nach Tanga Chef Johannes.
Mkwadja: Lieutenant Fischer.
Sadani: nach Abkommandierung Sigls zur Stokeschen Expedition Lieutenant von Arnim.
Bagamoyo: Chef Ramsay, (welcher diese Station nach der Versetzung des zu Bagamoyo trefflich bewährten Chef Richelmann nach Tanga erhielt).
Daressalam: Chef Leue.
Endlich fällt in diese Zeit als wichtigstes Moment für die Weiterentwickelung des Kommissariats und die Hebung der Aktionsfähigkeit die Vermehrung der Schutztruppe. Als der Plan zur Bestrafung der Rebellen der Südküste und zur Wiedereinnahme der nicht in unsern Händen befindlichen Küste gefaßt wurde, mußte man sich klar darüber sein, daß eine Verstärkung der Schutztruppe notwendig sei.
Nach abermaligen Verhandlungen des auswärtigen Amtes zu Berlin mit der englischen und egyptischen Regierung wurde denn auch die Anwerbung von 600 Sudanesen in Egypten genehmigt und ein in der Verwaltung des Reichskommissariats thätiger Beamter, Donarski, der gerade zur Wiederherstellung seiner Gesundheit einen Urlaub nach Egypten[S. 202] erhalten hatte, mit der Anwerbung beauftragt. Die Wahl Donarskis war ein entschiedener Fehler. Mit vielem Fleiß und bewundernswürdigem Eifer hatte er sich in seine ihm anfangs völlig fremde Thätigkeit eingearbeitet, aber er hatte doch niemals Gelegenheit gehabt, sich eine Kenntniß der Sudanesen und unseres Soldatenmaterials überhaupt zu erwerben. Daß Donarski für die Aushebung ausersehen wurde, hatte seinen Grund lediglich in der übel angebrachten Rücksicht darauf, Ersparnisse zu machen; er reiste eben, wie erwähnt, so wie so nach Egypten. In Kairo stand Donarski bei der Anwerbung besonders zur Seite der Vertreter von Hansing & Co. in Sansibar, Strandes, der sich in jener Zeit ebenfalls in Egypten aufhielt, und der Kaufmann Brettschneider, welche beide bei der Erledigung der komplizierten kaufmännischen Geschäfte Donarski hülfreich zur Hand gingen.
Bei der Anwerbung selbst war wiederum, wie das erste Mal, der englische Oberst Scheffer von großem Nutzen. Doch machte sich jetzt schon empfindlicher als das erste Mal die Abneigung der englischen und egyptischen Regierung geltend, die Sudanesentruppe weiterhin den Deutschen für ostafrikanische Dienste zur Verfügung zu stellen, und nur mit Mühe gelang es Donarski, in noch verhältnismäßig kurzer Zeit die gewünschten 600 Mann zu beschaffen. Immer nach Anwerbung einer genügend großen Zahl wurden dieselben wie früher nach Sues geschickt.
Zum ersten Einexerzieren waren zwei neu für Ostafrika bestimmte Offiziere, die Herren Lieutenant Scherner und von dem Knesebeck mit einigen Unteroffizieren von Deutschland nach Egypten beordert worden. Ihnen wurden die angeworbenen Leute von Donarski übergeben, und dann in gleicher Weise, wie das bei der ersten Anwerbung geschah, die Exerzitien mit den Leuten vorgenommen. Die Untersuchung und Behandlung der Leute geschah durch Assistenzarzt Dr. Buschow, der ebenfalls neu für die Schutztruppe angeworben war; indes einen Einfluß auf die Auswahl des Soldatenmaterials hatte er ebenso wenig wie die beiden Offiziere: Donarski wollte, ohne öfters laut gewordenen Vorstellungen Gehör zu geben, alles allein besorgen.
[S. 203]
Das ganze Kontingent wurde auf dem egyptischen Dampfer Schibin in Sues eingeschifft und ging unter Donarskis Kommando nach Sansibar ab, woselbst der Transport Mitte April eintraf. Die Überfahrt war von Donarski und den Offizieren benutzt worden, die Leute einzukleiden; Uniformen, Schuhzeug, Ausrüstungsstücke, auch Bewaffnung waren bereits beschafft, und so machte bei ihrer Ankunft auf dem Dampfer die Truppe einen vorteilhaften Eindruck.
Der Reichskommissar, der mit den andern in Sansibar anwesenden Herren, — auch Major Liebert begleitete ihn bei der Ankunft des Schibin, — sogleich an Bord ging, ließ sich indes durch den vorteilhaften äußeren Eindruck nicht täuschen, sondern sagte von vornherein: »Mir gefallen die Leute nicht, es sind viel zu viel gelbe Kerls darunter.«
In der That hatten sich die guten Erfahrungen, die wir mit der egyptischen Anwerbung das erste Mal gemacht hatten, lediglich auf das schwarze Element, nicht aber auf die Gelbgesichter, die eigentlichen Egypter, Armenier und Syrer bezogen. Solcher Leute hatte die neue Anwerbung einen nur allzugroßen Prozentsatz aufzuweisen. Dazu merkten wir bald, daß die jetzige Anwerbung lange nicht soviel altgediente Soldaten zählte, wie das erste Kontingent. Ein großer Teil bestand aus Soldaten, welche wenig kriegerischen Stämmen angehörten und bisher Kriegsdienste gar nicht gethan hatten, ein anderer aus Baschibosuks, und nur ein kleiner Teil aus regulären egyptischen Sudan-Soldaten. Indes man mußte mit dem gegebenen Material rechnen, und es wurde alsbald zur Einteilung und Ausbildung desselben geschritten.
Mit Rücksicht auf die demnächst vorzunehmende andere Truppenbesetzung der Stationen des Nordens, die Wiedereinnahme des Südens und die Besetzung der zu begründenden südlichen Küstenstationen, sowie für Expeditionszwecke mußte eine neue Einteilung der Schutztruppe eingerichtet werden. Die Neuangekommenen wurden mit den bewährten felddienstfähigen Truppen des früheren Kontingents in zwei Expeditionskorps formiert. Das eine wurde zunächst unter dem Kommando des Chefs von Zelewski zum Zweck der Ausbildung in Bagamoyo,[S. 204] das andere zu gleichem Zweck in Daressalam unter Chef End vorläufig stationiert.
Der Reichskommissar hatte, da die Ankunft der Truppen schon im März erwartet war, gehofft, bereits im April vor Eintritt der großen Regenzeit gegen den Süden vorgehen zu können, allein die Führer der Expeditionskorps meldeten übereinstimmend, daß bei der Minderwertigkeit des diesmal angeworbenen Materials sie den Rest des Monats April für ein Einexerzieren der Leute notwendig hätten, und so wurde die Aktion gegen den Süden bis zum Monat Mai verschoben.
Bei der genannten Anwerbung ist übrigens noch ein Umstand zu erwähnen, durch den wir in große Verlegenheit gesetzt wurden. Ein Teil der egyptischen Offiziere und Unterhändler nämlich, deren sich Donarski naturgemäß für die Anwerbung der Truppen bedienen mußte, hatte sich nicht damit begnügt, die ihnen von uns gemachten Geschenke und Werbegelder einzustecken, sondern sie hatten in echt orientalischer Weise das Geschäftchen dadurch vergrößert, daß sie nach ihrem Belieben die Chargen an die Anzuwerbenden verkauften.
Ein Teil der angeworbenen Soldaten, die bis dahin Militärdienst noch garnicht gethan hatten, kauften sich Atteste als Unteroffiziere, Sergeanten oder dergl. und wurden nach Zahlung des erheblichen Backschisch an die Unterhändler als solche eingestellt. Wir mußten sie natürlich zunächst kontraktmäßig übernehmen und nach der Charge besolden. Dieser Betrug wurde erst später entdeckt, und dann natürlich thatkräftig eingeschritten. So fällt schon in die Zeit vor wie auch nach Einnahme des Südens eine große Masse von Entlassungen aus dem neuen Kontingent. Auch der hohe Prozentsatz an Todesfällen auf den Südstationen ist zum Teil der körperlichen Unbrauchbarkeit des Materials zuzuschreiben.
Während der Ausbildungszeit der neu formierten Expeditionskorps wurde von Seiten des Reichskommissariats alles versucht, in den südlichen Plätzen, wo es irgend möglich war, die Verhältnisse friedlich zu regeln, da ja jede kriegerische Aktion immerhin einen Rückgang des Handels und Wandels für beträchtliche Zeit nach sich zieht. Die Anregung zu diesen[S. 205] Verhandlungen ging von den Bewohnern der südlichen Plätze selbst aus.
Mikindani, Sudi, Lindi, Kissiweri hatten, auf das Gerücht hin, daß der Süden mit allen Kräften des Kommissariats angegriffen werden soll, Deputationen an Wißmann geschickt, um ihre freiwillige Unterwerfung anzukündigen und seine Bedingungen entgegenzunehmen. Zur Vornahme der Verhandlungen wurde von uns der für solche Fälle schon oft in Anspruch genommene Wali von Pangani, Soliman ben Nassr, der sich als besonders tauglich und zuverlässig hierfür erwiesen hatte, bestimmt und auf dem Sultans-Dampfer Barawa nach den südlichen Plätzen gesandt.
Der Sansibarsultan selbst, welcher damals den europäischen Interessen erheblich mehr zugethan war, als es im Anfang der Amtsthätigkeit Wißmanns der Fall war, wünschte aus Geschäftsrücksichten, möglichst schnell friedliche Verhältnisse herbeizuführen. Die Verhandlungen Solimans führten zu einem günstigen Abschluß mit den südlichsten Plätzen Mikindani und Sudi. In Lindi und von da nach Norden hin behielt indes die Kriegspartei die Oberhand. Anfang April unternahm Major Wißmann auf der »München« gemeinsam mit Major Liebert eine Rekognoszierungsfahrt nach dem Süden, gleichzeitig dampfte Korvetten-Kapitän Valette, der älteste Offizier der Station und Kommandant Sr. Maj. Schiff »Carola«, mit seiner Korvette dorthin. Noch vor Antritt der Rekognoszierungsfahrt wurde vom Reichskommissar in Sansibar der Kriegszustand und das Standrecht im Namen Sr. Majestät des Kaisers und des Sultans von Sansibar vom Rufidji bis zum Rovuma einschließlich proklamiert.
Für die Rekognoszierungstour entwarfen Major Wißmann und Kapitän Valette einen gemeinsamen Operationsplan. Zunächst bezog sich dieser auf den am besten verteidigten und befestigten auch bei weitem am meisten straffälligen Platz Kilwa Kiwindje, wo anderthalb Jahre zuvor die Beamten der ost-afrikanischen Gesellschaft Krüger und Hessel der Wut der Rebellen zum Opfer gefallen waren. Als die Schiffe auf der Rhede vor Kilwa ankerten, fand man die ausgedehnte Stadt an der Seeseite ganz und gar mit Pallisaden befestigt und mit Truppen[S. 206] stark besetzt. Eine Dampf-Pinasse der »Carola« wurde zur Rekognoszierung etwas näher an das Land geschickt, aber sofort vom Lande aus sowohl durch Gewehre, als mit den dort befindlichen Geschützen beschossen. Da die Geschütze verwahrloste Vorderlader waren, mit Eisenstücken, Nägeln und allem möglichen geladen, so war die Beschießung natürlich ganz wirkungslos. Die Dampfpinasse erwiderte das Feuer mit ihrem Revolvergeschütz.
Nachdem die Pinasse wieder an Bord der »Carola« zurückgekehrt war, wurden einige Granaten von der »Carola« in die Stadt hineingeworfen. Die im Bericht des Kapitän Valette ausgesprochene Annahme jedoch, daß das Feuer den Arabern in Kilwa bedeutende Verluste beigebracht haben müsse, bestätigte sich bei unseren an Ort und Stelle vorgenommenen zuverlässigen Erkundigungen nicht.
Der Reichskommissar seinerseits fing mit der »München« fünf Halbaraber und Neger auf und zog von diesen Nachrichten ein. Sie bestätigten nur, daß die Rebellen in Kilwa entschlossen seien, auf das energischste Widerstand zu leisten.
Nachdem der Zweck der Rekognoszierung erreicht war, kehrte sowohl Wißmann auf der »München«, als auch Kapitän Valette auf der »Carola« nach Sansibar zurück. Der gemeinsam verabredete Aktionsplan gegen Kilwa bestimmte Folgendes: Die »Carola« sollte die Blockierung und Beschießung des Platzes von der Seeseite aus vornehmen; »Schwalbe« hingegen mit den Wißmann für den Transport zur Verfügung stehenden Schiffen, dem gecharterten Sultansdampfer »Barawa«, der »Harmonie« und einem von den kleinen Dampfern außerhalb Mafia nach Kiswere gehen. Dort sollten die Schiffe den Eintritt der Dunkelheit abwarten und dann nordwärts den Hafen von Kilwa Kisiwani anlaufen, um hier die Truppen Wißmanns zu landen. Von dort aus sollte der Anmarsch gegen Kilwa Kiwindje beginnen, während »Schwalbe«, die ebenfalls Wißmannsche Truppen an Bord zu nehmen gewillt war, zur »Carola« auf die Rhede von Kilwa Kiwindje zurückdampfen sollte.
Die zur Teilnahme an den Operationen gegen den Süden bestimmten Truppen wurden für diesen Zweck in 3 Bataillone zu 3 Kompagnien unter dem Kommando der Herren Chef Dr.[S. 207] Karl Wilhelm Schmidt, Chef von Zelewski und dem Verfasser eingeteilt. Jedem der Bataillone wurde ein 4,7 cm Geschütz, dem zweiten (Rochus Schmidt) außerdem noch ein Maximgeschütz beigegeben. Für die Beförderung der Truppen nach dem Süden dienten für jedes Bataillon ein großer Dampfer und zwar für das erste Bataillon unter Dr. Karl Wilhelm Schmidt Sr. Majestät Schiff »Schwalbe«, da, wie erwähnt, Korvettenkapitän Hirschberg mit Genehmigung des ältesten Offiziers der Marine-Station die Güte hatte, einen Teil der Truppen auf sein Schiff zu nehmen, für das zweite unter dem Verfasser der vom Sultan gecharterte Dampfer »Barawa«, für das dritte unter Zelewski unser Dampfer »Harmonie.«
Am Abend des 29. April waren in Daressalam sämtliche für den Feind bestimmten Truppen und Fahrzeuge versammelt. Der Verabredung gemäß war Sr. Maj. Schiff »Carola« nach Kilwa vorausgegangen und dort nach einer sehr stürmischen Reise am 1. Mai eingetroffen. In der Nacht vom 1. zum 2. Mai wurde von der »Carola« mit der Beschießung der Stadt begonnen und dieselbe am nächsten Morgen fortgesetzt, die Befestigungen vor der Stadt, wie auch die verschiedenen Teile der Stadt wurden mit Granaten beworfen. Die Rebellen erwiderten zu Anfang das Feuer aus ihren bereits erwähnten Geschützen, selbstverständlich ohne mit der Ladung nur ein nennenswertes Stück weit zu reichen. Durch die Geschosse der »Carola« wurde ihnen bald die Lust zum weiteren Bedienen ihrer Geschütze genommen. Der Zweck der Beschießung, die Rebellen in permanenter Aufregung zu erhalten, war vollkommen erreicht.
Am 30. April morgens fand unterdessen in Daressalam die Einschiffung der Truppen in der vorher bestimmten Art statt, während die kleineren Dampfer des Reichskommissars Gepäck, Proviant und Munition für den Süden an Bord nahmen, teils auch noch mit Gepäck beladene Dhaus zu schleppen hatten. Die Dampfer »Harmonie«, »Barawa«, »München«, »Max« und »Vulkan« verließen, sobald sie mit der Aufnahme der Truppe, bezw. der Ladung fertig waren, am genannten Tage (dem 30. April) früh den Hafen. S. M. Schiff »Schwalbe«, auf der sich auch der Reichskommissar eingeschifft[S. 208] hatte, folgte um 1/2-9 Uhr morgens und holte bald die vorausgegangenen Dampfer ein. Der Südwest-Monsum hatte bereits wider Erwarten mit aller Kraft eingesetzt, sodaß der Fahrt nach dem Süden größere Hindernisse sich entgegenstellten, als man geahnt hatte.
Gleich im Anfang hegte man Besorgnis wegen der »Harmonie«, welche sehr viel Wasser übernahm und von Wind und Wellen heftig hin und her geworfen wurde. Am Nachmittag des 30. April nahm Wind und Seegang noch zu, und da an der Nordspitze Mafias erfahrungsgemäß noch größere See zu erwarten stand, so mußte die Absicht, an der Außenküste Mafias des Nachts weiter zu fahren, aufgegeben werden. Korvetten-Kapitän Hirschberg, der bis Mafia die Führung übernahm und die Dampfer alle auf den richtigen Kurs gebracht hatte, nahm nun den Kurs durch den Mafia-Kanal und erreichte bei Dunkelwerden den Ankerplatz bei Faniove, wohin er auch die andern Schiffe durch Blicke des Nachtsignal-Apparates dirigierte. Am nächsten Morgen konnte die Weiterfahrt wegen dicken Nebels und Regen-Böen erst um 7 Uhr fortgesetzt werden, und zwar in Rücksicht auf die »Harmonie« unter schwachem Dampf.
Kapitän Hirschberg verabredete mit Major Wißmann, die Südpassage durch den Mafia-Kanal, welcher vor einbrechender Dunkelheit erreicht werden konnte, zu verlassen, wenn dies des Wetters wegen irgend möglich sei, und während der Nacht nach Kilwa-Kisiwani zu gehen. Aber auch diese Absicht war undurchführbar, denn die Seeuntüchtigkeit unserer »Harmonie« stellte sich immer deutlicher heraus. Schon wir, die wir auf der »Barawa«, einem Schiff von 1000 Tonnen, eingeschifft waren, wurden bei dem fortwährenden Rollen und Stampfen stark hin und her geworfen; wirklich bemitleiden mußten wir indes die auf der »Harmonie« eingeschifften Kameraden und Truppen. Die »Harmonie« fuhr hinter uns her und wir konnten ihr furchtbares Schlingern aus nächster Nähe beobachten. Die Besorgnis, daß die »Harmonie« bei dieser See kentern könnte, lag sehr nahe, und in der That wurde bald darauf auf der »Harmonie«, als wir den Wasserweg innerhalb des Mafia-Kanals verlassen wollten, ein Signal sichtbar, daß der[S. 209] Dampfer unmöglich folgen könne. Nachdem der Kapitän der »Harmonie« und Chef von Zelewski, der Kommandant der auf der »Harmonie« eingeschifften Truppen mit dem Reichskommissar in Verbindung getreten waren, wurde zunächst bei Samanga geankert und hier beschlossen, daß die andern Schiffe bis auf »Schwalbe« und »Harmonie« direkt und zwar möglichst ohne daß man sie von Kilwa Kiwindje bemerken könne, nach Kisiwani weiter gehen sollten.
Die »Schwalbe« lief mit Tagesanbruch des 2. Mai nach Kilwa, um Herrn Kapitän Valette von der notwendig gewordenen Änderung der ursprünglich getroffenen Dispositionen Meldung zu erstatten und »Harmonie« folgte ihr langsam nach. Dann schlug die »Schwalbe« den Weg nach Kilwa Kisiwani ein, wo sie wieder die Führung übernahm und, den übrigen Dampfern den Weg weisend, Nachmittags in den Hafen einlief. Die Führung durch Sr. Maj. Kreuzer »Schwalbe« ist während der ganzen Fahrt nach dem Süden für uns von der größten Wichtigkeit gewesen. Den Führern unsrer Dampfer, die bis dahin kaum jemals nach dem Süden gekommen waren, war das Fahrwasser unbekannt, und es ist sowohl der geschickten Führung durch Kapitän Hirschberg, als auch besonders der großen Hilfsbereitschaft, mit der er jeden weiter zurückbleibenden oder vom richtigen Fahrwasser abkommenden Dampfer wieder auf den richtigen Weg brachte, zu danken, daß wir, ohne durch die Elemente größere Verluste zu erleiden, im Süden angekommen sind.
Dem auf der »Schwalbe« eingeschifften Bataillon und insbesondere den Offizieren ist die bestmögliche, kameradschaftlichste Aufnahme zu Teil geworden, wie überhaupt in jener Zeit das vorher zuweilen gespannte Verhältnis mit der Marine sich in ein sehr gutes umgewandelt hatte. Zumal mit der alten Besatzung der »Carola« und »Schwalbe«, mit denen wir so vieles gemeinsam durchlebt hatten, wurde eine enge Freundschaft und die beste Kameradschaft gepflogen.
Die »Harmonie« hatte die Anweisung erhalten, da sie nach Kilwa Kisiwani nicht folgen konnte, nach der Rukyrro-Bai, südlich von Kilwa Kiwindje zu gehen und daselbst das an Bord befindliche Bataillon auszuschiffen.
[S. 210]
Bei unserer Ankunft in Kilwa Kisiwani machten das Kriegsschiff und die armierten Dampfer klar zum Gefecht, aber es zeigte sich nirgends ein Feind.
Die Landung der Truppen an der Südspitze der von Kilwa Kiwindje nach Süden auslaufenden Halbinsel ging ohne Schwierigkeit von statten und war bis zum Eintritt der Dunkelheit beendet. Die Truppen der »Harmonie« wurden ebenfalls in der Nacht vom 2. zum 3. und am 3. früh in der Rukyrro-Bai gelandet, wobei die »Schwalbe« ebenso wie bei unserer Landung in Kilwa Kisiwani durch Hergabe von Booten und durch Schleppen mit der Dampfpinasse bereitwillig Unterstützung leistete.
Eine Stunde nach begonnener Landung war in der Kisiwani-Bai die ganze Mannschaft von »Schwalbe« und »Barawa« ausgeschifft und um 5 Uhr 15 Minuten befand sich bereits alles im Marsch.
Das Landen der Truppen, Rangieren und der Abmarsch machten einen sehr guten militärischen Eindruck, in Anbetracht der überstandenen Seefahrt und der Seekrankheit, an der fast alles zu leiden hatte. Es wurde zunächst eine Stunde weit marschiert bis Masoko in der Rukyrro-Bai, in deren Nähe die »Harmonie« vor Anker lag.
Abgesehen von einem Angriff auf eine von uns ausgesandte Patrouille, bei welchem ein Mann auf unsrer Seite verwundet, einer der Gegner erschossen wurde, fanden Feindseligkeiten während der Nacht nicht statt. Wir hatten dagegen unterwegs einige Eingeborene aufgegriffen, welche uns am nächsten Tage als Führer nach Kilwa Kisiwani dienen sollten.
Das zweite Bataillon war während der Landung der »Harmonie« nordwärts vorgeschoben und hatte die Vorposten zu stellen. Noch während der Landung wurden dieselben von einem etwa 200 Mann starken Trupp, der offenbar auf die Nachricht von unserer Landung hin von Kilwa Kiwindje ausgesandt war, angegriffen. Der Gegner wurde indes nach kurzem Gefecht unter bedeutenden Verlusten zurückgeworfen.
Unmittelbar nach erfolgter Landung des auf der »Harmonie« eingeschifften Bataillons wurde der Vormarsch auf Kilwa (in der Marschordnung: zweites, erstes, drittes Bataillon),[S. 211] angetreten. Der Marsch führte zunächst an der Küste entlang nach Norden, dann bogen wir nach Nordwesten ab in der Richtung auf den Kisimo-Berg.
Unterwegs wurde unsere Tête fortwährend von Rebellen angegriffen, jedoch wurde der Marsch hierdurch nicht verlangsamt, da es zumeist nur des Einsetzens der Têten-Kompagnie bedurfte, den Gegner zurückzuwerfen. Dagegen hatten wir in Folge der großen Hitze, der schlechten Ernährung und der überstandenen Seekrankheit einige Fälle von Sonnenstich, was uns einigermaßen aufhielt. Während der Nacht vom 3. zum 4. Mai wurde Bivouak in einer verlassenen Ortschaft bezogen. Die Nacht verlief ohne jede Störung, obgleich das stark coupierte Terrain und die Tags zuvor sich immerfort wiederholenden Angriffe des Feindes auch Unternehmungen desselben bei Nacht erwarten ließen. Selbstverständlich waren nach dem Beziehen des Bivouaks alle Vorsichtsmaßregeln getroffen und starke Vorposten ausgestellt worden.
Am 4. Mai morgens wurde der Weitermarsch fortgesetzt, abermals unter schnell zurückgewiesenen Angriffen der Gegner. Gegen 7 Uhr wurde das Feuer der Kriegsschiffe hörbar. Die vorzüglich einschlagenden Granaten legten einen beträchtlichen Teil der Befestigung an der Front nieder, ebenso eine Menge massiver Bauten in der Stadt. Ein Teil derselben, der aus Negerhütten bestand, geriet in Brand, ein Teil der Pulvervorräte des Feindes flog in die Luft.
Als sich unsere Truppen um 8 Uhr der Stadt von Südwesten her näherten, dirigierte der Reichskommissar das zweite Bataillon auf den Süden der Stadt, das erste auf die Westlinie, während das dritte als Reserve folgte. Dicht vor der Stadt wurden noch einige Granaten in dieselbe geworfen und eine Patrouille mit der deutschen Flagge rechts nach dem Strande gesandt. Sie sollte der Marine das Zeichen zum Einstellen des Feuers geben, damit wir selbst zum Angriff vorgehen könnten.
Zu unserer großen Überraschung konnten wir, ohne Feuer zu erhalten, in die Stadt eindringen: sie war während der letzten Nacht geräumt worden. Wir hatten erwartet, daß die fanatischen Rebellen von Kilwa Stand halten würden, und daß es zu einem sehr erbitterten Straßenkampfe kommen[S. 212] würde, wobei die vielen festen Steinhäuser vorzügliche Reduits für die Rebellen hätten bilden können. Wäre es uns dann gelungen, den Gegner aus der Stadt zu treiben, so hätte ihm nach Erstürmung des südlichen Stadtteils das erste Bataillon vom Westen her den Rückzug abgeschnitten, und der Feind wäre in den Terrain-Abschnitt zwischen den Meeresstrand und den Fluß gedrängt worden, wo er ertrunken oder in unsere Hände gefallen wäre. Die Rebellen waren indes eingeschüchtert. Sie hatten erwartet, daß wir lediglich von der Seeseite angreifen würden, wo sie sich durch eine sehr stark angelegte doppelte Pallisadenreihe, in deren Mitte Erde geschichtet war, befestigt hatten. An verschiedenen Stellen der Pallisaden waren Bastionen errichtet, deren Armierung im ganzen aus acht primitiven Geschützen bestand. Im Norden und Süden stießen die Befestigungen an Creeks; an den Seiten dagegen waren Befestigungen überhaupt nicht angebracht.
Da wir den Rebellen den Gefallen nicht gethan hatten, die stärkste Seite der Stadt anzugreifen, und ihre Versuche, uns durch Entgegenwerfen stärkerer Trupps im Vormarsch aufzuhalten, ebensowenig Erfolg gehabt hatten, warfen sie die Flinte ins Korn und gaben die Stadt preis. Nach den eingezogenen Erkundigungen waren die Verluste an Menschenleben, welche die Rebellen durch die Beschießung der Marine erlitten hatten, ganz geringfügig, sie betrugen nur 2 Mann; um so größer aber war der moralische Eindruck gewesen, den das Bombardement und der Brand in der Stadt hervorriefen. Um nicht die ganze Stadt abbrennen zu lassen, mußten wir selbst zum Löschen schreiten.
Der Verlust der Schutztruppe vor Kilwa betrug drei Tote und einige Verwundete. Die Marine war, da ihre Schiffe aus einer Entfernung von über 3000 m feuerten, selbstverständlich nicht durch die Rebellen gefährdet. Die Verluste, welche die Rebellen in den vereinzelten Gefechten beim Anmarsch der Schutztruppe von Süden her erlitten, beliefen sich auf etwa 30 Mann. Recht wunderbar schien es uns, daß obwohl unsere Marine stets recht gut schoß, die Verluste der Rebellen an Menschenleben so ungeheuer gering waren und der Schätzung der Marine stets bedeutend nachstanden.[S. 213] Man sah, daß die Granaten meist vorzüglich krepierten, dennoch aber keine Verluste beibrachten. Gewiß ist in dieser Beziehung der Vorschlag des Admirals Deinhard, statt mit Granaten mit Shrapnels gegen lebendige Ziele zu feuern und die in Ostafrika stationierten Kriegsschiffe mit solchen zu versehen, sehr beachtenswert.
Kilwa Kiwindje ist die größte und bedeutendste Stadt des Südens, fast so groß wie Bagamoyo, wenn auch als Handelsplatz bei weitem nicht von derselben Bedeutung. Die Zahl der Steinhäuser und besonders der geräumigen Steinhäuser übersteigt erheblich die in allen andern Plätzen. Leider hat Kilwa eine sehr schlechte Rhede und der sehr schlickige Strand erschwert sogar das Landen mit den Booten. Die Bedeutung Kilwas ist ersichtlich aus der großen Zahl der hier wohnenden Inder. Annähernd 100 Geschäfte von Hindus und Banianen befinden sich in der Stadt.
Auf der Rhede von Kilwa lag zur Zeit unseres Angriffes das englische Kriegsschiff »Turquoise«, um diejenigen von den indischen Unterthanen aufzunehmen, welchen der Aufenthalt in der Stadt zu unsicher erschien und welche die Absicht hatten, nach Sansibar überzufahren. Es schifften sich denn auch 12 Männer und 105 Frauen und Kinder auf der »Turquoise« ein; ein Inder war noch unmittelbar vor dem Abzug der Rebellen in seinem Hause ermordet und sein Laden vollständig ausgeplündert worden. Bei unserm Einzuge fanden wir die Inder fast alle aus der Stadt geflüchtet und erst auf gutes Zureden, nachdem wir Friedensboten zu ihnen gesandt, waren sie zur Rückkehr zu bewegen.
Die Stärke des Feindes variierte nach den Angaben der Inder zwischen 5 und 7 Tausend Mann, doch scheint diese Zahl von den für größere Zahlenangaben wenig Verständnis besitzenden Leuten sehr übertrieben zu sein.
Nach unserem Einrücken in die Stadt wurden die im Besitze der Rebellen befindlichen Häuser geplündert und nachdem das Vieh, welches in der Stadt und deren Nähe sich vorfand, zusammengetrieben war, bezogen die Truppen Quartiere. Jedem Bataillon wurde ein Teil der Stadt überwiesen und diese Bereiche in Kompagnie-Reviere eingeteilt. So kamen hier nach[S. 214] der Seefahrt und dem Marsch im Regen, — seit unserer Abfahrt von Daressalam hatte es fast ununterbrochen in Strömen gegossen, — die Truppen zum ersten Mal in trockene Quartiere. Da sich durch die Stadt Kilwa selbst ein Creek hindurchzieht, und außerdem in der Regenzeit das ganze Terrain in und um Kilwa zum Sumpfe wird, in welchem gerade jetzt viel Erdarbeiten auszuführen waren, so kann es nicht Wunder nehmen, wenn in der nächsten Zeit der Gesundheitszustand der Truppen ein sehr schlechter war.
Am Tage nach dem Einrücken wurde eine Patrouille von 3 Kompagnien nach dem Singino-Hügel geschickt, welche die Meldung zurückbrachte, daß der erste Halt der flüchtigen Aufständischen 7 Stunden von Kilwa entfernt läge, aber kaum Aussicht sei, daß dieselben einer anrückenden Truppe weiterhin Stand halten würden.
Man ging nun eifrig an das Ausladen der Dampfer, welche die für Kilwa bestimmten Baumaterialien, Munition und Proviant gebracht hatten, und bereitete die Befestigungsarbeiten vor, so daß der Platz von zwei Kompagnien gehalten werden konnte. Als Platz für die Station wurde das alte am Strande gelegene Zollhaus und drei andere Steinhäuser ausgesucht, die zunächst durch eine provisorische Umwallung aus Wellblech (mit Erdaufwurf zwischen den Wellblechen) und durch einen Stacheldrahtzaun derart umgeben wurden, daß sie mit den Geschützen und der zugehörigen Besatzung ein wohl zu verteidigendes Fort bildeten. Die Station wurde am 8. Mai nachmittags mit 15 Europäern, 2 Kompagnien und 2 Geschützen dem Chef von Zelewski übergeben.
Am 9. Mai erfolgte die Einschiffung der übrigen Truppen und zwar an Bord der »Carola«, »Schwalbe« und »Barawa«, da »Harmonie« wegen ihrer bewiesenen Untüchtigkeit in Kilwa zurückgelassen wurde. Am Mittag des 9. Mai gingen »Carola«, »Schwalbe«, »Barawa«, »München« und »Vesuv« nach Lindi, unserem nächsten Ziele, ab, wo wir am Morgen des 10. Mai eintrafen.
Die Stadt Lindi, meist aus Negerhütten bestehend, weist nur ganz wenige Steinhäuser auf. Sie liegt auf der nördlichen Seite eines von See aus ins Land sich hineinziehenden sehr[S. 215] breiten Creeks. Die Ausdehnung der Stadt ist keine große, da unmittelbar hinter derselben eine ziemlich bedeutende Hügelkette eine natürliche Grenze bildete. Am Ende des Creeks mündet in diesen der Ukeredi-Fluß. Nach unserer Ankunft vor dem gewissermaßen den Hafen bildenden Creek gingen die Dampfer »Schwalbe«, »Barawa«, »München« und »Vesuv« in denselben, den sogenannten Lindi-Fluß hinein, während »Carola« von der Rhede aus die Operation auf Ansuchen des Majors Wißmann durch Hineinwerfen dreier schwerer Granaten in die Stadt eröffnete. Wir erhielten im Flusse sowohl von der Lindiseite aus, als auch von der entgegengesetzten Seite des Flusses Feuer, welches die »Schwalbe« mit Revolvergeschützen erwiderte, während ich von der Kommandobrücke der »Barawa« aus mit dem Maxim-Gun die am Strande von Lindi befindlichen Rebellen beschoß. Obgleich die Lindileute fast gar keine Verluste erlitten, wurde doch der Strand von ihnen geräumt, und unsere Landung erfolgte ohne Verluste.
Der Vormarsch gegen die Stadt machte keine Schwierigkeiten. Überall wurde das Terrain im Umkreis von den Rebellen gesäubert. Wo sie sich zeigten, wurden sie, ohne daß sie bedeutenden Widerstand leisteten, zurückgeworfen. Nach der Besetzung der Stadt wurden alsbald Vorposten aufgestellt und mit den Löscharbeiten begonnen. Eine von uns unternommene stärkere Rekognoszierungs-Patrouille, bei der wir an einzelnen Stellen beschossen wurden, hatte zwar die Rebellen über die benachbarte Hügelkette hinaus gejagt, doch wurden während der Nacht unsere Vorposten noch an verschiedenen Stellen, allerdings ohne Erfolg, angegriffen. Ein weißer Unteroffizier wurde bei der Schießerei während der Nacht verwundet. Zur provisorischen Befestigung wurde ein Platz am Strande ausersehen und drei hier befindliche Steinhäuser durch entsprechende Verbindung verteidigungsfähig eingerichtet.
Am 11. Mai bereits kehrte der Araber Selim ben Salum, welcher oberhalb des Flusses seine Schamba hatte, auf einem Boote mit der weißen Friedensfahne zurück und bot seine sowie aller Araber Unterwerfung an. Ebenso schickten die Hauptführer an diesem Tage Boten zu uns, welche um Frieden[S. 216] und Begnadigung baten. Die »Carola« verließ am Nachmittag des 11. Mai die Rhede, zeigte sich dann vor Mikindani und kehrte von da nach Sansibar zurück. Am 12. wurde vom Reichskommissar mit dem Dampfer »München« eine Rekognoszierung den Lindifluß aufwärts unternommen und die Niederlassung des bereits erwähnten Selim besucht. Hier waren alle Araber der Umgegend versammelt und zeigten dem Reichskommissar ihre vollständige Unterwerfung an.
Am 13. wurde die Station Lindi mit 18 Europäern, zwei Kompagnien und 6 Geschützen dem Verfasser übergeben. Der Reichskommissar brach mit den übrigen Truppen nach Mikindani auf, wo er an demselben Nachmittag eintraf. Bereits über Land war an den Wali von Mikindani ein Brief abgesandt mit der Aufforderung, beim Eintreffen des Reichskommissars sich diesem friedlich zu unterwerfen. Und so kamen denn auch bei der Einfahrt in den Hafen bereits Boten mit weißen Flaggen entgegen, welche Briefe vom Wali und den Jumbes überbrachten, in denen sie ihre Unterwerfung anzeigten. Der Reichskommissar begab sich sofort an Land und fand an der Stelle der späteren Station im ganzen 100 meist bewaffnete Araber zum Schauri versammelt. Sie wurden ermahnt, sich in den Ortschaften um Mikindani ruhig zu verhalten, und es wurde ihnen mitgeteilt, daß am nächsten Morgen die Truppen ausgeschifft und mit dem Bau einer Befestigung begonnen werden würde. Eine Sorge für ihr Leben und Eigentum hätten die sich friedlich Unterwerfenden nicht zu hegen.
Nach Ausschiffung der Truppen am nächsten Morgen wurden auch hier die provisorischen Befestigungsarbeiten vorgenommen, nachdem die friedliche Unterwerfung aller Einwohner angenommen war. Nur ein Dorf, welches die Friedensflagge nicht gehißt hatte, wurde von den Negern geräumt.
Der Wali, der Jemadari und der Akida des Sultans wurden in die Dienste des Reichskommissars übernommen und zum Gehorsam verpflichtet. Die Leitung der weiteren provisorischen Befestigungsarbeiten wurde dem Chef Dr. Karl Wilhelm Schmidt übertragen, der einige Tage darauf auf Befehl des Reichskommissars die Station mit 11 Europäern, 2 Kompagnien und 4 Geschützen an Chef End zu übergeben hatte.[S. 217] Die beiden übrigen Kompagnien Dr. Schmidts sollten nach Bagamoyo und Pangani zurückgesandt werden. Er selbst hatte den Befehl, auf der »Schwalbe« nach Sansibar zu kommen.
Auf der Rückfahrt von Mikindani lief der Reichskommissar mit der »München« die Plätze Lindi und Kilwa nochmals an und fand daselbst alles in guter Ordnung. In Kilwa hatten sich bereits einige 100 Eingeborene wieder eingestellt. Der größte Teil der Aufständischen war noch einige Tagereisen von Kilwa entfernt versammelt. Kilwa Kisiwani hatte als Vertreter einen völlig arabisierten Italiener, der Jussuf genannt wurde, an Chef von Zelewski gesandt, mit der Bitte auch nach Kisiwani Truppen hineinzulegen.
Am 17. Mai traf der Reichskommissar wieder in Sansibar ein und ging von dort aus am 18. nach Sadani. Bana Heri, der dem Reichskommissar, wie erwähnt, sein Schwert, das er im Aufstande gegen ihn geführt, übersandt hatte, trug ihm jetzt die Bitte vor, ihm ein anderes Schwert zu übergeben, das er von jetzt an nur in deutschen Diensten tragen würde. Seine Bitte wurde erfüllt.
In Sadani war der Araber Mohammed ben Kassim aus Tabora, der allgemein beschuldigt wurde, den deutschen Kaufmann Giesecke im Jahre 1885 in Tabora ermordet zu haben, durch Lieutenant Sigl nach erfolgter Rekognoszierung durch den Irländer Stokes dingfest gemacht worden. Wißmann, der Mohammed ben Kassim bereits drei Jahre früher am Lualaba kennen gelernt hatte, erkannte denselben wieder und sandte ihn nach Bagamoyo, woselbst er ein Kriegsgericht über ihn anordnete. Der Sultan Said Ali selbst bat zwar, seinen Unterthan Mohammed ben Kassim ihm auszuliefern, doch wurde das Ansuchen von Wißmann abgeschlagen.
Am 26. Mai trat der Reichskommissar, dessen Gesundheit durch die fortwährenden Strapazen sich sehr erheblich verschlechtert hatte, einen ihm bewilligten Urlaub nach Deutschland an, nachdem er zuvor an den von Mikindani zurückgekehrten Chef Dr. Karl Wilhelm Schmidt für die Dauer seiner Abwesenheit die Geschäfte des Reichskommissariats übergeben hatte.
[S. 218]
Innerer Ausbau und Organisation des Kommissariats. — Beaufsichtigung und Kontrolle der Karawanen. — Verurteilung des Mörders Gieseckes, des Arabers Mohammed ben Kassim. — Deputationen aus dem Innern melden die Unterwerfung der Bevölkerung. — Einfall der Mafiti in Usaramo. — Expedition des Dr. Schmidt nach Usaramo bis an den Rufidji — Unterwerfung des Jumbe Pangiri. — Expedition des Chef von Perbandt nach Nguru zur Sicherung der katholischen Mission. — Verhandlungen mit der Bevölkerung im Süden. — Ausbau der Station Kilwa durch Zelewski. — Anknüpfung von Beziehungen mit den Eingeborenen um Lindi und Mikindani. — Expeditionen zu diesem Zweck in das Hinterland. — Die Sklavenfrage in und um Lindi. — Die Wahiyao und der Häuptling Maschemba. — Verhandlung mit letzterem. — Scheinbare Unterwerfung desselben. — Pulverschmuggel im Hinterland von Lindi. — Unterdrückung des Pulverschmuggels durch Benutzung der Eingeborenen und Händler. — Die Stämme im Hinterland des Südens. — Beschaffenheit des Hinterlandes. — Charakter der Lindi-Leute. — Expedition des Verfassers mit Chef End zu Maschemba. — Besuch des Makanda-Häuptlings Schikambo. — Krieg zwischen Schikambo und Maschemba. — Expedition des Dr. Schmidt mit den Stationschefs von Lindi und Mikindani zu den englischen Missionsstationen und an den Rovuma. — Gefecht bei Kisanga; Verwundung des Verfassers. — Der Rovuma. — Ankunft in Mikindani. — Informationsreise des Herrn von Soden nach Ostafrika. — Soden als Ersatz für Wißmann in Aussicht genommen.
Die Hauptaufgabe des Stellvertreters des Reichskommissars, Dr. Schmidt, lag auf friedlichem Gebiete. Nach der Wiedergewinnung der ganzen Küste und nach vollkommener Pacificierung des nördlichen Teils unseres Interessen-Gebietes konnte während der Abwesenheit Wißmanns an dem innern Ausbau und der Organisation des Reichskommissariats gearbeitet[S. 219] werden. Dr. Schmidt wurde dieser Aufgabe gerecht durch Erlaß einer Reihe von Bestimmungen über die Thätigkeit, Diensteinteilung und Befugnis der Stationschefs und die Abgrenzung der Stationsbereiche, welche natürlich durch die praktischen Verhältnisse vorgezeichnet waren. Bei der Feststellung des Verhältnisses der Stationschefs zur eingeborenen Bevölkerung und den Karawanen traf er Anordnungen über die Beaufsichtigung und Kontrolle der Karawanen, die Abstempelung der Schußwaffen, welche dieselben mit sich führten, über den Verkauf von Waffen und Munition an Karawanen und über den Kautschuckhandel, um der häufigen Verfälschung dieses wertvollen Produktes durch die Neger vorzubeugen, endlich über die militärischen Befugnisse der Stationschefs und Offiziere und dergleichen mehr. Im allgemeinen wurden hierbei natürlich die von Wißmann stets gehandhabten Grundsätze gewahrt und nur die bisher in der Praxis allgemein befolgten Prinzipien in feste Form gelegt.
Wir haben bereits erwähnt, daß es in Sadani gelungen war, den Araber Mohammed ben Kassim aus Tabora festzunehmen, und daß der Reichskommissar die kriegsgerichtliche Aburteilung desselben befohlen hatte. Die vorgenommene Untersuchung ergab die volle Schuld nicht nur in Betreff der dem Mohammed ben Kassim zur Last gelegten Ermordung des deutschen Kaufmannes Giesecke zu Tabora, sondern es wurde auch festgestellt, daß er im Jahre 1889 nach Begründung der Station Mpapua mit einer größeren Masse von Arabern und Sklaven einen Angriff auf die Station beabsichtigt und bereits im Anmarsch auf dieselbe gewesen sei. Nur durch die ihn aus Furcht vor den Deutschen zurückhaltenden Wagogo war er am Durchmarsch durch Ugogo behindert worden. Mohammed den Kassim wurde infolgedessen zum Tode durch den Strang verurteilt. Später erst sind zudem, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, seine Absichten gegen uns im vollen Umfange bekannt geworden.
Es entwickelten sich unter der Vertretung durch Dr. Schmidt die Verhältnisse im Norden weiterhin durchaus befriedigend. Viele Häuptlinge aus dem Innern, mit denen bereits Wißmann Beziehungen angeknüpft hatte, kamen herunter zur Küste und[S. 220] legten Zeugnis von ihrer Unterwerfung unter die deutsche Herrschaft und von ihrem Gehorsam ab. Der Karawanen-Verkehr nahm einen erfreulichen Aufschwung. Zu Masinde, dem Sitz des Häuptlings Simbodja, ließ Schmidt, obgleich dieser Häuptling ebenfalls Proben seiner Ergebenheit und guten Gesinnung gezeigt hatte, doch, um ihn kontrolieren zu können, eine befestigte Station durch Chef Ramsay anlegen.
Nur Usaramo wurde, trotz der Niederlage der Mafiti bei Jombo im Jahre zuvor, durch einen erneuten Einfall derselben auf große Strecken hin verwüstet und entvölkert, sodaß sich der stellvertretende Reichskommissar genötigt sah, eine Expedition gegen die Mafiti mit zwei Kompagnien zu unternehmen. Der Marsch wurde von Bagamoyo aus angetreten und führte über die alten Stationen der Ostafrikanischen Gesellschaft Dunda, Madimola und Usungula nach der französischen Missionsstation Tununguo, welche am meisten von den Mafiti bedroht erschien. Auf der Station wurde zur Bedeckung derselben ein weißer Unteroffizier und 20 Mann zurückgelassen. Dr. Schmidt marschierte nach dem Dorfe Zungumero, drei Tagereisen südlich von der Station, woselbst die die Mission bedrohende Abteilung der Mafiti sich befinden sollte. Das große und stark befestigte Dorf wurde jedoch verlassen vorgefunden. Da es nicht gelang, die Eingeborenen zum Eingehen auf Unterhandlungen zu bewegen, wurde der Ort niedergebrannt.
Der Weitermarsch führte nach dem Rufidji, woselbst ebenfalls noch Mafitis versammelt sein sollten. In diese Gegend hatte sich auch der Jumbe Pangiri, dessen Dorf Pangiri, wie wir in einem früheren Kapitel erwähnt, vom Reichskommissar bei Antretung der Mpapua-Expedition zur Strafe zerstört worden war, geflüchtet und hatte Unterstützung bei der Bevölkerung jener Gegend gefunden. Er erschien jedoch bei der Ankunft des Dr. Schmidt freiwillig in dessen Lager, um sich auf Gnade und Ungnade zu unterwerfen. Schmidt erteilte ihm Amnestie unter der Bedingung, daß er mit der Expedition zugleich nach der Küste zurückkehre und sich in seinem alten Dorfe niederlasse. In der That schloß sich Pangiri mit seinen Leuten sofort der Expedition an. Mit dem Jumbe Pangiri war der[S. 221] letzte der angesehenen Rebellen-Häuptlinge des nördlichen Teils der Küste zurückgekehrt.
Der Rückmarsch wurde zunächst längs des Rufidji angetreten. Dr. Schmidt, den dringende Verwaltungs-Geschäfte nach Sansibar riefen, marschierte in Eilmärschen von Mtansa aus mit einer kleinen Bedeckung nach Daressalam, während Chef Ramsay den Auftrag erhielt, sich mit dem Gros der Expedition über den Rufidji nach Kilwa zu begeben und bei dieser Gelegenheit die Verhältnisse des Hinterlandes von Kilwa möglichst aufzuklären.
Von den Mafitis war das ganze Land zwischen dem Kingani und dem Rufidji einerseits und der Küste und Mahenge andrerseits stark verwüstet; auch hatten sie überall wieder die gewöhnlichen Grausamkeiten verübt. Um diesen Einfällen der Mafiti vorzubeugen und die eingeborene Bevölkerung vor ihnen zu sichern, schlägt Dr. Schmidt die Anlage einer Station in der Gegend der Schuguli-Fälle am Rufidji vor, durch welche, nach Ansicht des Dr. Schmidt, sowohl die südlich des Rufidji wohnenden als auch die nördlichen Mafitistämme in Schach gehalten werden sollten; es ist dies indes von einer einzigen Station um ein Bedeutendes zu viel erhofft.
Einer Expedition des stellvertretenden Stationschefs von Bagamoyo, Herrn von Perbandt, in dieser Zeit sei noch Erwähnung gethan. Sie hatte den Zweck, kleinere nördlich der durch Nguru führenden Karawanenstraße vorgekommene Unruhen zu beschwichtigen, wurde auf Befehl des Reichskommissars ausgerüstet und von Herrn von Perbandt geschickt und schneidig durchgeführt.
Die Verbindung nach den Süd-Stationen war bei den großen Entfernungen und der während der Zeit des Südwest-Monsums herrschenden hohen See durch die kleinen Dampfer schwer aufrecht zu erhalten und wurde, da eine Masse Baumaterial und Proviant des öfteren nach den Stationen geschickt werden mußte, durch den vom Sultan von Sansibar gecharterten Dampfer »Barawa« hergestellt. Auf den Süd-Stationen selbst entwickelten sich die Verhältnisse in durchaus befriedigender Weise.
[S. 222]
Die Aufständischen um Kilwa hatten sich zunächst in der Absicht, weiteren Widerstand zu leisten, etwa in 8 Stunden Entfernung verbarrikadiert, doch gaben sie die Absicht eines Angriffs bald auf und faßten statt dessen den weniger energischen Entschluß, wenn ihnen von der Station Kilwa aus auf den Leib gerückt würde, Fersengeld zu geben. Der stellvertretende Reichskommissar hatte sich aber von der Möglichkeit überzeugt, daß die Verhältnisse um Kilwa, — nachdem der Ort seine verdiente Strafe durch das Bombardement und die Einnahme der Stadt erlitten und wir unserer Macht durch Anlage einer starken Station Ausdruck gegeben hatten, — weiterhin im guten zu regeln seien. Er gab deshalb die Instruktion, daß alles daran gesetzt werden sollte, die Leute zur Rückkehr zu bewegen, damit der alte Handelsplatz Kilwa bald wieder seine frühere Bedeutung zurückgewinne. Chef von Zelewski pflog auch durch Unterhändler mit den Aufständischen Verhandlungen, um dieselben zur Rückkehr in die Stadt zu bewegen, aber es dauerte trotz der immer gegebenen Versprechungen, daß sie geschont würden, geraume Zeit, ehe die Neger ihr Mißtrauen und ihre Furcht vor Strafe ablegten.
Zelewski gab sich in dieser Zeit mit dem größten Eifer dem Ausbau seiner Station und der Fürsorge für die Stadt hin und er, der leider ein Jahr darauf als Kommandeur der kaiserlichen Schutztruppe den Tod für die koloniale Sache in Uhehe sterben sollte, hat sich durch seine Thätigkeit in Kilwa ein bleibendes Denkmal gesetzt. Die äußerst praktisch angelegte Station, die aus einigen geschickt verbundenen arabischen Ruinen entstanden war, das in Kilwa erbaute Lazarett, die Entwässerung der die Stadt umgebenden Sümpfe, eine Wasserleitung in der Stadt, ein in das Meer hinausgelegter Steindamm, durch welchen die ungemein schlechten Landungsverhältnisse für die Boote verbessert wurden, geben das sprechendste Zeugnis von seiner Thätigkeit. Auf keiner der andern Stationen ist auch nur annähernd dasselbe erreicht worden, wie von ihm in Kilwa im Laufe von nur 10 Monaten.
Es gelang Zelewski endlich, die Führer der Aufständischen zur Rückkehr nach Kilwa zu bewegen und er hatte die Freude, diesen Platz zu seiner alten Bedeutung wieder erwachsen zu[S. 223] sehen. Nebenbei glückte es dem Stationschef, die Mörder der bei Beginn des Aufstandes ermordeten Beamten der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Krieger und Hessel, in Kilwa festzunehmen. Sie wurden im November 1890 vom stellvertretenden Reichskommissar zum Tode durch den Strang verurteilt.
Die Furcht vor den Mafiti, in diesem Fall den südlichen Mahengestämmen, veranlaßte die Leute des Hinterlandes, sich enger an die Station anzuschließen, da sie nur von dieser Hülfe gegen ihre alljährlich das Land nach der Regenzeit heimsuchenden Feinde erhoffen durften. Bei seinem Marsch vom Rufidji nach Kilwa wurden dem Chef Ramsay von keiner Seite aus auch nur die geringsten Schwierigkeiten gemacht oder Feindseligkeiten entgegengesetzt, er konnte nur überall die große vor den Mafitis herrschende Furcht konstatieren.
In Lindi und Mikindani war es nach dem Stationsbau und den damit zusammenhängenden Arbeiten, als Freilegung des Terrains, Straßen- und Gartenanlagen, Bau des Schießstandes, Strandarbeiten etc., ebenfalls die hauptsächlichste Aufgabe der dortigen Stationschefs, möglichst bald gute Beziehungen mit der Bevölkerung herzustellen, um den Karawanen-Handel, der zwischen dem Nyassa-See und unserer Küste bestand, bald wieder dorthin zu lenken. In Mikindani waren die Verhältnisse von vornherein friedliche, da auch der einzige anfänglich nicht für Unterwerfung geneigte unter den Rebellen alsbald sich eines besseren besann und zurückkehrte. Ebenso hatten wir bereits bei der Einnahme Lindi's erwähnt, daß auch dort die Rebellen vom Reichskommissar Amnestie erbeten hatten. Der Verfasser setzte als Stationschef natürlich ebenfalls alles daran, die früheren Rebellen zur Rückkehr zu bewegen, und dies gelang ihm auch gleich in der allerersten Zeit bei fast allen. Nur einen einzigen, den Hauptbeteiligten, Raschid Schapapa, hinderte die Furcht vor Strafe und Mißtrauen gegen uns an der Rückkehr. Die andern Hauptagitatoren beim Aufstande, Kadi Omar, Fundi Majaliwa, Mohammed ben Raschid, leisteten der Aufforderung zur Rückkehr alsbald Folge.
Es sahen sowohl Chef End, der Stationschef von Mikindani, wie auch der Verfasser in Lindi ihre Aufgabe darin, hier[S. 224] in diesen unsern südlichen Plätzen, wohin Europäer bisher noch wenig gekommen waren, wo selbst der Sultan von Sansibar außerhalb der festen Plätze eine Herrschaft nie ausgeübt hatte, uns mehr Fühlung mit den Eingeborenen zu verschaffen und diesen das große Mißtrauen, das uns hier anfangs entgegengebracht wurde, allmählich zu benehmen. Im Hinterlande der beiden Plätze ist besonders dadurch, daß die Bevölkerung nach Möglichkeit zu den großen in der ersten Zeit natürlich notwendigen Stations-Arbeiten herangezogen und hierdurch etwas mehr an uns gewöhnt wurde, in dieser Hinsicht ein bedeutender Erfolg erzielt worden.
Um Lindi selbst gab es indes noch eine andere Frage, deren Lösung nicht so leicht erschien, nämlich die Regelung des Verhältnisses der Araber und der besitzenden Klasse überhaupt zu den Sklaven.
Lindi ist von jeher nach zwei Seiten hin bekannt: erstens als Haupt-Sklavenplatz unserer ganzen Küste und ferner durch die häufig dort vorkommenden Sklaven-Aufstände. Die Sklaven haben sich hier in den letzten Jahren des öfteren gegen ihre Herren erhoben, ihnen nicht nur den Gehorsam aufgekündigt und sind entflohen, sondern sie haben direkt die Waffen gegen sie gekehrt. Sie hatten dabei im Hinterlande von Lindi, in Luagalla, an dem Wahiyao-Häuptling Maschemba eine kräftige Stütze und fanden bei ihm einen willkommenen Zufluchtsort. Außer in Maschemba's Gebiet fanden auch noch an vielen andern Plätzen Ansammlungen von Sklaven statt, welche dann eine Art Räuberbande bildeten und die Gegend beunruhigten.
Die Sklaverei in und um Lindi verdiente kaum diesen Namen; die Sklaven konnten thun und lassen, was sie wollten und wuchsen mit der dem Neger eigenen Unverschämtheit ihren Herren über den Kopf. Im Interesse der allgemeinen Sicherheit im Lande hätten wir eine strengere Form der Sklaverei geradezu erwünscht und mußten auf alle Fälle versuchen, dem bestehenden Zustande ein Ende zu machen. Diese Regelung der Verhältnisse blieb uns Stationschefs überlassen. Nachdem unter den Häuptlingen des Hinterlandes, die auf Aufforderung des Reichskommissars mit dem Verfasser in Verbindung[S. 225] getreten waren, sich auch Maschemba eingefunden hatte, wurde daran gegangen, bezüglich der Sklavenfrage mit dem Häuptling ein Einverständnis zu erzielen. Ich trug ihm auf, entweder selbst zu mir nach Lindi zu kommen, oder einen seiner Söhne zu schicken, damit dieser meinen Willen erführe und wir ein die Interessen des Landes sowohl, wie, soweit angängig, diejenigen Maschembas wahrendes Abkommen treffen könnten.
Maschemba, der in jener Zeit viel mit dem Verfasser korrespondiert hat, indem er die Briefe immer in Suaheli-Sprache in lateinischen Lettern von einem auf der englischen Mission erzogenen Yao-Burschen schreiben ließ, ging auf mein Verlangen ein und sandte seine beiden Söhne mit folgendem Schreiben:
»Mein lieber Freund. Ich befinde mich wohl. Die Geschenke, die Du mir geschickt hast, sind alle angekommen, 3 Hemden, 2 Kikois, 3 Maskattücher, 12 Ballen Zeug, 4 Lessos. Meinen Dank dafür. Du schreibst mir, daß ich selbst komme oder mein Sohn. Ich schicke Dir heute zunächst meinen jüngern Sohn; der große kommt nach, er bringt noch Geschenke für Dich. Er heißt Kantande Wadi Maschemba. Damit der Brief sehr schnell kommt, bringt ihn mein jüngerer Sohn. Viele Grüße von mir. Ich bin hier wohl. Maschemba bin Tschapama.«
Der hier angekündigte Kantande, der älteste von Maschembas Söhnen, traf denn auch bald nach dem jüngeren ein und brachte, nachdem mir Maschemba schon gleich im Anfang einmal Hühner und Ziegen gesandt hatte, nun abermals die angekündigten Geschenke, welche in Kleinvieh und Hühnern bestanden, mit. Außerdem brachte er für mich als Geschenk ein Monstrum von einem Weibe, die er wahrscheinlich für besonders schön gehalten hatte. Sie besaß einen Umfang wie mindestens 3 starke Männer zusammen, so daß sie kaum durch das Stationsthor eintreten konnte. Die Wache und alle Neger, welche diese Schönheit sahen, konnten sich des Lachens nicht enthalten. Die gute Absicht Maschembas wurde zwar anerkannt, das Weib aber schleunigst in Freiheit gesetzt.
An dem Verhalten der Söhne Maschembas merkte ich bald, daß, wenngleich sie natürlich in Lindi auf alle Vorschläge[S. 226] und Bedingungen eingingen, und wenn auch Maschemba selbst ernstlich die Absicht zu haben schien, mit mir, falls seine Interessen gewahrt würden, sich dauernd auf einen guten Fuß zu stellen, an ein ernstliches Abkommen nicht zu denken war: sie hätten alles zugestanden, die Sache aber wäre im großen und ganzen doch beim Alten geblieben. Der Grund hierfür lag wohl darin, daß es Maschemba zwar verstanden hatte, die teils ihren Besitzern entlaufenen, teils von ihm von überall her geraubten Sklaven vorzüglich zu organisieren und gewissermaßen als große Räuberbande auszubilden, daß aber seine Autorität über diese Horde doch keine unbedingte war.
Ich entschloß mich deshalb, sobald meine Reisen in der Umgegend von Lindi beendet wären, Maschemba selbst aufzusuchen und zu sehen, was mit ihm persönlich auszurichten sei.
Meine Absicht war es, Maschemba zu verpflichten, daß er jeden ihm zugelaufenen Sklaven an die Station in Lindi ausliefere. Der Stationschef sollte dann den ursprünglichen Besitzer zitieren und diesem, wenn nicht besondere Gründe dagegen sprächen, den Sklaven zurückgeben, ihn aber zugleich verpflichten, an Maschemba für den Transport des Sklaven und die Auslieferung pro Kopf eine bestimmte Summe, die ich auf 5 Dollars anschlug, auszuzahlen. Ein solches Verfahren mag vielleicht heutigen Tages den jetzt geltenden Prinzipien bezüglich unseres Verhaltens in der Sklavenfrage entgegenstehen, scheint mir aber doch den damaligen Zuständen des Südens angemessen gewesen zu sein, da es vor allem darauf ankam, die Sicherheit des Gebietes und der Karawanenstraßen herbeizuführen und von zwei Übeln das kleinere mit in den Kauf zu nehmen.
Aber auch noch andere Umstände, als die Sklavenfrage, machten die Verhältnisse im Hinterlande von Lindi schwierig und stellten an den Stationschef weitgehende Ansprüche nichtmilitärischer Natur.
Daselbst bestand nämlich ein großartiger Pulverschmuggel sowohl von unserer Küste aus, wie auch von portugiesischem Gebiet nach unserem Hinterland. Eine Anzahl Leute im Hinterlande von Lindi selbst, unter denen wiederum Maschemba, sowie Araber und Eingeborene, hatten es verstanden, den[S. 227] Karawanenhandel, der von den Seen herunterkam, zum großen Teil an sich zu ziehen. Sie hielten selbst größere Lager der überall in Afrika am meisten begehrten, besonders aber im Süden verlangten Handelsartikel, nämlich Pulver, Munition und Gewehre und tauschten dagegen die Produkte des Innern, besonders Sklaven, ein.
Dies hatte den Nachteil, daß die Karawanen sich der Kontrolle an der Küste entzogen und ihre Geschäfte schon im Hinterlande abmachten, daß also an unserer Südküste eine Art Zwischenhandel bestand, der die Zoll-Einnahme stark beeinträchtigte und uns den Einfluß auf den wichtigsten und gleichzeitig gefährlichsten Einfuhrartikel benahm. Die verkaufte Munition wurde entweder nach den Plätzen unserer Küste, die nicht besetzt waren, eingeschmuggelt oder vom portugiesischen Gebiet über den Rovuma, wo ja auch Beobachtungsposten nicht bestanden, in das Hinterland eingeführt.
Dem mußte natürlich nach Möglichkeit entgegengearbeitet werden. Ich ließ durch meine Beziehungen zu den Eingeborenen und durch besoldete Spione diejenigen Leute innerhalb des Machtbereichs der Stationen ausfindig machen, die einen solchen verbotenen Handel betrieben und erschwerte ihnen ihr Gewerbe nach Möglichkeit. Ferner aber verkaufte ich, da ich diesen Zwischenhandel, namentlich die Schmuggelei über den Rovuma zu Maschemba und jenen Häuptlingen hin nicht gänzlich verhindern konnte, von der Station aus Gewehre und Munition an die Karawanen und zog diese dadurch an die Küstenplätze.
Da jedoch die Abgabe von Kriegsbedarf an die Karawanen nicht vorgesehen war, und auf den Stationen das nötige Pulver zum Verkaufe nicht vorhanden war, benutzte ich den Umstand, daß meine strenge, in der Umgegend von Lindi eingeführte Überwachung der den verbotenen Handel betreibenden Leute einerseits, wie Nachsicht gegen dieselben andrerseits einen Teil derselben bewog, mir ihre Vorräte auszuliefern. Ich vergütete ihnen natürlich, damit sie keinen direkten Schaden hatten, den Verlust an Waare durch Zahlung einer kleinen Summe.
Sodann wurden möglichst weit nach dem Innern hinein den vom Nyassa-See kommenden Karawanen Vertrauenspersonen[S. 228] entgegengeschickt, die ihnen mitteilten, daß sie ohne Furcht an die Küste selbst kommen, dort eine gute Aufnahme finden und die von ihnen gewünschten Artikel kaufen könnten.
Durch dieses Vorgehen gelang es sowohl dem Chef End in Mikindani, der dieselbe Taktik befolgte, wie mir in Lindi, den Karawanenverkehr an die Küste zu ziehen. Daß dabei bisweilen Sklaven vom Nyassa her bei den Elfenbein-Karawanen mit unterliefen, war erklärlich; ebenso notwendig war es auch unter den beschriebenen Verhältnissen, ein Auge zuzudrücken. Es wäre sonst der ganze Verkehr gestört oder nach dem benachbarten portugiesischen Gebiet, wo eine Kontrolle nicht bestand, hinübergelenkt worden. Wir beschränkten uns darauf, eine Sklaven-Ausfuhr von der Küste nach Sansibar, soweit dies in unsrer Macht stand, zu verhindern. — Allerdings befanden sich unter den ankommenden Karawanen in Lindi auch solche von den Wahiyao-Häuptlingen Mataka aus Mwera am Nyassa-See und Makendjira von Tschusiunguli, von denen der erstere vielleicht ein Jahr früher zwei, der letztere mit seinen Leuten einen Engländer ermordet hatte, um sich an ihnen für zu strenges Vorgehen der Engländer an der Küste in der Sklavenfrage zu rächen. Die Umstände indes und die Unmöglichkeit in den Verhältnissen am Nyassa in dieser Beziehung vorläufig Wandel zu schaffen, zwangen uns zu mildem Verhalten.
Eine weitere Landplage im Süden bildeten die das Hinterland beunruhigenden Mafiti-Stämme, besonders die Magwangwara, die mehr noch als die Sklavenjagden der Araber die Gebiete der angrenzenden friedlichen Bewohner entvölkerten und die sich immer mehr und mehr ausdehnten. Die Magwangwara werden häufig als Zulus angesehen, und werden auch wie diese Wangoni genannt, ohne es indes wirklich zu sein. Es hat in früherer Zeit allerdings von Süden her eine Invasion der Zulus stattgefunden, die weite Gebiete bis an den Tanganjika heran entvölkerten. Die meisten Stämme konnten ihnen nicht widerstehen und es sind hier und da Niederlassungen von Zulus entstanden. Gerade die Magwangwara waren jedoch ein Stamm, der den Zulus erfolgreich Widerstand leistete. Sie fanden es jedoch nützlich, die Sitten,[S. 229] Tracht und Kampfesweise der Zulus anzunehmen und sich einem bequemeren Gewerbe, dem des Raubes und der Plünderung, hinzugeben, mit dem sie im Laufe der Zeit ihren Nachbarn ebenso gefährlich wurden, wie die Zulus in früheren Zeiten. Eigentliche Zulu sind die Magwangwara nicht.
Der kriegerische Sinn aller am Nyassa wohnenden Stämme, so auch schon der Wahiyao, ist die Ursache, daß sie sich auf Kosten der schwächeren, friedlicheren Nachbarvölker weiter und weiter ausbreiten.
Das unmittelbare Hinterland von Lindi, insbesondere das Hochplateau, welches sich hinter der sich unmittelbar an der Küste hinziehenden Hügelkette erhebt, das sogenannte Makanda-Plateau, war ursprünglich von den Makanda, den Makua und Wamwera bewohnt; aber auch hier sind die Wahiyaos eingedrungen und beherrschen große Gebiete jenes fruchtbaren Plateaus, in dem sie ihre Grenze und ihre Macht immer mehr und mehr erweitern.
Man kann nicht sagen, daß mit dem Zunehmen der kriegerischen Bevölkerung eine Verminderung der Bodenkultur des Landes eingetreten sei, vielmehr wird diese auch von den kriegerischen Stämmen des Südens in gleicher Weise wie von den Mafiti des Nordens, — die allerdings zumeist ihre Weiber und Sklaven arbeiten lassen, — in der fleißigsten Weise betrieben. Davon legen z. B. die vielen nach der Küste kommenden Produkte Zeugnis ab.
Von der sonstigen ursprünglichen Beschaffenheit des Landes sei noch erwähnt, daß fast überall, wo nicht schon durch Bebauung eine regelrechte Kultur eingeführt ist, ein undurchdringlicher, stark mit Kautschuk-Lianen durchzogener Busch, wie wir ihn im Norden nur ganz vereinzelt finden, hier allgemein das Land bedeckt. Die Märsche unserer Truppen, das merkten wir stets bei unsern Expeditionen im Süden, werden dadurch ungemein erschwert, besonders Feinden gegenüber, wie wir sie im Süden vorfanden, die sich ganz ausgezeichnet auf die Ausnutzung des Terrains und auf die Anwendung des kleinen Krieges in Afrika verstehen. Selbst kleine Abteilungen konnten uns zuweilen die erheblichsten Schwierigkeiten bereiten.
[S. 230]
In Lindi selbst stand ich vor der Aufgabe, der erhaltenen Instruktion gemäß, immer gute Beziehungen mit den Eingeborenen und besonders mit den Machthabern des Landes, auch wenn diese am Aufstand und selbst an der Vertreibung der Ostafrikanischen Gesellschafts-Beamten beteiligt waren, herbeizuführen. Dem schon erwähnten Kadi Omar und dem Nassr Munimgando, Leuten, die in ihren persönlichen Interessen durch den zwischen dem Sultan von Sansibar und der Ostafrikanischen Gesellschaft geschlossenen Vertrag geschädigt und zur Teilnahme am Aufstand bewogen waren, gab ich gewissermaßen Vertrauensstellungen. Ersterer diente mir als Sekretär und hatte die Suaheli-Korrespondenz mit den Machthabern der Umgegend und des Hinterlandes zu besorgen, nebenbei hatte er auch als Kadi ab und zu mir ratend zur Seite zu stehen. Letzterer hatte besonders nach außen hin darauf zu wirken, daß die Karawanen nach der Küste heruntergezogen würden. Jene beiden Leute waren ja, genauer betrachtet, ziemlich große Halunken, doch waren sie unter damaligen Umständen mir sehr nützlich. Leute dieser Art sind besonders dann gut zu verwerten, wenn sie in jeder Weise merken, daß man ihnen auf die Finger sieht.
Die Erwähnung dieser Verhältnisse habe ich für notwendig gehalten, weil sie die Grundlage der nächsten Ereignisse im Süden bilden und veranschaulichen, warum bei der Geringfügigkeit der uns zu Gebote stehenden Mittel in unserm südlichsten Gebiet ein wesentlich verändertes Vorgehen im Gegensatz zum Norden notwendig war.
Nachdem sowohl Chef End in Mikindani, als auch der Verfasser in Lindi die Arbeiten beim Aufbau der Stationen soweit geführt hatten, daß die Umwallung der Stationen und die Fertigstellung der Bastionen und Mauern vollendet war, gingen wir beide gemeinsam an die Ausführung der bereits angedeuteten Expedition in unser Hinterland. Sie galt dem Besuch des Wahiyao-Häuptlings Maschemba und der Verhandlung mit ihm, außerdem einem Besuch des einflußreichen Oberhäuptlings der Makanda Schikambo.
Ein jeder von uns hatte die disponiblen Truppen aus seiner Station herausgezogen und wir vereinigten uns in Lindi, von wo aus die Expedition angetreten wurde.
[S. 231]
Schon am dritten Marschtage erreichten wir Dörfer der Wahiyao und hatten mit diesen aus ganz geringfügigen Ursachen (Felddiebstahl der Träger u. dergl.) Streitigkeiten, wobei es mit Mühe und Not gelang, ein kriegerisches Einschreiten zu vermeiden. Am vierten Tage, an dem wir Maschembas Dorf erreichen sollten, sandte uns dieser auf halbem Wege seinen ältesten Sohn mit einer Begleitmannschaft von etwa 40 Leuten zu unserer Begrüßung entgegen. Von den Wahiyaos wurden zur Feier des Tages Kriegstänze aufgeführt, und von jetzt an auf dem ganzen Wege bis zu Maschemba hin knallten Freudenschüsse, die Maschemba von der Annäherung der Karawane in Kenntnis setzen sollten. Nach Passierung eines vor dem Dorfe des Maschemba befindlichen ganz dichten Busches, der selbst auf dem schmalen Fußpfade eine Menge ganz besonderer Hindernisse bot, wurden wir von einer aufgeregten, total betrunkenen Bande, der besonders die deutsche von uns selbstverständlich mitgeführte Flagge unangenehm war, empfangen.
Die zahlreichen, zu vielen Hunderten hier versammelten Leute Maschembas schossen ihre Gewehre immer noch unter der Firma Freudenschüsse in die Luft ab, ein Zeichen, wie wenig es ihnen an Pulver und Munition mangelte.
Da das Benehmen der Leute höchst auffallend und wenig Vertrauen erweckend erscheinen mußte, ließen wir nach der Ankunft unsere Truppen inmitten der Menge ein Carré formieren, und als dann Maschemba immer noch nicht zur Begrüßung sich eingefunden hatte, wurde ihm ein Bote entgegengesandt, der ihm unser kategorisches Verlangen nach seinem Erscheinen überbrachte. Zugleich sollte er dafür sorgen, daß die Banden ihr ungeberdiges Benehmen einstellten; andernfalls würden wir auf die Menge Salven abgeben und das Dorf bestrafen.
Maschemba leistete der Aufforderung sofort Folge und kam schwerbetrunken bei uns an, entschuldigte sich und seine Leute und meinte, dieselben hätten erst am Abend des vorhergehenden Tages von unserer Ankunft erfahren, und aus Freude über die seinem Dorfe zu Teil werdende Ehre sich leider in Pombe betrunken.
[S. 232]
Es war unter diesen Umständen natürlich an eine Verhandlung garnicht zu denken. Maschemba befahl seinen Leuten auf mein Verlangen, auseinanderzugehen und sich ruhig zu verhalten, während wir unter Beobachtung aller nöthigen Vorsichtsmaßregeln Lager bezogen.
Um unnütze Reibereien mit den Leuten zu vermeiden, mußte Maschemba Wasser, Brennholz und Baumaterial für den Lagerbau, sowie die nötige Verpflegung an Feldfrüchten und Kleinvieh ins Lager schaffen. In besonders erfreulicher Weise abstechend war das würdige Benehmen unserer Sudanesen-Soldaten gegenüber den ungeberdigen Horden, auf die sie mit Verachtung herabblickten.
Der Abend des Tages wurde insofern noch gemütlicher, als Maschemba mit seiner Familie und den einflußreichsten seiner Leute zu mir ins Lager kam und große Kalebassen Pombe mitbrachte, die dann gemeinsam ausgetrunken wurden. Maschemba selbst war natürlich wieder sein bester Gast. Ich benutzte die Gelegenheit, Maschemba einen vorher bereits beschlossenen Besuch des stellvertretenden Reichskommissars Dr. Schmidt für einen Monat später in Aussicht zu stellen und befahl ihm dann für eine anständige Aufnahme Sorge zu tragen, wofern er weiterhin darauf Wert legte, mit uns ein gutes Einvernehmen aufrecht zu erhalten.
Am nächsten Tage ging es zu dem Makandahäuptling Schikambo, der die bittersten Klagen über die fortwährenden Beunruhigungen durch Maschemba vorbrachte. Von Schikambos Dorf Niangamala ging der Marsch nach Ikonga, wo die Expedition sich trennte. Chef End marschierte von hier aus nach Mikindani, ich selbst über den Ukeredi-Fluß nach Lindi zurück.
Bald nach meiner Ankunft in Lindi empfing ich von Maschemba ein Schreiben, worin er für das Benehmen seiner Leute um Entschuldigung bat, und seine friedlichste Gesinnung und Unterwürfigkeit beteuerte. Ohne viel hierauf zu geben, war es mir doch erwünscht, wenigstens äußerlich die Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten zu sehen, um den Karawanenverkehr nicht zu sehr zu schädigen.
[S. 233]
Bald indes drangen Nachrichten nach Lindi über ernstere Streitigkeiten, die zwischen den Wahiyao Maschembas und den Makanda, den Leuten Schikambos, ausgebrochen waren. Nachdem zuerst die Wahiyao einige Verluste erlitten hatten, drangen sie im Gebiet der Makanda siegreich vor und zerstörten einige Dörfer derselben von Grund aus. Einzelne Makanda flüchteten bis nach Lindi, wohin Schikambo von dem Überfall Maschembas berichtete. Maschemba seinerseits bedachte uns mit einem Briefe, worin er angab, daß Schikambo durch Ermordung eines Verwandten Maschembas eine Blutschuld auf sich geladen habe. Er, Maschemba, sei dadurch zum Kriegszuge gegen die Makanda bewogen worden; nachdem er jetzt Rache genommen, wäre für ihn der Streitfall beendet, zumal er selbst Verluste erlitten hätte. Er wolle nur von der Sache Mitteilung machen, um falsche Nachrichten von feindlicher Seite zu berichtigen.
Die Entschuldigung Maschembas erschien von vornherein haltlos, und es wurde sowohl vom Verfasser, wie vom Stationschef in Mikindani beim stellvertretenden Reichskommissar beantragt, nunmehr ernstlich gegen Maschemba vorgehen zu dürfen, um entweder von ihm Garantie dafür zu erhalten, daß ein mit ihm getroffenes Abkommen auch wirklich gehalten werde oder gegen ihn mit Waffengewalt einzuschreiten. Da schon vorher der stellvertretende Reichskommissar eine Expedition zum Besuch der englischen Missionsstation des Hinterlandes und an den Rovuma zum Zweck der Untersuchung auf das Vorhandensein von Kohlen beschlossen hatte, wurde die Expedition sofort vorbereitet.
Die außerordentliche Wichtigkeit eines Kohlenlagers in unserem Gebiete braucht keine besondere Begründung. Verfasser hatte bereits früher nach Sansibar über das Vorhandensein von Kohlen berichtet. Vom Vereinigungspunkt des Rovuma und Rienda sollte ein Mann, Namens Wadi Bakari Kohlen in einem Canoe nach der Küste gebracht haben. Der Sultan Said Bargasch hatte davon erfahren und einen französischen Ingenieur in diese Gegend gesandt. Außerdem wurde dem Verfasser berichtet, daß bereits einen Tagemarsch westlich von Mschinga Leute von Raschid Schapapa vor jetzt[S. 234] 7 Jahren Kohlen gefunden und nach Lindi gebracht hätten, wovon ebenfalls an Said Bargasch berichtet worden sei. Der Sultan habe den Ort des Vorkommens wissen wollen, jedoch hätten Raschid Schapapa und seine Leute das Vorhandensein von Kohlen bestritten und überhaupt nichts von Kohlen wissen wollen, in der Absicht natürlich, den Sultan oder gar die Europäer von weiterem Vordringen ins Innere abzuhalten.
Die erwähnte Expedition des Dr. Schmidt, zu welcher 2 Kompagnien Sudanesen, eine Kompagnie Zulu, ein 4,7 cm Geschütz, ein Maxim-Gun und die nötigen Träger mitgenommen wurden, setzte sich am 6. Oktober von Lindi aus ins Hinterland in Bewegung. Es nahmen daran Teil von den Offizieren außer Dr. Schmidt die beiden Stationschefs von Mikindani und Lindi (End und der Verfasser), Chefarzt Gärtner, die Lieutenants Scherner, Heymons, von Zitzewitz und Proviantmeister Jancke. Vor dem Antritt der Expedition war Maschemba von den freundlichen Absichten des stellvertretenden Reichskommissars brieflich benachrichtigt und ihm nochmals anbefohlen worden, die Expedition, wenn sie in sein Gebiet komme, gut aufzunehmen und Exzesse seiner Leute zu verhüten. Obgleich Maschemba bis zuletzt den Schein der Unterwürfigkeit bewahrt hatte, drangen doch schon bei Antritt der Expedition Gerüchte zu uns, daß Maschemba alle Anstalten getroffen hätte, diesmal dem Vorrücken in sein Gebiet bewaffneten Widerstand entgegenzusetzen.
Der Plan des Dr. Schmidt war, wie erwähnt, die Stationen der englischen Universitäts-Mission, Masasi und Nevala, zu besuchen, dann südlich nach dem Rovuma abzubiegen und von dort aus auf dem Rückwege Maschembas Gebiet zu durchziehen, um mit diesem, wenn möglich, auf friedliche Weise ein Abkommen zu treffen, andernfalls ihn anzugreifen. Nachdem die ersten Tage unseres Marsches zurückgelegt waren und wir den Wamwera-Ort Mtua bereits östlich von uns hatten, wurden wir am 4. und 5. Marschtage von Wahiyao-Horden Maschembas auf dem Marsche durch das Dickicht in höchst ungünstigem Terrain angegriffen und wurden uns zwei eingeborene Führer weggeschossen. Es gelang, die angreifenden[S. 235] Horden zurückzuschlagen und die Führer durch andere zu ersetzen. Als wir Maschembas Gebiet hinter uns hatten, wurde der Marsch nach Masasi ohne Störung fortgesetzt. Die Missionsstationen der Engländer waren, da sie stets dem Überfalle der Wahiyao- und Mafiti-Stämme ausgesetzt waren, nur provisorisch aus Bambus hergestellt, damit die Missionare in der Lage waren, sie bei drohender Gefahr abzubrechen und sofort zu verlassen.
Von Masasi wandte sich die Expedition nach der Haupt-Missionsstation Nevala. Am 20. Oktober wurde in Kisanga das Lager bezogen. In der Umgegend waren in derselben Weise wie unmittelbar hinter Lindi Wahiyao und Makanda angesiedelt. Kisanga selbst ist ein starkes, auf einer steilen Höhe gelegenes, recht ausgedehntes Dorf. Wir lagerten an einem Bache am Fuße der Höhe und glaubten besondere Besorgnis hier nicht hegen zu müssen, als plötzlich ein Träger auf uns zugelaufen kam und berichtete, daß einige Boys und Träger in Kisanga, wo sie Streit bekommen hätten, von Wahiyao festgenommen, gebunden und durchgeprügelt worden seien. Da zweifellos eine gewisse Schuld auf Seiten der Träger und Boys lag, welche in dem fremden Dorfe nichts zu suchen hatten, außerdem die Bewohner des Dorfes gerade ein Pombefest feierten und sich dabei total betrunken hatten, erschien es erwünscht, im guten die festgenommenen Leute von den Wahiyao herauszubekommen.
Chef End wurde mit seiner aus Mikindani mitgenommenen Kompagnie zur Unterhandlung resp. zur Bestrafung der Leute von Dr. Schmidt abgesandt. Der Verfasser erbot sich dem Dr. Schmidt, als Chef End diesen Befehl erhalten hatte, mit Chef End zusammen abzumarschieren und, wenn möglich, die Sache zu einem guten Abschluß zu bringen. Aber schon als wir die steile Höhe, da es das Terrain nicht anders gestattete, in Kolonnen zu einem emporklommen, merkten wir, daß hier im guten nichts auszurichten sei. Der Schall der Kriegsgoma tönte uns entgegen. Es blieb also nichts übrig, als die Stellung der zum Kampfe fertigen Wahiyao zu erstürmen und einzunehmen.
Die Wahiyao hatten sich hinter hohen Felsen an dem von uns erklommenen Fußpfade gut gedeckt und feuerten auf[S. 236] die von unten heranrückenden Truppen. Gleich bei den ersten Schüssen erhielt der Verfasser eine Kugel in die linke Brust, die an der Rippe entlang ging, den linken Oberarm durchdrang und dann noch den direkt hinter dem Verfasser gehenden Chef End traf, dem sie jedoch nur eine leichte Kontusion beibrachte. Ich erhielt vom Chefarzt Gärtner auf der Stelle im feindlichen Feuer den ersten Verband angelegt. Die Truppen wurden indes nicht aufgehalten und drangen unter Chef End unerschrocken die steile, schwer zu erklimmende Höhe empor. Von dem in brillanter Stellung befindlichen Gegner wurde unglaublich schlecht geschossen: nur drei von den farbigen Soldaten erhielten noch Verwundungen.
Der Gegner wurde aus seiner Deckung, in der er sich bei einigermaßen gutem Schießen gegen jeden Feind hätte halten können, geworfen, die zerstreut auf der Anhöhe liegenden Dörfer zerstört, der Feind weiterhin verfolgt und demselben bedeutende Verluste, deren Höhe jedoch nicht genau zu konstatieren war, beigebracht. Die gefangenen Träger und Boys wurden teils an demselben Tage befreit, teils am nächstfolgenden Tage durch Vermittlung der Station Nevala ausgeliefert. Das Verhalten der Wahiyao von Kisanga, die allerdings von Maschemba aufgereizt waren, war eigentlich nur auf die Trunkenheit derselben und auf den mit den Trägern und Boys gelegentlich des Pombefestes entstandenen Streit zurückzuführen. Den Tag nach dem Gefecht haben jedenfalls die Wahiyao von Kisanga einen ebenso moralischen wie physischen Katzenjammer gehabt.
Am 21. Oktober wurde Nevala erreicht und dort ein Rasttag gemacht, dann aber wegen der Wasserarmut des Gebietes zwischen dem Rovuma und Maschembas Land und wegen der Verwundeten in der Expedition, welche die Marschfähigkeit derselben beeinträchtigten, das Vorgehen gegen Maschemba für jetzt aufgegeben und für den nächsten Monat in Aussicht genommen. Wir zogen von hier unmittelbar am Rovuma, den wir südlich von Nevala erreichten, einige Tage ostwärts entlang und traten dann den Rückmarsch nach Mikindani an. Der Rovuma als Fluß enttäuschte uns gründlich, da derselbe bequem an allen Stellen zu Fuß zu durchwaten[S. 237] war. Das Wasser reichte uns zu jener Zeit nicht einmal bis an den Leib, aber auch in der Regenzeit dehnt sich der Fluß nur in die Breite aus und zeigt ein ganz flaches Bett; nirgends besteht eine größere Tiefe.
Am 31. Oktober traf die Expedition wieder in Mikindani ein; es wurde daselbst außer der nach Mikindani gehörenden Kompagnie, auch die von Kilwa zur Expedition zugezogene Kompagnie zurückgelassen. Die Expeditions-Kompagnie von Lindi wurde am selbigen Tage eingeschifft und von Dr. Schmidt nach Lindi gebracht. Daselbst übernahm Lieutenant von Zitzewitz in Vertretung des Verfassers vom Lieutenant Wolfrum, der während der Expedition die Vertretung gehabt hatte, die Stationsgeschäfte von Lindi. Der Verfasser mußte nach Sansibar überführt werden, wo sich dann wegen seiner Verwundung das Antreten eines Urlaubs nach Deutschland als notwendig herausstellte: durch die Verwundung der Nerven des linken Oberarms war der ganze linke Arm gelähmt.
In Sansibar angekommen, fanden wir daselbst den zu seiner Orientierung über die Verhältnisse der Kolonie von Deutschland nach Sansibar gesandten, bisherigen Gouverneur von Kamerun, Freiherrn von Soden vor, während Wißmanns Ankunft und Wiederaufnahme der Geschäfte des Reichskommissariats für den 1. Dezember angekündigt war. Die Heraussendung des Herrn von Soden hatte allerdings zunächst den Zweck seiner persönlichen Informierung, es war aber bereits damals Herr von Soden als Ersatz für Wißmann bestimmt. Ein solcher Ersatz des allseitig verehrten Kommandanten, dessen afrikanischer Erfahrung sich jeder ohne weiteres beugen konnte und mußte, unter Verhältnissen, welche für den Augenblick zwar friedlich erschienen, aber von niemandem damals schon als dauernd betrachtet werden konnten, durch einen Civilbeamten, welcher von Ostafrika nicht viel wußte, konnte keinem der Beamten und Offiziere, ja nicht einmal den Kaufleuten sympathisch sein.
Das allgemeine, einstimmige Urteil ging dahin, daß an leitender Stelle die wahren Verdienste Wißmanns weder erkannt, noch gewürdigt wurden. Wir haben an den verschiedensten Stellen dieses Buches darauf hingewiesen, daß[S. 238] nicht die militärische Thätigkeit allein es war, welche jedem die höchste Achtung vor Wißmanns Blick und Fähigkeiten abnötigte, sondern ganz besonders sein überaus großes, organisatorisches Talent. Wenn man ihm die mangelhafte Rechnungsführung nicht verzeihen konnte, so konnte dem durch die Einstellung geeigneter Rechnungsbeamten besser abgeholfen werden, als durch eine vollkommene Umgestaltung der Verhältnisse, die uns draußen des Führers beraubte. Niemand weder in Deutschland, noch in Ostafrika konnte und wollte glauben, daß eine solche aus der Natur der Dinge sich ergebende Kleinigkeit, wie das Rechnungswesen zur Abdankung Wißmanns die Ursache habe geben können, und noch heute sucht man vergeblich nach innern stichhaltigeren Gründen für die Ernennung Sodens. Die äußere Anerkennung der Verdienste Wißmanns in Deutschland konnte, so glauben wir wenigstens behaupten zu können, ihn nicht dafür entschädigen, daß das Hauptwerk seines Lebens fast vollendet einem andern übergeben wurde.
Die Thätigkeit Wißmanns nach seiner Wiederankunft in Sansibar im Anfang Dezember 1890 konnte nach der Lage der Verhältnisse nur noch als provisorische betrachtet werden, als eine Art Überleitung zum Civil-Gouvernement des Herrn von Soden, dessen Ernennung bald in Berlin vollzogen wurde.
[S. 239]
Ankunft Wißmanns in Sansibar am 1. Dezember 1890. — Vorbereitungen auf den Stationen zur definitiven Uebernahme der Küste nach dem deutsch-englischen Abkommen. — Expedition des Chef Ramsay gegen Maschemba. — Außerordentliche Schwierigkeiten des Marsches. — Expedition unglücklich. — Gütlicher Vergleich und Frieden mit Maschemba, erreicht durch die Initiative des Chefs End. — Fertigstellung der südlichen Stationen. — Unsichere Verhältnisse auf der Karawanenstraße nach dem Kilimandscharo. — Wißmanns Expedition nach dem Kilimandscharo. — Eroberung der Befestigung des Sultans Sinna. — Regelung der Verhältnisse am Kilimandscharo und Stationsanlage daselbst. — Rückmarsch nach der Küste. — Einfall der Wahehe in Usagara. — Expedition des Chef Ramsay dahin. — Friedliche Verhandlung mit den Wahehe. — Schlußbericht Wißmanns über seine gesamte Thätigkeit.
Am 1. Dezember 1890 übernahm Major von Wißmann vom Chef Dr. Schmidt, der sich auf einen längeren Urlaub nach Deutschland begab, wieder die Geschäfte des Reichskommissariats für die Zeit bis zum 1. April 1892. Seine erste Thätigkeit bestand in einer Bereisung der Küste, um sich von dem Zustande der Stationen zu überzeugen und Anordnungen für die am 1. Januar 1891 angeordnete feierliche Occupation der Küste mit Hissung der deutschen Flagge zu treffen. Nach Abschließung des Deutsch-Englischen Vertrages, den wir in einem besonderen Kapitel besprechen werden, war die Küste definitiv und formell in unsern Besitz übergegangen, während sowohl wir, wie die Eingeborenen immer der Ansicht gelebt hatten, daß dieselbe von der Schutztruppe durch ihr daselbst vergossenes Blut erobert worden sei. Die Thatsache, daß ein Ankauf derselben unter Zahlung von[S. 240] 4,000,000 Mark stattgefunden habe, und daß wir uns noch dazu der englischen Vermittlung, wie es im Vertrage ausgemacht war, beim Sultan von Sansibar bedienen mußten, überraschte uns ganz gehörig. Doch hierüber, wie gesagt, an einer andern Stelle.
Der Übergang der Küste in unsern Besitz war jedenfalls für den Januar 1891 festgesetzt, und war dies auch die Veranlassung für Wißmann, die von Dr. Schmidt gegen Maschemba geplante Expedition nicht selbst zu führen, sondern die Führung dem Chef Ramsay zu übertragen. Derselbe marschierte im Dezember von Mikindani mit 2 Sudanesen- und 2 Zulu-Kompagnien ab und wurde am 26. Dezember bei dem Dorfe des Makanda-Häuptlings Schikambo im Makanda-Gebiet, bis wohin die Scharen des Maschemba vorgedrungen waren, von diesen angegriffen. Allerdings wurde der Gegner zurückgeschlagen, immer und immer wieder jedoch belästigte er die vorwärts marschierenden Truppen. Die Wahiyao griffen nicht nur von der Seite her die Spitze der Expedition an und beschossen sie, sondern sie ließen die Spitze meist ruhig vorüberziehen und feuerten dann in die Mitte der Marschkolonne Salven hinein, brachten ihr ab und zu Verluste bei und beeinträchtigten natürlich die Ordnung im Marsche. Diese Plänkeleien setzten sich am nächsten Tage und in der darauf folgenden Nacht fort.
Wie das Terrain im Süden beschaffen, ist bereits geschildert worden; jetzt, infolge des Eintritts der Regenzeit, waren die Wege total ungangbar geworden. Da außerdem die Makanda vor den Wahiyao geflüchtet und die Dörfer derselben alle ausgeplündert waren, konnte eine genügende Verproviantierung der Truppe nicht bewerkstelligt werden. Die Kompagnien, welche mit Salven gegen die den Busch besetzt haltenden Feinde feuerten, verbrauchten einen übermäßigen Munitionsvorrat, und die Gefahr lag nahe, daß, wenn es der Expedition wirklich gelänge, die Yao-Truppen Maschemba's zurückzuschlagen und in das Dorf einzudringen, sie schließlich ihren ganzen Munitionsvorrat aufgebraucht haben und somit den Yaos gegenüber wehrlos sein würden. Ramsay beschloß daher sehr richtig, die gesamten disponiblen Truppen der Küste,[S. 241] eben jene vier Kompagnien, nicht dem Zufall eines Tages, dessen Chancen noch bedeutend auf die Seite der Wahiyao hinneigten, auszusetzen, sondern nach der Küste zurückzukehren. Die Verluste der Expedition an Toten und Verwundeten betrugen ein weißer Unteroffizier und zehn Farbige, eine im Vergleich zur Ungunst der Verhältnisse zwar geringe Ziffer, doch immerhin genügend, um den Rückmarsch der Expedition nach Lindi bedeutend zu erschweren. Eine Truppe, welche Verwundete mit sich führt und hierfür keine besonderen Träger zur Disposition hat, sondern Soldaten verwenden muß, ist in Afrika stets recht unbeweglich. Die Marschkolonne wird in die Länge gezogen und kommt dadurch aus der Hand des Führers.
Die Truppen Maschembas drangen der zurückmarschierenden Expedition eine Zeit lang nach und folgten ihr bis an den Ukeredifluß. Dies ungestüme Nachdringen der Wahiyao, die fortwährend von ihnen auf die Expedition unternommenen Angriffe, ihr zur Schau getragener Übermut endlich hatten die Befürchtung erregt, daß dem Expeditionskorps eine ziemlich empfindliche Niederlage beigebracht worden sei, und daß der Übermut und die Frechheit der Wahiyaos im Hinterlande noch bedeutend größer werden, die Sicherheit der Wege noch mehr gefährdet würde. Glücklicher Weise war diese Befürchtung unbegründet, da auch die Wahiyao in den verschiedenen Stadien des Feuergefechtes in jenen Tagen recht bedeutende Verluste erlitten hatten. Die Beschaffenheit des Terrains, die Schwierigkeiten der Situation brachten es mit sich, daß die Führer der einzelnen Kompagnien (es waren dies die Herren Lieutenants von Zitzewitz, von dem Knesebeck, Prince und Freiherr von Pechmann), sowie auch die als Unterführer fungierenden Unteroffiziere selbständig gegen die teils vom Rücken, teils von den Flanken aus angreifenden Gegner operieren mußten, was auch in umsichtiger und geschickter Weise von allen Seiten geschehen ist. In Folge der erlittenen Verluste und in der sehr begründeten Besorgnis, daß eine abermalige Expedition gegen ihn unternommen werden könnte, trat Maschemba im März 1891 in Friedensverhandlungen mit dem Chef der Station Mikindani, Lieutenant End, ein,[S. 242] der ihm ja durch unsern gemeinsamen Besuch in seinem Dorfe persönlich bekannt war.
Von der Ansicht ausgehend, daß es in unserm Interesse liegen müsse, unter den bestehenden schwierigen Verhältnissen lieber den gütlichen, von Maschemba vorgeschlagenen Weg zu benutzen, erklärte sich Chef End bereit, auf Verhandlungen mit Maschemba einzugehen, um so mehr, als von einem Frieden mit Maschemba die Erschließung des Nyassa-Gebietes und die Sicherung der Karawanenstraße abhing. Selbstverständlich machte End seine Bedingungen. Dieselben bestanden besonders darin, daß Maschemba während einer persönlichen Zusammenkunft mit End Geiseln zu stellen habe, die während der Abwesenheit Ends von Mikindani daselbst untergebracht werden sollten.
Unmittelbar vor dem Abmarsche wurde End vom Wali die Nachricht überbracht, die Geiseln seien aus Besorgnis, daß ihnen etwas passieren könne, ausgerückt; aber trotzdem marschierte End mit nur 50 Mann ab, denn er mußte befürchten, daß die Leute die abenteuerlichsten Gerüchte verbreiten und so die Friedensverhandlungen stören würden.
Durch mit Briefen vorausgeschickte Boten wurde alles geregelt: End durfte hoffen, daß es ihm gelingen würde, den Frieden in der Form, wie er es wünschte, herbeizuführen. Aber noch einmal sollte die Sache ins Schwanken kommen. An dem Tage, an welchem die Zusammenkunft stattfand, kam der Sohn von Maschemba mit der Mitteilung, von Lindi sei die Nachricht eingetroffen, daß der Friede nicht gewünscht werde, sondern daß man den Kriegszustand aufrecht erhalten wolle, eine jener Nachrichten, wie sie irrtümlich so oft in Afrika entstehen.
Um auch das letzte Mißtrauen zu beseitigen, that End einen sehr gewagten Schritt. Er ging allein mit seinem Diener dem Maschemba eine Stunde weit entgegen, wobei er sich sagen mußte, daß, da wir bisher noch keine Proben von der Zuverlässigkeit des Häuptlings erfahren hatten, sein Leben recht gefährdet war.
Aber das im Interesse der Sache unternommene Wagnis gelang und in der That wurde ihm dieses Entgegenkommen[S. 243] von Maschemba und seinen Leuten sehr hoch angerechnet. Es trug ganz besonders dazu bei, daß die von uns gestellten Friedens-Bedingungen bei dem darauf folgenden Schauri sämtlich angenommen wurden. Der folgende von End in der Suaheli-, wie in deutscher Sprache aufgesetzte Vertrag wurde von Maschemba unterzeichnet:
»Ich, Maschemba, Häuptling der Wahiyao um Luagalla und Umgebung verpflichte mich:
1. Ich werde niemals wieder gegen die Deutschen und die ihnen befreundeten Dörfer und Leute Krieg führen.
2. Alle Europäer mit und ohne Soldaten können ohne Gefahr mein Gebiet passieren.
3. Karawanen, vom Innern oder von der Küste kommend, passieren, ohne Hongo (Durchgangszoll) zu entrichten.
4. Die in meinem Besitz befindlichen Hinterlader liefere ich an die Station Mikindani ab.
5. Alle übrigen Gewehre bringe ich zur Stempelung nach Mikindani.
6. Von jetzt ab werde ich alle entlaufenen und bei mir Schutz suchenden Sklaven der Station Mikindani ausliefern, ebenso die von mir in der letzten Zeit ergriffenen Boys und Träger.
7. Ich werde allen Befehlen des Stationschefs von dort Folge leisten.
8. Ich werde auch meinen Leuten diese Bedingungen mitteilen und dafür sorgen, daß dieselben genau eingehalten werden.«
Hiermit war der Friede geschlossen. End und Maschemba schüttelten sich gegenseitig die Hand, und jeder marschierte ruhig nach Hause. Die nächste Zeit hat gelehrt, daß die Abschließung jenes Friedens von großem Nutzen für uns gewesen ist. Wir wurden der Notwendigkeit enthoben, im Süden eine große Macht aufzuwenden und konnten dieselbe gerade im letztvergangenen Jahre an anderer Stelle einsetzen.
Es hat sich der Handels-Verkehr im Süden gehoben und ist dort bislang die in so vielen andern Gegenden unseres[S. 244] Schutzgebietes bedrohte Ruhe aufrecht erhalten worden, ein Verdienst, das ohne Zweifel auf das politische Verhalten des Chefs End, der, von einem perniziösen Fieber kaum genesen, jene Expedition antrat, zurückzuführen ist.
Bis zum April 1891 waren auch die Stationen des Südens, Kilwa, Lindi und Mikindani im großen und ganzen fertiggestellt worden. Die Station Lindi hatte der frühere Chef der Verwaltungsabteilung Frhr. von Eberstein übernommen. —
Im Norden unserer Interessen-Sphäre wurde noch in den letzten Monaten der Thätigkeit des Reichskommissars das Einschreiten desselben notwendig, um die stark gefährdete Sicherheit auf der von Pangani nach dem Kilimandscharo und von dort aus nach dem Viktoriasee weiterführenden Karawanenstraße wieder herzustellen.
Der Häuptling Sinna von Kiboscho hatte in seinem Dorfe die deutsche Flagge niedergeholt, beschimpft und sich ausdrücklich geweigert, die deutsche Herrschaft anzuerkennen. Wir waren von diesem Vorgange unter anderm durch die englische Regierung von Taveta aus unterrichtet worden. Die Post des Wißmannschen Agenten in Moschi, Herrn von Eltz, war zwei Mal vom Häuptling Manamate abgefangen worden. Der Jumbe Kihungwe von Kihogwe hatte in der gröbsten Weise sich gegen den Stationschef von Masinde, Lieutenant Stenzler, vergangen, das deutsche Ansehen im Hinterland von Pangani und Tanga erschien schwer geschädigt.
So sah sich der Reichskommissar zur Unternehmung einer Expedition von Pangani aus nach dem Kilimandscharo veranlaßt. Die Expeditionstruppen wurden in Pangani vereinigt, wobei leider bei der Ausschiffung derselben und der Passage über die Barre des Panganiflusses nach dem Kentern eines Bootes der deutsche Unteroffizier Löppki mit 5 Sudanesen ertrank.
Der Marsch ging von Pangani zunächst nach Masinde. Hier wurde die Expedition, nachdem noch aus dieser Station einige disponible Truppen herausgezogen waren, definitiv zusammengestellt, und zwar zählte das unter den Befehl des Chef Johannes gestellte, aus einer Sudanesen-Compagnie und[S. 245] zwei Zulukompagnien bestehende Expeditionskorps 380 Mann. Außer Major von Wißmann, seinem Adjutanten Dr. Bumiller, Lieutenant Heymons und dem Führer des Expeditionskorps Chef Johannes nahmen folgende Offiziere an der Expedition teil: Lieutenants Sulzer, v. Zitzewitz, Prince, Assistenzarzt Dr. Steuber, Proviantmeister de la Frémoire und 7 deutsche Unteroffiziere.
Kurz vor dem Abmarsch der Expedition von Masinde traf noch Herr v. Eltz, der Wißmannsche Agent vom Kilimandscharo, dem erhaltenen Befehle gemäß ein, berichtete über die Verhältnisse daselbst und erhielt den Befehl, an der Expedition teilzunehmen.
Das nächste Ziel war das Dorf des aufsässigen Kihungwe, das nach Passierung des 30 Meter breiten Mkomasiflusses erreicht wurde. Sogleich bei der Ankunft der Karawane am Fluß hatte Kihungwe durch Abgesandte seine unbedingte Unterwerfung unter den Reichskommissar und den Stationschef von Masinde ankündigen lassen. Nachdem beim Dorfe Kihungwe ein Lager bezogen war, wurde der genannte Häuptling zum Schauri berufen. Wißmann sah von einer Bestrafung des Häuptlings, der von jetzt an völlige Unterwerfung versprach, ab und setzte nur in jener Ortschaft einen neuen Akida, einen Sohn des durchaus gehorsamen Simbodja ein.
Die Erledigung dieser Angelegenheit hatte die Expedition zu einer Abweichung von dem gewöhnlichen Karawanenwege veranlaßt, und wählte Wißmann nunmehr den Weg längs des Ostabhanges des Pare-Gebirges über Ndungu, Gonja, Kissiwani und von dort quer über das Hochplateau des Pare-Gebirges über Kisingo nach Pare Mabua; von hier aus wurde das hohe Ugweno-Gebirge überschritten, und gelangte die Truppe alsdann wieder auf die alte Karawanenstraße von Pangani nach dem Kilimandscharo.
Bis Kissiwani hatte die Expedition kaum mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Gegend wasserreich und leidlich bebaut, die Bewohner friedlich und entgegenkommend waren. In Kissiwani wurde am 27. Januar der Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers von den deutschen sowohl wie von den farbigen Soldaten gefeiert. Nachdem die Truppe durch das Entgegenkommen[S. 246] des Häuptlings von Kissiwani auf drei Tage sich verproviantiert hatte, wurde am 28. Januar der Marsch über das Gebirgs-Plateau fortgesetzt. Großer Wassermangel und die völlig unbewohnte Gegend machten die Märsche recht beschwerlich. Am 30. Januar wurde der Jipe-See erreicht, dessen Gestade sich ebenso wie das eben durchquerte Hochplateau durch großen Wildreichtum auszeichnen. An diesem Tage stieß die Truppe unvermutet auf Massai, welche den Schrecken der dortigen Bevölkerung bilden.
Beim ersten Begegnen mit der imponierenden, militärischen Expedition zogen sich die Massai in eiliger Flucht zurück, bald aber kamen sie in das bei Pare Mabua belegene Lager, wurden immer zutraulicher und schließlich sogar so unverschämt, daß sie das Verlangen stellten, die Truppe möge den Lagerplatz räumen, damit sie dort ihr Vieh tränken könnten; andernfalls würden sie Gewalt anwenden.
Als Erwiderung darauf ließ Wißmann in der Nähe weidende Rinderherden der Massai in das Lager treiben und erklärte ihnen, dies sei die Strafe für ihre Ungehörigkeit. Dieses entschiedene Benehmen verfehlte seine Wirkung nicht. Die Massai, welche an dieser Stelle allerdings über kaum 150 Krieger verfügten, legten sich nunmehr aufs Unterhandeln und erlangten auch durch ihre Bitten die Rückgabe ihres Viehes bis auf wenige Ochsen und Ziegen, welche der Truppe für den eigenen Gebrauch zugewiesen waren.
Am 31. Januar und 1. Februar überschritt die Expedition das sehr steile und äußerst beschwerliche Ugweno-Gebirge. Der Aufstieg wurde bedeutend dadurch erschwert, daß Alles, selbst die Geschütze und schwersten Lasten, die steilen Pfade hinaufgetragen werden mußte.
Der Hinabmarsch zur Pangani-Ebene ging naturgemäß leichter von statten. Nach dreitägigem Marsche durch die wildreiche Pangani-Ebene und nach Überschreiten des dort schon ziemlich wasserreichen Pangani-Flusses gelangte die Expedition am 3. Februar nach Aruscha Tschini. Die Bewohner dieses Gebietes, welches in dem vom Ronga-, Weriweri- und Pangani-Flusse gebildeten Dreieck liegt, hatten sich vor nicht langer Zeit an einem Überfall beteiligt, den die Leute von Aruscha ju[S. 247] gegen die Wapare unternommen hatten. Wißmanns Agent, Herr von Eltz, hatte ihnen Bestrafung in Aussicht gestellt. Auf den Befehl Wißmanns wurden daher zwei Waruscha, die sich zur Begrüßung im Lager eingefunden hatten, als Geiseln zurückbehalten und als Sühne eine Strafzahlung in Vieh und die Herausgabe der bei dem Raubzuge gemachten Gefangenen gefordert. Doch schien eine Lösung der Frage auf friedlichem Wege kaum möglich zu sein.
Die durch die jungen Waruscha vertretene Kriegspartei stimmte die ganze Nacht ihr Kriegsgeheul an und verweigerte jegliches Eingehen auf die Forderungen. Erst auf die nochmaligen Vorstellungen Wißmanns überwog nach langwierigen Schauris die Friedenspartei der Waruscha, und sie erklärten sich bereit, die gestellten Bedingungen zu erfüllen. Das Abkommen wurde dadurch bekräftigt, daß die Ältesten der Waruscha mit zwei der deutschen Offiziere Blutsfreundschaft schlossen.
Sodann wurde der Marsch nach Moschi, dem Wohnsitz des deutschfreundlichen Sultans Mandara fortgesetzt. Auf dem Moschiberge hatte von Eltz bereits die ersten Vorbereitungen zur Anlage einer festen Station getroffen. Nach einem Ruhetage wurde dieselbe unter Heranziehung der vielen Träger so stark befestigt, daß sie selbst von einer geringen Besatzung zu halten war.
Gelegentlich eines Besuches des Majors von Wißmann beim Sultan Mandara wurde der schon lange geplante Kriegszug gegen Sultan Sinna von Kiboscho vorbereitet. Derselbe hatte, wie bereits erwähnt, die deutsche Flagge heruntergerissen und führte an deren Stelle jetzt die rote Flagge des Sultans von Sansibar. Zunächst befahl Wißmann dem Sultan Mandara, einen Teil seiner Wadschaggakrieger zu dem bevorstehenden Kriegszuge zu stellen, weniger in der Absicht, daß sie thätig am Kampfe teilnehmen sollten, als um sie nach erfolgter Entscheidung zur Ausbeutung des Sieges zu verwenden.
Denn vermöge ihrer genauen Landeskenntnis konnten die Wadschagga mit Leichtigkeit dem fliehenden Gegner folgen und das in dortiger Gegend sehr zahlreiche Vieh zusammentreiben.
[S. 248]
Jeder der neuen Bundesgenossen erhielt, um ihn vom Feinde unterscheiden zu können, eine weiße Binde um den Oberarm, außerdem wurden sie angewiesen, auf etwaigen Anruf mit »Mandara« zu antworten. An die einzelnen Haufen wurden schwarz-weiß-rote Fahnen ausgegeben, jeder Haufen wurde von einem Führer befehligt. Das Kommando über jene Krieger wurde Herrn von Eltz übergeben, der sich durch die Führer mit den einzelnen Haufen verständigte.
Da Wißmann von vornherein beabsichtigte, nach erfolgter Niederwerfung Sinnas wieder nach Moschi zurückzukehren, wurde die mitzunehmende Bagage auf das mindeste Maß beschränkt. Außer wenigen Lasten für Proviant gingen nur noch Träger für die Geschütze und die Artilleriemunition mit.
Am 11. Februar 1891, nachmittags 2 Uhr, marschierten die Truppen, 300 Mann stark, von Moschi ab und bezogen abends um 6 Uhr an einem kleinen Flusse Lager im Walde. Die Nachrichten, welche hier über des Feindes Stärke und Stellung eingingen, waren, wie sich später herausstellte, teilweise unrichtig. Seine Stärke, die man auf 600 bis 800 Mann angab, entsprach zwar den thatsächlichen Verhältnissen, auch daß der Gegner fast durchgängig mit Gewehren, unter denen viele Hinterlader, bewaffnet sei, bestätigte sich. Hingegen war die Nachricht falsch, daß die Munition des Feindes sehr knapp bemessen und die von ihm angelegte Befestigung derart sei, daß sie nicht nur von den umliegenden Höhen eingesehen werden könnte, sondern daß auch der direkten Annäherung an dieselbe keine größeren Schwierigkeiten im Wege ständen. Gerade nach den letztgenannten Nachrichten konnte eigentlich niemand an ernsteren Widerstand denken.
Am 15. Februar 5 Uhr früh wurde in folgender Marschordnung aufgebrochen:
Vortrupp: 1. Sudanesenkompagnie, Artillerie;
Haupttrupp: 2. und 3. Sudanesenkompagnie, Sanitätsdetachement, Bagage mit Bedeckung.
Hinter der Bagage folgten die irregulären Haufen der Wadschagga.
Der Weg führte zunächst durch dichten Busch, der allmählich in schönen, hochstämmigen Wald überging. Dicht am[S. 249] Walde befanden sich zahlreiche, etwa 5 m tiefe und unten spitz zugehende Elephantengruben. Es erforderte die ganze Aufmerksamkeit der Führer, um diese sehr geschickt bedeckten Gruben aufzufinden und freizulegen, damit seitwärts vom Wege gehende Leute nicht in Gefahr kamen. Auf dem Wege waren ferner vom Feinde Beschwörungsmittel, sogenannte Daua, angebracht, meistens aus kleinen Erdhaufen bestehend, in welche Hölzchen oder Federn eingesteckt waren. Die abergläubischen Wadschagga machten immer große Seitensprünge, wenn sie an einer derartigen, verzauberten Daua anlangten, die schwarzen Soldaten indessen, an dergleichen schon von früher gewöhnt, schritten weniger rücksichtsvoll darüber hinweg.
Nach vierstündigem Marsche trat die Spitze der Kolonne aus dem Walde heraus und gelangte in die gut bebaute und bewässerte Landschaft Kiboscho. Das Gelände ist daselbst außerordentlich coupiert und bedeckt. Ein schmaler Bergrücken folgt dem andern. Der größte Teil derselben ist mit Bananen bewachsen. Da diese sehr eng zusammenstehen und von halber Höhe an mit üppigem Blätterwuchs geschmückt sind, verschließt ein derartiger Wald jegliche Übersicht, erschwert das Vorwärtskommen und bietet dem Gegner alle nur mögliche Deckung.
Beim Ersteigen des ersten Bergrückens fiel ein Schuß in der rechten Flanke, wahrscheinlich ein Signalschuß, dann war wieder Alles ruhig. Noch zwei weitere Höhen wurden erklommen, als die Spitze an einem Punkte anlangte, welcher einen freien Ausblick nach der nächstgelegenen Anhöhe gewährte. Die letztere war ganz unbewachsen; auf dem Rücken derselben befanden sich tief eingeschnittene Gräben, aus welchen heraus alsbald vom Feinde ein ziemlich lebhaftes Feuer eröffnet wurde.
Offenbar handelte es sich hier jedoch nur um eine vorgeschobene Stellung, denn der Gegner räumte dieselbe, als von der vorn befindlichen Sudanesen-Kompagnie jenes im übrigen wirkungslose Feuer mit einigen Salven erwidert war.
Der Vormarsch wurde fortgesetzt. Als der soeben vom Feinde verlassene Berg erreicht war, hatte man abermals einen Höhenrücken vor sich, welcher, von beträchtlicherer Höhe als die zuletzt passierten, mit dichtem Bananenwalde bestanden war.[S. 250] Von dort aus war das Kriegsgeheul einer zahlreichen Menschenmenge deutlich hörbar, auch konnte man aus den Baumspitzen heraus einen Signalmast mit roter Fahne erkennen. Major v. Wißmann schloß aus diesen Anzeichen, daß dort der Hauptwiderstand des Gegners zu suchen wäre, wenngleich man von der angekündigten und beschriebenen Verteidigungsboma nichts erblicken konnte.
Nachdem die Truppen sich hinter der Anhöhe gesammelt hatten, gab Wißmann seinen Gefechtsbefehl derart, daß auf die vorliegende feindliche Stellung ein direkter Vorstoß in zwei Kolonnen gemacht werden sollte.
Rechter Flügel: 1. Sudanesenkompagnie, Artillerie; 2. Zulukompagnie.
Linker Flügel: 3. Zulukompagnie.
Die Bagage erhielt Befehl, auf dem rückwärts gelegenen Bergrücken zu halten, woselbst sich auch die Wadschaggakrieger sammeln sollten; das Sanitätsdetachement folgte der vorrückenden Truppe. Beide Kolonnen traten gleichzeitig den Vormarsch an.
Mit vorgenommenen Schützenlinien wurden die Truppen die steile Schlucht hinuntergeführt und klommen an der andern Seite durch den Bananenwald wieder herauf. Hier empfing sie ein heftiges Feuer des Gegners aus ziemlicher Nähe. Die ersten Verluste waren zu verzeichnen.
Nach Ersteigen der halben Anhöhe gelangten die beiden Kolonnen an die bis dahin dem Auge völlig entzogene Boma des Feindes. Die letztere war umgeben von einem 3 m breiten und 5 m tiefen Graben, an dessen jenseitigem Rande sich eine starke Pallisadenwand erhob. Der innere Teil der Boma bot ein so vollkommenes Gewirr von Gräben, Pallisaden, Hecken, verrammelten Thoren, Fallgruben und sonstigen Hindernissen, daß eine Orientierung in diesem Labyrinth für einen Fremden völlig unmöglich war. An der Herstellung und Vollendung der gedachten Verteidigungsanlagen müssen die Kiboscholeute schon Jahrzehnte gearbeitet haben. Die Befestigungen waren nicht nach einem bestimmten Plane angelegt, sondern sichtbar allmählich entstanden. Jedenfalls boten dieselben ein ernstes Hindernis.
[S. 251]
Es war erklärlich, daß bei dem Eindringen in die Boma die Verbindung der beiden Kolonnen verloren ging; dieselben vereinigten sich erst wieder im späteren Verlaufe des Gefechtes.
Auf dem rechten Flügel, den Major v. Wißmann in Person befehligte, waren die vorn befindlichen Sudanesen zuerst in die Boma eingedrungen; die große Ausdehnung der Befestigungsanlagen machte es bald nötig, auch die zweite Zulukompagnie in das vordere Treffen hineinzuziehen. Die rechte Flügelkolonne tastete, dem zerstreut fechtenden Gegner folgend, um den äußeren Rand der ganzen Boma herum, bis sie ungefähr den östlichsten Teil — der Anmarsch geschah von Westen nach Osten — erreicht hatte. Der sich entgegenstellende Feind, welcher häufig auf 20 bis 30 Schritte von irgend einer Hecke her sein Feuer abgab, wurde an allen Punkten zurückgeworfen, nirgends wurde noch einheitlicher Widerstand geleistet.
Major v. Wißmann sammelte daher an diesem Platze die Truppen der rechten Kolonne und gab Befehl, auf das hörbare Salvenfeuer der linken Flügelkolonne hin zu marschieren. Eine Orientierung nach Sicht war vollständig ausgeschlossen, denn auch die mit Pallisaden umschlossenen, zahlreichen inneren Höfe der Boma waren dicht mit Bananen bestanden.
Die Vereinigung mit dem linken Flügel gelang glücklich, denn um 11 Uhr 30 Minuten vormittags langte Wißmann unter fortwährenden Gefechten mit der Tête seiner Abteilung auf einem freien Platze innerhalb der Boma an, den kurz vorher die 3. Zulukompagnie erreicht hatte. Diese Kompagnie, ursprünglich auf dem linken Flügel befindlich, war ebenfalls auf die Boma gestoßen und zwar auf einen ganz besonders stark befestigten und verbarrikadierten Teil derselben. Auch hier hatte sich überall der Feind dem weiteren Vordringen entgegengestellt, und konnte aus der Heftigkeit des geleisteten Widerstandes geschlossen werden, daß hier die Hauptverteidigung der Boma zu suchen wäre. Dieser erste Abschnitt des Gefechtes, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, wo sich beide Abteilungen auf dem freien Platze trafen, hatte etwa zwei Stunden gedauert.
Die eingetretene Gefechtspause wurde zum Verbinden der Verwundeten benutzt, die der vorrückenden Truppe nachgetragen[S. 252] werden mußten, da sie sonst unfehlbar in die Hände der erbitterten Gegner gefallen wären. Bis jetzt stellte sich deutscherseits der Verlust auf zwei Tote und elf Verwundete, unter letzteren auch zwei Europäer, Feldwebel Nowack und Unteroffizier Witte. Der gegnerische Verlust ließ sich zur Zeit auch noch nicht annähernd feststellen.
Bald wurde vom Feinde, dem das Zeugnis einer beharrlichen Tapferkeit und Kühnheit ausgestellt werden muß, das Gefecht wieder aufgenommen. Das aus nächster Nähe von mehreren Seiten abgegebene Feuer bedingte, den ungedeckten freien Platz zu verlassen und entweder das Gefecht für heute abzubrechen, oder aber die Hauptbefestigung, die bisher noch völlig unbetreten war, zu stürmen.
Wenn von Wißmann sich für den Abbruch des Gefechtes und Fortsetzung desselben am nächsten Tage entschied, so war für seine Erwägungen weniger die Rücksicht auf die schon stark ermatteten Truppen, als der Umstand maßgebend, daß die Wadschagga-Krieger zu einer späteren Verfolgung des Feindes nicht zur Hand waren. Nachdem von der Artillerie noch einige Granaten aus dem 4,7 cm Schnellfeuergeschütz in die Befestigung hineingeschleudert waren, wurde der Rückzug nach der vorher geschilderten Anhöhe angetreten.
Der Rückmarsch ging auf demselben Wege von statten, den die 3. Zulukompagnie beim Eindringen in die Boma genommen hatte. Große Schwierigkeiten machte der Transport der Verwundeten und Toten, sowie das Tragen der beiden Geschütze.
Nach Ankunft auf der freigelegenen Höhe befahl Wißmann die Besetzung der dort befindlichen Schützengräben. Die drei Kompagnien lagen nebeneinander, Sudanesen auf dem rechten, 3. Zulukompagnie auf dem linken Flügel. In der Mitte waren die beiden Geschütze in Stellung gegangen, weiter hinter der Front hatte der Arzt seinen Verbandplatz angelegt.
Schon die Arrieregarde wurde bei ihrem Abzug vom Feinde bedrängt. Um 1 Uhr nachmittags ging er seinerseits zum Angriff gegen die von den Deutschen genommene Stellung vor. Ein weiteres Vordringen wurde ihm jedoch alsbald durch die massenhaften Verluste verwehrt, die die Kiboscholeute durch das in Thätigkeit gesetzte Maxim-Gun erlitten.
[S. 253]
Ferner traf Wißmann die Anordnung, daß sämtliche Europäer ein wohlgezieltes Schützenfeuer unterhalten sollten, während dessen die schwarzen Soldaten mit Gewehr im Arm im Graben ruhten.
Bis etwa 4 Uhr nachmittags dauerte das gegenseitige Schützengefecht, welches den Kiboscholeuten die empfindlichsten Verluste beigebracht hat. Die relative Ruhe, die dann eintrat, wurde gegnerischerseits nur durch einige Wagehälse gestört, die sich an die deutsche Stellung heranschlichen, ihre Gewehre losknallten und ebenso schnell, wie sie gekommen waren, wieder verschwanden.
In der Nacht blieben sämtliche Truppen ausgeschwärmt in den Gräben liegen; einzeln liegende Posten waren noch 50 Schritt vorgeschoben. Um 12 Uhr wurde noch einmal das Maximgeschütz abgeschossen, was ein großes Wutgeheul bei den Kiboscho-, Freudengesänge bei den am jenseitigen Bergabhange lagernden Wadschagga-Kriegern hervorrief. An Ruhe und Schlaf war kaum zu denken.
Am 13. Februar früh 5 Uhr bereits gab Wißmann seine Befehle für den Sturm auf die Boma. Ein vorgesandter Zug der Sudanesenkompagnie hatte erkundet, daß sich der ganze Feind wieder gesammelt habe und mit aller Energie an der Wiederherstellung der Verteidigungsanlagen arbeite.
Die Sturmkolonne bestand aus drei Zügen, deren spezieller Befehl dem Chef Johannes übertragen wurde. Dieser ging beim Eindringen in die noch besetzt gefundene Boma ganz systematisch zu Werke. Während zwei Züge den Feind unter beständigem Salvenfeuer hielten, mußte der dritte Zug das soeben passierte Hindernis völlig um- und freilegen, so daß ein geräumiger und breiter Weg geschaffen wurde. Alsdann erst wurde das nächste Hindernis genommen. Schritt für Schritt gelangte die Kolonne an die Hauptbefestigung, an welcher noch einmal zäherer Widerstand geleistet wurde. Mit kühnem Anlauf wurde auch diese genommen, und drangen die Truppen nunmehr unaufhaltsam in alle Häuser ein, speziell in diejenigen, welche vom Sultan Sinna bewohnt waren. Mit dem Verluste dieses Teils der Boma war das Schicksal des Tages entschieden.
[S. 254]
Sobald die rote Flagge auf dem Signalmast niedergeholt war und Rauchwolken aus dem Innern die Einnahme jener Befestigung verkündigten, zogen die Kiboscho in eiliger Flucht nordwestlich in die Berge. Jetzt bekamen auch die Wadschagga plötzlich großen Mut; sie stürzten sich in hellen Haufen in die Boma, ein anderer Teil unternahm die Verfolgung des fliehenden Gegners. Die Sinnaleute hatten an beiden Tagen mit Erbitterung und großer Tapferkeit gefochten, viele Leichen bedeckten den Boden. Vermöge ihrer guten Bewaffnung und der reichlichen Munition waren sie im Stande, in ihrer vorzüglichen Befestigung bislang alle Angriffe ihrer Gegner blutig abzuweisen. Sinnas Boma galt allgemein, wie man jetzt von den Wadschagga hörte, als unüberwindlich. Um so größer war natürlich auch die Freude über den errungenen Sieg, der allerdings mit verhältnismäßig schweren Opfern erkämpft war. Außer den oben angegebenen Verlusten waren noch 1 Toter und 6 Verwundete zu beklagen; in Summa 3 Tote und 17 Verwundete. Der Verlust beim Feinde belief sich allein auf 200 Tote.
Außerordentlich reich war die von den Wadschagga gemachte Beute. Etwa 4000 Ochsen und 5000 Stück Kleinvieh wurden zusammengetrieben, ferner gelangte eine Anzahl Speere und Schilde, Munition und Gewehre zur Verteilung. Das Vieh wurde sofort auf verschiedenen Wegen in die Landschaft Dschagga fortgetrieben, die Truppe blieb noch bis 11 Uhr vormittags in ihrer Stellung und trat dann ebenfalls den Rückmarsch auf Moschi an. Die aus der Sudanesenkompagnie bestehende Arriere-Garde hatte noch ein unbedeutendes Gefecht mit versprengten Kiboscho, sonst wurde der Rückmarsch, insbesondere der große Viehtransport, in keiner Weise gestört. Am 14. Februar morgens kam die Truppe wieder in Moschi an, empfangen von einer Gesandtschaft Mandaras, der seiner und der Wadschagga Freude über den errungenen Sieg Ausdruck gab.
Die nächsten Tage in Moschi galten den Befestigungsarbeiten in der Station und der Fürsorge für die Verwundeten. Von diesen erlag nur ein Mann seinen Wunden, gewiß unter den außerordentlich schwierigen Umständen und bei den geringen zu Gebote stehenden Mitteln ein Beweis für die fachgemäße und opferwillige Krankenpflege.
[S. 255]
Alsbald wurden an den überwundenen Sinna Boten abgesandt, welche die Nachricht zurückbrachten, daß Sinna sich nunmehr endgültig unterwerfen wolle und zu allen Bedingungen bereit sei; zugleich schickte er als Zeichen seiner Ergebenheit einen 105 Pfund schweren Elfenbeinzahn. Wißmann zeigte sich geneigt, die Bitte um Frieden zu erfüllen. Sinna mußte einen Teil seines Gebietes an früher von ihm vertriebene Häuptlinge abtreten und seinen Gehorsam der deutschen Verwaltung geloben. Daraufhin wurden ihm die Gefangenen ausgeliefert und das Recht zur Führung der deutschen Flagge erteilt.
Blitzschnell verbreitete sich die Nachricht von diesem Siege der Deutschen nach allen Seiten hin, und die umliegenden Stämme sandten Gesandte, um dem Reichskommissar ihre Ergebenheit zu bezeugen. Auch mit den Waruscha, die ihren Wohnsitz am Meru-Berge hatten, suchte Wißmann auf friedlichem Wege eine Einigung zu Stande zu bringen, indem er ihnen für ihre Räubereien eine Strafzahlung in Elfenbein und Rindvieh auferlegte.
Am 19. Februar gelangten Nachrichten über Übergriffe der Massai an den Reichskommissar nach Moschi. Es handelte sich um eine Expedition eines Baron von Langenn, welcher mit Genehmigung des Reichskommissars nach dem Kilimandscharo wollte. In Kissiwani angekommen, hatte er gehört, daß die Massai gedroht hätten, sich für die ihnen von den Deutschen zugefügte Unbill rächen zu wollen. Infolgedessen zog sich Herr von Langenn nach Masinde zurück und bat von hier aus den Reichskommissar um Hülfe. Da dieser indes nicht in der Lage war, dem Ansuchen durch Abtrennung einer größeren Truppenabteilung von seiner Macht zu entsprechen, mußte Herr von Langenn auf die baldige Rückkehr des Reichskommissars vertröstet werden.
Erst am 26. Februar konnte nach Abschluß der Befestigungsarbeiten und der Verhandlungen mit den umwohnenden Häuptlingen der Rückmarsch angetreten werden und zwar über Aruscha Tschini, den Pangani entlang nach Manamates Dorf am Pare-Gebirge. Am 4. März gedachte sich Wißmann hier mit dem Stationschef von Masinde, der den Befehl erhalten[S. 256] hatte, sich an diesem Tage mit seinen Truppen hier einzufinden, zu vereinigen. Den etwa vorüberziehenden Massai-Horden sollte mit Schonung und Rucksicht gegenüber getreten werden, bis durch offenbare Feindseligkeiten eine friedliche Lösung ausgeschlossen erschien.
Aruscha Tschini wurde am 28. Februar erreicht. Die guten Früchte der damals von Major von Wißmann an den Tag gelegten Friedensliebe blieben nicht aus; die Verproviantierung der Truppe, die auf drei volle Tage nötig wurde, stieß nicht im geringsten auf Schwierigkeiten. Die Waruscha kam allen an sie herantretenden Forderungen bereitwilligst entgegen.
Am 1. März marschierte Wißmann von Aruscha Tschini ab und überschritt bald darauf den Pangani. Der weitere Weg führte durch nackte, öde Salzsteppe; bis zu Manamates Wohnsitz war auf weitere Lebensmittel nicht zu rechnen. Die Marschzeiten wurden infolgedessen vergrößert, 3 Tage lang vor- und nachmittags marschiert. Die Expedition kreuzte hier eine nach dem Szogoni-Gebirge ziehende Massai-Horde, die man gemäß dem bereits erwähnten Befehl unbehelligt ziehen ließ.
Am 3. März abends traf die Expedition bei dem Häuptling Manamate ein und konnte sich hier endlich aufs neue verproviantieren. Für den folgenden Tag, der zum Ruhetag für die stark angestrengte Truppe bestimmt wurde, war der Stationschef von Masinde erwartet. Derselbe traf indessen nicht ein; gerüchtweise verlautete, daß die Massai den Weg nach Masinde versperrt hätten. Auch der Häuptling Manamate klagte über die Massai, daß sie die friedlichen Bewohner überfielen, ihnen ihr Vieh wegnähmen und die größten Grausamkeiten verübten.
Außerdem traf vom Stationschef von Masinde, der einer Erkrankung wegen den Marsch nicht hatte unternehmen können, die briefliche Nachricht ein, daß die Massai bis über Gonja vorgedrungen seien und ihm eine Kriegskeule als Zeichen der Kriegserklärung gesandt hätten. Infolgedessen beschloß Wißmann, von Masinde aus eine stärkere Abteilung nach Moschi zurückzusenden. Da ihn selbst dringende Geschäfte zur Rückkehr an die Küste, wo der neue Gouverneur bald eintreffen[S. 257] sollte, zwangen, übergab er das Kommando über 200 Mann dem Chef Johannes und befahl ihm, auf seinem Hin- und Rückmarsch die Massai überall anzugreifen und auf das nachdrücklichste zu züchtigen.
Chef Johannes traf auf dem Marsche über Gonja, Kissiwani und den Jipe-See nach Moschi noch einige Stämme der Massai. Er griff sie überall mit Erfolg an, und dadurch, daß er ihre Kraale zerstörte, ihre Herden fortnahm und viele der Massai-Krieger tödtete, zwang er sie endgültig jene Gegend zu verlassen und sich westlich über den Panganifluß zurückzuziehen, sodaß nunmehr die Sicherheit auf der wichtigen Karawanenstraße von Pangani nach dem Kilimandscharo wieder völlig hergestellt war.
Major von Wißmann zog von Masinde in Eilmärschen zur Küste und langte nach 4-1/2 Tagen am 13. März, also nach zweimonatlicher Abwesenheit, in Pangani an.
Die Expedition hatte auch den Erfolg, daß die Häuptlinge, welche bis dahin die deutsche Herrschaft nicht anerkannt, sondern verhöhnt hatten, die deutsche Macht nunmehr empfanden und sich dem Reichskommissar auf Gnade und Ungnade unterwarfen.
Bislang war von den meisten Reisenden der von Mombassa aus über Taveta ins Innere führende Weg als der sicherere gewählt worden, da die von Pangani ausgehende Straße meist von Massai-Horden gesperrt wurde. Die letztere Straße erreichte durch Wißmanns Zug annähernd dieselbe Sicherheit, wie die von Bagamoyo und Sadani ausgehenden Karawanenstraßen, da nunmehr auch hier die Jumbes die deutsche Flagge führten, teilweise auch in deutschem Solde und deutscher Abhängigkeit waren. —
Während Wißmann auf der Kilimandscharo-Expedition sich im Innern befand, drangen nach Bagamoyo an Chef Leue, der im Auftrage des Reichskommissars die Geschäfte während der Zeit der Expedition führte, beunruhigende Nachrichten von der Station Mpapua und Hülferufe von der französischen Missionsstation Longa und von den Wasagara des Mukondogua-Thales. Hier hatten die Wahehe wiederum einen Einfall gemacht, Dörfer zerstört, Eingeborene getötet oder als Sklaven weggeführt. Chef Leue raffte, was er an[S. 258] Truppen aus den Stationen der Küste noch irgend herausziehen konnte, zusammen und schickte unter dem Befehl des Chefs Ramsay eine Expedition nach der bedrohten Gegend aus. Bei der geringen Macht, die Ramsay zur Verfügung stand, mußte er es sich angelegen sein lassen, auf friedlichem Wege die Angelegenheit mit den Wahehe zu ordnen, und er hatte das Glück, daß bei seiner Ankunft in Kondoa die Wahehe ihm bereits Gesandtschaften entgegenschickten, ihre Unterwerfung anzeigten und sich bereit erklärten, die gemachten Gefangenen auszuliefern, außerdem eine ziemlich erhebliche Summe als Strafe in Rindvieh und Elfenbein zu zahlen. Ramsay gab den Wahehe auf, eine Gesandtschaft nach Bagamoyo zu schicken, um hier endgültig dem Reichskommissar ihre Unterwerfung anzuzeigen; er konnte nachdem für jetzt die Ordnung wieder hergestellt war, den Rückmarsch nach Bagamoyo antreten. Der Hoffnung, daß die Schwierigkeiten mit einem ausschließlich von Raub und Krieg lebenden Volke, wie den Wahehe, durch einen Vertrag ein für alle Mal beseitigt seien, konnte man sich allerdings nicht hingeben. Das konnte nur durch nachhaltigere Mittel und bedeutenden Kraftaufwand erreicht werden und mußte der nächsten Zeit vorbehalten bleiben.
Nach Wißmanns Ankunft an der Küste blieb diesem nur noch eine kurze Spanne Zeit, um die Übergabe der Geschäfte an den im Anfang April erwarteten Gouverneur von Soden vorzubereiten. Wir kommen auf die Übergabe des Gouvernements in einem der nächsten Kapitel zurück, führen aber hier bereits den folgenden Teil des Schlußberichtes des Majors v. Wißmann an, der geeignet ist, in gedrängter Form einen Überblick über das, was in den zwei Jahren seines Kommissoriums von Wißmann erreicht wurde, zu geben:
»Die ostafrikanische Küste ist zurückerobert und ihr Besitz derartig gesichert durch Anlage von Befestigungswerken und Kommunikationen, daß dieselbe mit einem im Verhältnis zur Größe des Landes äußerst geringen Truppenkontingent gegen alle Eventualitäten behauptet werden kann. Die großen Karawanenstraßen sind auf weite Strecken gesichert und unser Machteinfluß bis an die äußersten Grenzen unsers Gebietes ausgedehnt, dem deutschen Namen bis dorthin Achtung und[S. 259] Respekt verschafft worden. Im Norden ist das Hinterland von Tanga und Pangani bis zum Kilimandscharo hinauf als endgültig gesichert anzusehen. Die große Straße von Bagamoyo und Sadani aus ist bis Mpapua gesichert und eine weitere Sicherung in Uniamuesi von Emin Pascha und Stokes eingeleitet.
Nur in Ugogo, wo Handelskarawanen noch des Öfteren gefährdet werden, bleibt eine Lücke auszufüllen. Auch im Süden unserer Besitzung ist, seitdem Maschemba sich unterworfen hat, das nächste Hinterland beruhigt. Nur eine schwarze Truppe war der rastlosen kriegerischen Thätigkeit, wie sie sich hier entfalten mußte, gewachsen. Die im Verhältnis zu der gewaltigen Ausdehnung unseres Gebietes verschwindende Truppenstärke bedingte ein ununterbrochenes Hin- und Herziehen ohne Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse.
Diesem Umstande sind die meisten Verluste an europäischem Personal zuzuschreiben. Die von vornherein verfolgte Taktik, den Feind bei allen Gefechten durch einen kräftig eingeleiteten und schnell ausgeführten Angriff moralisch zu überwältigen, bewahrte die Truppen stets vor großen Verlusten im Gefechte selbst.
Immerhin sind die Verluste, wie vorher erwähnt hauptsächlich durch die Strapazen in dem Ungewohnten Klima, verhältnismäßig größer als bei einem europäischen Kriege. Der Gesamtverlust der Truppe im Gefecht (Tote und Verwundete) beträgt 21 Europäer und 151 Farbige, was bei Zugrundelegung einer Kombattantenstärke von 150 Europäern und 1200 Farbigen für erstere einen Verlust von 14, für letztere von 12-1/2 Prozent bedeutet. Die Verluste der Truppe an Toten überhaupt betragen 20 Europäer und 208 Farbige, was für eine Gesamtstärke von 200 Europäern und 1800 Farbigen (einschließlich der Nichtkombattanten) für erstere 10, für letztere 11-1/2 Prozent ausmacht.
Erst allmählich, nach Wiedergewinnung verschiedener Küstenpunkte, nach Vergrößerung des Sanitätspersonals, nach Durchführung der Impfung aller Truppen konnte die ärztliche Pflege der Truppe eine wirksamere werden, aber erst, nachdem die Unterkunftsräume ausgebaut und die Erdarbeiten, die eine[S. 260] Entwickelung des Malaria-Bazillus begünstigen, beendet waren, wurde der allgemeine Gesundheitszustand ein bedeutend besserer.
Gute Unterkunft schützte vor Malaria, Desinfektion und Maßnahmen zur Erlangung guten Trinkwassers vor Dyssenterie, Impfung vor Pockenerkrankungen, den drei die Gruppen am meisten gefährdenden Krankheiten. Jetzt, wo die kriegerischen Strapazen zum größten Teil überwunden sind, und durch die Fürsorge der Regierung das Sanitätspersonal für das kommende Jahr um das doppelte verstärkt ist, wird der Gesundheitszustand sich jedenfalls weiterhin bedeutend bessern.
Was die Erfolge der friedlichen Arbeit anbetrifft, so mußten die durch die militärische Thätigkeit auf Seiten der Eingeborenen entstandene Furcht und Scheu zunächst gehoben werden.
Strenge Gerechtigkeit und Wohlwollen von Seiten der Europäer der Schutztruppe, die unterdes mit den Sitten und Gewohnheiten der Inder, Araber und Neger mehr und mehr vertraut geworden waren, und strenge Überwachung der Unbestechlichkeit der farbigen Beamten erzeugten bald Vertrauen, wo früher Furcht gewaltet hatte. Das erste Zeichen von einem Gefühl der Sicherheit unter unserm Schutz war die massenhafte Rückkehr der während des Krieges Geflohenen und Ausgewanderten.
Während wir beim Beginn der Expedition in Bagamoyo täglich ungefähr ein Dutzend Leute verpflegten, die zu alt und krank gewesen wären, um mit den Anderen zu entfliehen, hat jetzt schon Bagamoyo mindestens seine alte Bevölkerungszahl wieder erreicht.
Es fällt jedem Fremden mit Erstaunen auf, wie jeder Europäer auf der Straße in unseren Küstenorten freundlich und vertraulich von überall begrüßt wird. Araber und Belutschen, Banianen, Hindus und Parsis, Goanesen, Suaheli-Sklaven und Karawanenleute aus dem Innern, griechische und Levantiner Händler, sogar Chinesen fühlen sich im lebhaft zurückgekehrten Handel und Verkehr sicher unter der deutschen Flagge. Der Druck des früher herrschenden Arabers, des seine Kapitalmacht mißbrauchenden Inders hat aufgehört. Die Erpressungen der bisherigen Walis, Kadis und Jumbes, die, da sie von ihrer Regierung unbesoldet blieben, sich selbst bezahlt[S. 261] machen mußten, sind einer unparteiischen und unbestechlichen Rechtspflege und Polizei gewichen. Der Sklave findet sein Recht wie der Herr. Durch möglichst seltenen Wechsel in den Stellen der Stationschefs wurde bei diesen das regste Interesse an dem Wachstum ihrer Stationen und Distrikte erzielt und damit manche Einrichtung zum Vorteil des Handels, zu hygienischen und Verschönerungszwecken.
Die Zerstörungen in manchen Küstenstädten in der ersten Periode des Aufstandes durch die Granaten der Marine erlaubten nachhaltiges Durchgreifen beim Wiederaufbau. Es wurden breite, gerade Straßen angelegt, Brücken und Wasserleitungen erbaut, Sümpfe trocken gelegt, Markthallen eingerichtet, Straßenbeleuchtung durchgeführt, offene Plätze freigehalten und durch Gartenanlagen verschönert, sowie durch entsprechende polizeiliche Aufsicht auf Ordnung, Reinlichkeit und Sicherheit hingewirkt. Für Unterkunft der Karawanen sind Karawansereien errichtet, und kürzlich ist der Grundstein für das erste Hospital für Eingeborene (unsere bisherigen Krankenhäuser und die schwarze Truppe eingerichtet) und die erste Schule für die Kinder der indischen Händler gelegt worden. Die bevorstehende Ankunft des letzten der drei Fahrzeuge der Küstenlinie wird hoffentlich recht bald ein allgemein erwünschtes regelmäßiges Anlaufen der Küstenplätze ermöglichen und ebenso ist zu hoffen, daß den Vorarbeiten für die Eisenbahnen die Vollendung bald folgen möchte.
Die allgemeine Wiederaufnahme des Feldbaues seit dem Wiedereintritt der friedlichen Verhältnisse, das Wiederaufblühen des Karawanenhandels nach erfolgter Sicherung der Straßen und jede nur mögliche Maßnahme zur Förderung des Handels müssen eine allmähliche Abnahme der unserer neuen Kolonie gebrachten Opfer bringen, müssen, wenn wir nachhaltig weiter arbeiten an dem Schaffen neuer wertvoller Exportprodukte durch Plantagenbau, auch mit der Zeit für unsere Opfer Zinsen tragen. Jeder Europäer, der während des Aufstandes unsere Küste gesehen hat und sie jetzt nach nur zweijähriger Arbeit wiedersieht, muß die Überzeugung gewinnen, daß diese Schlüsse nicht optimistisch sind, sondern das Resultat sachlicher Beobachtung.
[S. 262]
Schon vor der Ankunft Wißmanns in Deutschland, nach Einnahme des südlichen Teils unserer deutsch-ostafrikanischen Küste, waren die Verhandlungen zwischen der deutschen und englischen Regierung über die Verteilung Afrikas in ein Stadium getreten, in welchem über alle wichtigen Punkte Einverständnis erzielt werden war. Am 17. Juni veröffentlichte der Reichs-Anzeiger in einer Extra-Ausgabe die Grundzüge des deutsch-englischen Abkommens, auf welche in allernächster Zeit der formelle Abschluß des Vertrages fußen sollte. Wißmann stand bei seiner unmittelbar darauf erfolgten Ankunft in Deutschland vor einem fait accompli, denn schon Anfangs Juli war die Publikation des nun abgeschlossenen Vertrages erfolgt.
Es seien an dieser Stelle die auf Ost-Afrika insbesondere oder mit bezüglichen Paragraphen des Abkommens im Wortlaut angeführt:
Artikel I. In Ostafrika wird das Gebiet, welches Deutschland zur Geltendmachung seines Einflusses vorbehalten wird, begrenzt:
1. Im Norden durch eine Linie, welche an der Küste vom Nordufer der Mündung des Umba-Flusses ihren Ausgang nimmt und darauf in gerader Richtung zum Jipe-See läuft. An dem Ostufer des Sees entlang und um das Nordufer desselben herumführend, überschreitet die Linie darauf den Fluß Lumi, um die Landschaften Taveta und Dschagga in der Mitte zu durchschneiden und dann entlang an dem nördlichen Abhang der Bergkette des Kilimandscharo in gerader Linie weiter geführt[S. 263] zu werden, bis zu demjenigen Punkte am Ostufer des Viktoria-Nyanza-Sees, welcher von dem ersten Grad südlicher Breite getroffen wird. Von hier den See auf dem genannten Breitegrade überschreitend, folgt sie dem letzteren bis zur Grenze des Kongostaates, wo sie ihr Ende findet. Es ist indessen Einverständnis darüber vorhanden, daß die deutsche Interessensphäre auf der Westseite des genannten Sees nicht den Mfumbiroberg umfaßt. Falls sich ergeben sollte, daß dieser Berg südlich des genannten Breitengrades liegt, so soll die Grenzlinie in der Weise gezogen werden, daß sie den Berg von der deutschen Interessensphäre ausschließt, gleichwohl aber zu dem vorher bezeichneten Endpunkte zurückkehrt.
2. Im Süden durch eine Linie, welche, an der Küste von der Nordgrenze der Provinz Mozambique ausgehend, dem Laufe des Flusses Rovuma bis zu dem Punkte folgt, wo der Msinje-Fluß in den Rovuma mündet, und von dort nach Westen weiter auf den Breitenparallelen, bis zu dem Ufer des Nyassa-Sees läuft. Dann sich nordwärts wendend, setzt sie sich längs den Ost-, Nord- und Westufern des Sees bis zum nördlichen Ufer der Mündung des Songwe-Flusses fort. Sie geht darauf diesen Fluß bis zu seinem Schnittpunkte mit dem 33. Grad östlicher Länge hinauf und folgt ihm weiter bis zu demjenigen Punkte, wo er der Grenze des in dem ersten Artikel der Berliner Konferenz betriebenen geographischen Kongobeckens, wie dieselbe auf der dem 9. Protokoll der Konferenz beigefügten Karte bezeichnet ist, am nächsten kommt. Von hier geht sie gerader Linie auf die vorher gedachte Grenze zu und führt an derselben entlang bis zu deren Schnittpunkt mit dem 32. Grad östlicher Länge, sie wendet sich dann in gerader Richtung zu dem Vereinigungspunkte des Nord- und Südarmes des Kilambo-Flusses, welchem sie dann bis zu seiner Mündung in den Tanganjikasee folgt. Der Lauf der vorgedachten Grenze ist im allgemeinen nach Maßgabe einer Karte des Nyassa-Tanganjika-Plateaus angegeben, welche im Jahre 1889 amtlich für die britische Regierung angefertigt wurde.
3. Im Westen durch eine Linie, welche von der Mündung des Flusses Kilambo bis zum 1. Grad südlicher Breite mit der Grenze des Kongostaates zusammenfällt.
[S. 264]
Das Großbritannien zur Geltendmachung seines Einflusses vorbehaltene Gebiet wird begrenzt:
1. Im Süden durch die vorher erwähnte Linie von der Mündung des Umbeflusses zu dem Punkte des Kongofreistaates, welcher von dem 1. Grad südlicher Breite getroffen wird. Der Berg Mfumbiro ist in dieses Gebiet eingeschlossen.
2. Im Norden durch eine Linie, welche an der Küste am Nordufer des Jubaflusses beginnt, dem genannten Ufer des Flusses entlang läuft und mit der Grenze desjenigen Gebietes zusammenfällt, welches dem Einflusse Italiens im Gallalande und in Abessinien bis zu den Grenzen Egyptens vorbehalten ist.
3. Im Westen durch den Kongofreistaat und durch die westliche Wasserscheide des oberen Nilbeckens.
Artikel II. Um die in dem vorstehenden Artikel bezeichnete Abgrenzung zur Ausführung zu bringen, zieht Deutschland seine Schutzherrschaft über Witu zu Gunsten von Großbritannien zurück.
Großbritannien verpflichtet sich, die Souveränität des Sultans von Witu über das Gebiet anzuerkennen, welches sich von Kipini bis zu dem im Jahre 1887 als Grenze festgesetzten Punkt gegenüber der Insel von Kweihu erstreckt. Deutschland verzichtet ferner auf seine Schutzherrschaft über die an Witu grenzende Küste bis nach Kismaju und auf seine Ansprüche auf Gebiete des Festlandes nördlich vom Tanaflusse und auf die Inseln Patta und Manda.
Artikel VII. Jede der beiden Mächte übernimmt die Verpflichtung, sich jeglicher Einmischung in diejenige Interessensphäre zu enthalten, welche der andern durch Artikel I bis IV des gegenwärtigen Übereinkommens zuerkannt ist. Keine Macht wird in der Interessensphäre der andern Erwerbungen machen, Verträge abschließen, Souveränitätsrechte oder Protektorate übernehmen oder die Ausdehnung des Einflusses der andern hindern. Es besteht Einverständnis darüber, daß Gesellschaften oder Privatpersonen, welche der einen Macht angehören, die Ausübung von Souveränitätsrechten innerhalb der Interessensphäre der andern Macht, außer mit Zustimmung der letzteren, nicht zu gestatten ist.
[S. 265]
Artikel VIII. Die beiden Mächte verpflichten sich, in allen denjenigen Teilen ihrer Gebiete innerhalb der in der Akte der Berliner Konferenz von 1885 bezeichneten Freihandels-Zone, auf welche die fünf ersten Artikel der genannten Akte am Tage des gegenwärtigen Abkommens anwendbar sind, die Bestimmungen dieser Artikel in Anwendung zu bringen. Hiernach genießt der Handel vollständige Freiheit; die Schiffahrt auf den Seen, Flüssen und Kanälen und den daran gelegenen Häfen ist frei für beide Flaggen; keine ungleiche Behandlung mit Bezug auf den Transport oder Küstenhandel ist gestattet; Waaren jeder Herkunft sollen keine andern Abgaben zu entrichten haben, als solche, welche unter Ausschluß ungleicher Behandlung, für die zum Nutzen des Handels gemachten Ausgaben erhoben werden mögen; Durchgangszölle dürfen nicht erhoben und keine Monopole oder Handelsbegünstigungen gewährt werden. Den Angehörigen beider Mächte ist die freie Niederlassung in den beiderseitigen Gebieten, soweit dieselben in der Freihandels-Zone gelegen sind, gestattet.
Insbesondere herrscht Einverständnis darüber, daß in Gemäßheit dieser Bestimmungen von jedem Hemmnis und jedem Durchgangszoll frei sein soll der beiderseitige Güterverkehr zwischen dem Nyassa- und Tanganjikasee, zwischen dem Nyassa-See und dem Kongostaat, auf dem Tanganjikasee und zwischen diesem See und der nördlichen Grenze der beiden Sphären.
Artikel IX. Handels- und Bergwerkskonzessionen, sowie Rechte an Grund und Boden, welche Gesellschaften oder Privatpersonen der einen Macht innerhalb der Interessensphäre der andern Macht erworben haben, sollen von der letzteren anerkannt werden, sofern die Gültigkeit derselben genügend dargethan ist. Es herrscht Einverständnis darüber, daß die Konzessionen in Gemäßheit der an Ort und Stelle gültigen Gesetze und Verordnungen ausgeübt werden müssen.
Artikel X. In allen Gebieten Afrikas, welche einer der beiden Mächte gehören, oder unter ihrem Einfluß stehen, sollen Missionare beider Länder vollen Schutz genießen; religiöse Duldung und Freiheit für alle Formen des Gottesdienstes und für geistlichen Unterricht werden zugesichert.
[S. 266]
Artikel XI. Großbritannien wird seinen ganzen Einfluß aufbieten, um ein freundschaftliches Übereinkommen zu erleichtern, wodurch der Sultan von Sansibar seine auf dem Festland gelegenen und in den vorhandenen Konzessionen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft erwähnten Besitzungen nebst Dependenzen, sowie die Insel Mafia an Deutschland ohne Vorbehalt abtritt. Es herrscht Einverständnis darüber, daß Se. Hoheit gleichzeitig für den aus dieser Abtretung entstehenden Verlust an Einnahmen eine billige Entschädigung erhalten soll.
Deutschland verpflichtet sich, die Schutzherrschaft Großbritanniens anzuerkennen über die verbleibenden Besitzungen des Sultans von Sansibar mit Einschluß der Inseln Sansibar und Pemba, sowie über die Besitzungen des Sultans von Witu und das benachbarte Gebiet bis Kismaju, von wo die deutsche Schutzherrschaft zurückgezogen wird. Es herrscht Einverständnis darüber, daß Ihrer Majestät Regierung, falls die Abtretung der deutschen Küste nicht vor der Übernahme der Schutzherrschaft über Sansibar durch Großbritannien stattgefunden hat, bei der Übernahme jener Schutzherrschaft die Verpflichtung übernehmen wird, allen ihren Einfluß aufzuwenden, um den Sultan zu veranlassen, jene Abtretung gegen Gewährung einer billigen Entschädigung so bald als möglich vorzunehmen.«
In den kolonialfreundlichen Kreisen Deutschlands erregte das Abkommen die lebhafteste Verstimmung und — zunächst wenigstens — einen außerordentlich starken Pessimismus. Die härtesten Kritiken in den angesehensten Blättern zerpflückten die einzelnen Bestimmungen des Vertrages, und selbst die prinzipiellen Gegner der Kolonialpolitik fanden die von Deutschland gemachten Konzessionen mindestens sehr großmüthig. Man sah sich aber schließlich genötigt, mit dem Abkommen als einer Thatsache zu rechnen und mußte sich nunmehr auf den Boden der durch das Abkommen gegebenen Daten stellen, auf dem geschaffenen Fundament in der Kolonisierung Ost-Afrikas fortfahren oder eigentlich in vielen Rücksichten neu anfangen.
Überall in Ost-Afrika selbst, wohin der Vertragsabschluß ja sofort durch den Draht übermittelt wurde, wurden naturgemäß nur mißbilligende Stimmen laut.
[S. 267]
In Lindi, der Station, welcher ich damals vorstand, kam die Nachricht durch einen zufällig anlaufenden Dampfer gerade an meinem Geburtstage an und sicherlich wird mir die trübe Stimmung in dauernder Erinnerung bleiben, in welche alle Offiziere und Beamten der Station Lindi versetzt wurden.
In den Tropen, wo man leichter erregbar ist, als hier, schien uns das Abkommen eigentlich zunächst gleichbedeutend mit einem Aufgeben unseres Kolonialbesitzes überhaupt. Man hoffte zwar, daß wenigstens außer der Erwerbung Helgolands noch große politische Vorteile in Europa errungen worden seien, hinter welchen ja dann die erst begründeten Interessen in den Kolonien hätten zurückstehen müssen; aber in jedem Falle sahen wir uns vor die betrübende Notwendigkeit versetzt, mit den Daten des Vertrages rechnen und auf diese gestützt weiter arbeiten zu müssen.
Gleich uns empfand auch der einsichtsvollere Teil der Bevölkerung, besonders die Inder und Araber, die neue Nachricht als eine uns gewordene Niederlage. Selbstverständlich wurde bei dem intelligenteren Teil der Küstenbewohner der Vertrag genau zur selben Zeit wie bei uns bekannt; dieselben, welche damals auch in dem eben erst wiedergewonnenen Süden Sympathien für uns an den Tag legten und namentlich damals weit mehr für uns als für die Engländer eingenommen waren, vermieden sorgfältig, uns von der ihnen bekannt gewordenen Nachricht etwas merken zu lassen, gewissermaßen aus Zartgefühl und Rücksichtnahme auf uns.
Durch die vom Verfasser unter der Hand durch seinen farbigen Polizei-Hauptmann eingezogenen Erkundigungen aber erfuhr er, daß das Abkommen dort ebenfalls das lebhafteste Staunen hervorgerufen hatte.
Gehen wir nun die einzelnen Bestimmungen des Vertrages durch, so sehen wir, daß wir eigentlich, — wenigstens in Ostafrika, — nirgends gewonnen, sondern überall verloren haben. Die Küste war durch deutsches Geld und mit deutschem Blut zurückerobert worden, und weder wir, die wir in Ostafrika selbst thätig gewesen sind und redlich mitgeholfen haben, noch die Eingeborenen aller Art haben je unsere Wiedereroberung der Küste für etwas anderes angesehen, als eine dauernde[S. 268] Besitzergreifung, da wir ja, an der Küste besonders, überall die absoluten Herren waren und genügende Schritte zu dauernder Niederlassung geschehen waren. Auch die Erwerbung Sansibars war als etwas natürliches von den Eingeborenen und Arabern erwartet worden.
Wie an der Küste durch seine Waffenerfolge, so hatte hier ganz besonders der Reichskommissar persönlich durch sein kluges politisches Verhalten und die naturgemäße Rückwirkung von der Küste auf Sansibar, eine ganz bedeutende Besserung in dem Verhältnis zum Sultan und den Arabern herbeigeführt. Der ursprünglich gegen uns gehegte Haß des Sultans hatte sich in ein gutes freundliches Verhältnis verwandelt. Als die Verstärkung der Schutztruppe im April 1890 mit dem egyptischen Dampfer »Schibin« in Sansibar ankam, wurde bereits von den Arabern daselbst, man sagt sogar von den Engländern, welche jedenfalls in der Nacht, als der Dampfer in der Rhede lag, die Stadt und die Rhede fortwährend mit den Scheinwerfern ihrer Kriegsschiffe beleuchteten, eine Landung und die Annexion Sansibars durch Handstreich für möglich gehalten. Bis weit ins Innere herein reichte unser Einfluß. Die thatsächliche Macht war an einzelnen Stellen durch Stationen und durch zahlreiche starke Expeditionen zum Ausdruck gebracht worden. Hierzu kam, daß man nach dem Vertrage des Jahres 1886, obgleich in diesem die Interessensphäre nur im Norden und Süden begrenzt worden war, doch annehmen mußte, daß jedenfalls unser Hinterland bis an die Seen beziehungsweise die Grenze des Kongostaates voll und ganz gesichert war.
Das Vorgehen unserer Reichsregierung in der letzten Zeit der Thätigkeit des Fürsten-Reichskanzlers nördlich des Gebietes der Englisch-Ostafrikanischen Gesellschaft hatte die lebhafteste Befriedigung der kolonialen Kreise zur Folge, da diese hierin mit Recht eine Hoffnung auf energisches Vorgehen im Witu-Land und im Hinterlande desselben begründet sahen. Kaum zwei Monate vor dem Bekanntwerden des englischen Vertrages war unter dem General-Konsul Michahelles, wie bereits an anderer Stelle dieses Buches erwähnt ist, eine Gesandtschaft an den Sultan von Witu mit kaiserlichen Geschenken gesandt worden, welche diesem die Meinung beibringen[S. 269] mußte, daß nun die deutsche Regierung die Bedeutung ihres Schützlings und seines Landes würdige und denselben dem Sultan von Sansibar gegenüber zu halten entschlossen sei.
Acht Monate vor dem Vertrage war durch ein deutsches Kriegsschiff die deutsche Flagge in Kismaju gehißt und dann die Küste zwischen Witu und Kismaju unter deutschen Schutz gestellt worden. Verfasser selbst ist ein Jahr im Witu-Land thätig gewesen und hat während dieser Zeit Land und Leute, vor allen Dingen den alten, damals noch regierenden Sultan Achmed und den Sultan der in Rede stehenden Zeit, den damaligen Thronfolger Fumo Bakari, ebenso das Hinterland und die umliegenden Völkerschaften von Witu kennen gelernt. Er hat sich auf Grund seiner damals erworbenen Kenntnis in Schrift und Wort darüber ausgesprochen, einen wie großen Wert sowohl durch seine geographische Lage, wie besonders durch die teils faktische, teils moralische Macht des Sultans von Witu im ganzen Hinterlande, — speziell bei den Bararetta- und Borani-Galla, den Waboni, Wapokomo und sogar einem Teil der Somalis, — das Witu-Land gewissermaßen als Schlüsselpunkt für jene wertvollen, hochgelegenen und gesunden Länder habe.
Hierzu trat die Thätigkeit der deutschen Witu-Gesellschaft und die einer Reihe von Privatleuten, welche daselbst deutsche Interessen geschaffen und teilweise bereits Erfolge aufzuweisen hatten. Dazu kam ferner insbesondere die große Vorliebe der Sultane von Witu, welche sie seit Brenners Reisen immer für Deutschland gehegt hatten. Sie war begründet in der alten Feindschaft, welche zwischen dem Sansibar-Sultan und den Witu-Herrschern bestand, da ja bekanntlich England lebhaft die Sansibar-Sultane protegierte. Der letztere Umstand und das Bewußtsein, daß vom Anfang der kolonialen Thätigkeit Deutschlands an sich eine Rivalität zwischen diesem und England geltend machte, war für die Wituleute zu unsern Gunsten maßgebend. Verfasser selbst kann das Verhalten des alten Sultans Achmed, sowie von Fumo Bakari und der Witu-Leute überhaupt zu jener Zeit, als die Witugesellschaft ohne jede Machtmittel lediglich in friedlicher Weise in jenem Lande thätig war, gar nicht genug loben, da alles, was wir damals[S. 270] im Lande unternahmen, alle kleineren Reisen ins Hinterland, nur mit Hülfe des Sultans möglich waren. Gerade wir besaßen im Witu-Lande und in der Witu-Bevölkerung Faktoren, die uns die weitere Kolonisierung daselbst in einem Maße, wie das sonst nirgend wo der Fall war, erleichterten.
Wenn auch als Tauschobjekt gegen Helgoland und in der Erwägung, daß die großen für eine Erschließung der Hinterländer nötigen Geldmittel bei uns nicht zur Verfügung standen, ein Aufgeben des Protektorats über Witu erklärlich erschien, so hätten wir doch gewünscht, daß es in einer für den Witusultan weniger verletzenden Form geschehen wäre. Er befand sich notorisch in dem Glauben, nunmehr am deutschen Reich einen starken Rückhalt zu haben; er erfuhr das Abkommen zunächst überhaupt nur auf privatem Wege zufällig und wurde hierdurch natürlich sehr gegen uns erbittert. Jedenfalls ist diese Erbitterung des Sultans und seiner Leute nicht ohne Zusammenhang mit der Ermordung der Deutschen, welche zu dieser Zeit unter Führung Künzels zur Anlegung einer Dampfsägemühle in Witu eintrafen, wenn auch das Betragen Künzels zur Katastrophe mitgewirkt hat.
In Uganda ferner hatte Dr. Peters auf der Rückkehr von seinem energisch durchgeführten Zuge einen Vertrag mit Muanga abgeschlossen. Er hatte daselbst ebenfalls eine für uns im Gegensatz zu den Engländern äußerst günstige Stimmung vorgefunden, die wir nicht zum wenigsten dem Einfluß der katholischen Missionen zu verdanken hatten. Der Vertrag des Dr. Peters im Verein mit der Vorliebe des Herrschers und der Bevölkerung für uns stellten Interessen dar, wie sie die Engländer dort jedenfalls nicht aufzuweisen hatten, da sich die Waganda durchaus ablehnend, ja sogar feindselig gegen sie verhielten.
In gleicher Weise durfte das gesamte westlich des Nyassa gelegene Hinterland unserer Küste schon wegen der geographischen Lage als zu unserm Interessengebiet gehörig beansprucht werden, zumal die Engländer daselbst Verträge nicht zu verzeichnen hatten.
Von unserer Küste oder Interessensphäre haben wir durch den mit England geschlossenen Vertrag, abgesehen von dem[S. 271] unantastbaren Besitz der ostafrikanischen Gesellschaft, den zehn Meilen langen Küstenstreifen, den bis dahin die ostafrikanische Gesellschaft vom Sultan in Pacht gehabt hatte, bedingt bekommen. Auch letzteren hatten wir, als der Sultan seine im Vertrage eingegangenen Verpflichtungen nicht hatte erfüllen können, erst gänzlich verloren, ihn dann aber wie erwähnt, wieder erobern müssen. Für den dauernden Erwerb dieses Küstenstreifens stellte England uns seine diplomatische Unterstützung beim Sultan von Sansibar in Aussicht, wir sollten den letzteren aber außerdem noch bezahlen. Die Entschädigungssumme, wie schon erwähnt, vier Millionen Mark, mußte spätestens im Dezember des Vertragsjahres in London gezahlt werden. Interessant dürfte dabei die Thatsache sein, daß England oder Engländer dem jetzigen Sultan Said Ali zur Zeit, als er noch Prinz war und von seinen regierenden Brüdern schlecht behandelt wurde, ganz erhebliche Vorschüsse gemacht hatten!!
Wir hingegen erkannten ein englisches Protektorat über Sansibar an, lieferten den Engländern hierdurch unbedingt die ganze Herrschaft des Sultans bis auf unsere Interessensphäre aus. Die Insel Mafia, welche ursprünglich ebenfalls den Engländern zuerkannt werden sollte, obgleich sie für diese nur den Wert hatte, uns von ihr aus an dem gegenüberliegenden Teile unserer Küste chikanieren zu können, beziehungsweise etwaigen unsicheren Elementen im Hinterlande von Kilwa eine Zuflucht daselbst zu gewähren, war das einzige, was Wißmann gegen Preisgabe der Stevenson Road zwischen Nyassa und Tanganjikasee noch zuletzt für uns hatte retten können; einen positiven Wert besitzt die Insel Mafia für uns nicht.
Wir gaben, ohne dem Sultan von Witu, mit dem das Schutzbündnis kurz vorher erneuert war, ein Wort mitzuteilen und die Interessen derjenigen Suaheli, die unter deutschem Schutz bleiben wollten, irgendwie wahrzunehmen, dieses Land, dazu noch die vorher unter deutschem Schutz gestellte Küste den Engländern preis, ohne die Interessen unsres von altersher mit dem Sultan von Sansibar verfeindeten Schützlings wahrzunehmen.
[S. 272]
Ferner hatten wir zu Gunsten Englands auf die Anlehnung an den Kongostaat westlich vom Nyassa-See verzichtet. Westlich des Viktoriasees überließen wir ihnen den Mfumbiro-Berg, einen vagen Begriff, denn die Ausdehnung dieses Berges oder Gebirges kannte kein Mensch; nur das eine war sicher, daß er südlich vom ersten Breitegrade liegt, der ja eigentlich über den See hinüber die Grenze bilden sollte und daß er unsere Landverbindung mit dem Kongostaat auch im Norden bedeutend einengt. In gleicher Weise fiel Uganda, wo wir Interessen hatten, den Engländern zu.
Am bedeutsamsten und empfindlichsten aber von Allem berührte uns der Verlust von Sansibar. Die Bedeutung Sansibars liegt darin, daß dort alle politischen Fäden der weitesten Gebiete Ostafrikas, speziell ganz Deutsch-Ostafrikas zusammenlaufen, und daß es das Handels-Centrum für den überwiegenden Teil Ostafrikas bildet. Fast alle Geschäfte die in unserer Interessensphäre sowohl an der Küste, wie im Hinterlande gemacht werden, sind von indischen Handelshäusern, die teils ihre Hauptvertretung, teils Filialen in Sansibar haben, abgeschlossen, also von englischen Unterthanen. Von den Indern sind fast alle arabischen Karawanen, die das Hinterland durchziehen, abhängig. Die wenigen Karawanen, welche aus dem Innern kommen und selbständigen Handel treiben, haben ihre Absatz- und Bezugsquellen allerdings an der Küste selbst mit indischen Häusern, diese aber sind immer nur Filialen der indischen Großhändler in Sansibar, sodaß also der gesamte Handel doch endlich in Sansibar zusammenläuft. Auf den großen Reichtum Sansibars durch den Betrieb der Gewürz- und Nelken-Plantagen auf der Insel selbst und auf der Insel Pemba möge auch noch hingewiesen werden. In erster Linie aber bleibt immer die Bedeutung Sansibars als politisches und Handels-Centrum, welches uns jetzt durch die Abtretung des Sultanats an England, — wenn wir nicht gewissermaßen als Vasallen Englands auf dem Festlande Kolonialpolitik treiben wollen, — in die Notwendigkeit versetzt, erheblich größere Opfer zu bringen. Nur dann können wir mit der Zeit den Verlust von Sansibar ausgleichen.
[S. 273]
Hätten wir uns das Protektorat über Sansibar vorbehalten, so wäre uns die Möglichkeit gegeben, unsere Macht an der Küste bedeutend auszubauen. Wir hätten ein Centrum besessen, von dem aus wir bei einiger Machtentfaltung an den Seen, also an unserer westlichen Seite, leichter als jetzt die ganze Festlandskolonie hätten beherrschen können; unsere Ausgaben hätten sich bedeutend verringert.
Weshalb hat denn England so ungeheures Gewicht auf die Erwerbung Sansibars gelegt? lediglich deshalb, weil es jetzt in der Lage ist, unser gesamtes Gebiet handelspolitisch zu beeinflussen. Es wird den Engländern nie einfallen, den Sultan abzusetzen oder selbst regieren zu wollen, das letztere besorgt der Sultan unter Leitung des englischen Generalkonsuls viel besser. Noch gehen die arabischen oder indisch-arabischen Karawanen durch unser Gebiet. Große Anstrengungen werden indes zweifelsohne von den Engländern und ihrem Vasallen, dem Sultan, gemacht werden, unsern Handel nach Norden und Süden abzulenken und ihn im Süden auf dem Wege Schire—Sambesi, im Norden über Taveta nach Sansibar zu bringen.
Von Sansibar aus könnten wir ferner Deutsch-Ostafrika moralisch beeinflussen und uns an der Küste für den Anfang mit einfachen Zollstationen und geringer Polizeimacht begnügen.
Das Aufgeben Sansibars an England bedeutet für uns geradezu die Notwendigkeit eines erheblich größeren jährlichen Mehraufwands; die Ansicht vieler Kolonialgegner, daß durch die Preisgabe Sansibars eine Ersparnis am jährlichen Kolonialetat erzielt wird, ist bei den eigenartigen Verhältnissen Sansibars eine irrige. Es möge dies hier ganz besonders hervorgehoben werden.
Sansibar durch eine Bewachung der Küste, durch Ausnutzung der besseren Häfen zu ersetzen, ist bislang eine Redensart geblieben. Selbst wenn wir unsere ganze in Ostafrika jetzt befindliche Macht nur auf die Bewachung der Küste verwenden wollten, würde diese Macht noch lange nicht ausreichen, um Sansibar zu ersetzen.
Die in Artikel VIII des Abkommens getroffenen Bestimmungen, besonders die Gleichberechtigung der beiden Nationen[S. 274] in den wechselseitigen Gebieten, kommt in Wirklichkeit nur den Engländern zu Gute. Bei den geringeren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, können wir an Handelsunternehmungen im englischen Gebiet nicht denken, vor allem aber haben wir keine Inder zu Unterthanen, welche wir als Groß- und Kleinhändler an die englisch-ostafrikanische Küste setzen und durch die wir uns dort des Handels bemächtigen könnten. Die Engländer dagegen, welche uns schon im Norden, Süden und Südwesten in Wirklichkeit, im Osten durch Sansibar politisch und kommerziell umklammern, sind bei der Größe ihrer Mittel in der Lage, in unserer eigenen Kolonie an deren Westgrenze einen für sie nicht aussichtslosen Wettstreit mit uns aufzunehmen.
Der Umstand, daß das Abkommen in den ersten Monaten nach dem Reichskanzlerwechsel mit großer Hast zu Stande gebracht wurde, daß man darauf verzichtete, in den Kolonien wirklich erfahrene Leute zu befragen, die sich teilweise in Deutschland selbst befanden, — ich nenne z. B. Gravenreuth und Paul Reichard, — teilweise unterwegs nach Deutschland waren, wie besonders Wißmann selbst, diese Thatsachen schienen darauf hinzudeuten, daß es sich um ganz besondere Errungenschaften in der europäischen Politik handelte, welche durch längeres Abwarten gefährdet werden könnten und die so klar zu Tage liegend wären, daß die ostafrikanischen Interessen dabei überhaupt nicht in Frage kämen. Daß dies indes nicht der Fall gewesen ist, dürfte man wohl aus der Denkschrift über die Beweggründe zum deutsch-englischen Abkommen schließen können, welche, nachdem der Vertrag perfekt geworden war, ebenfalls im »Reichsanzeiger« veröffentlicht wurde und den Vertrag dem großen Publikum erklären zu wollen schien.
Es geht aus der Denkschrift hervor, daß unsere Regierung bei Abschluß des Vertrages lediglich von der Absicht geleitet worden ist, in allen Punkten den Forderungen der Engländer nach Möglichkeit nachzugeben, dieselben, welche sich auf die Thätigkeit der Missionare, auf Entdeckungen englischer Forscher und auf Ausübung englischen Einflusses in weitestem Maße stützten, möglichst zu erfüllen und ihre Wünsche als berechtigte anzuerkennen.
[S. 275]
Wohl hätten auch wir erwarten dürfen, daß den berechtigten Wünschen unserer kolonialfreundlich gesinnten Kreise, die doch immerhin für deutsche Verhältnisse reiche Opfer an Hab und Gut gebracht hatten, und den Hoffnungen, die sich an Opfer von Blut und Leben knüpften, mehr Rechnung getragen wäre.
Nur in einem Punkte, in der Aufgabe Ugandas, erscheint das Verhalten unserer Regierung erklärt, indem ein an den Vertrag des Jahres 1886 sich anschließender Notenwechsel angezogen wird, in welchem unsererseits schon damals Uganda als zur englischen Interessensphäre gehörig anerkannt wurde.
Wir haben absichtlich nur eine Kritik dessen, was wir in Ostafrika an Ort und Stelle als Grundlage für unsere weitere Tätigkeit bekamen, beziehungsweise dessen, was wir dort aufgegeben haben, vom Standpunkt des Nichtpolitikers aus vorgenommen, ohne uns auf eine Beurteilung des uns in Europa durch die Erwerbung Helgolands gebotenen Aequivalents einzulassen. Die Ansicht aller Kenner und Freunde unserer Kolonien indessen geht auch heute noch dahin, daß der zwar zweifellos ideelle, aber sehr verschiedenartig beurteilte wirkliche Erfolg, den wir durch jene Erwerbung errungen haben, das, was wir in Ostafrika aufgegeben haben, keineswegs aufwiegt.
[S. 276]
Die Ostafrikanische Gesellschaft und ihre Umwandlung. — Sie wird eine Erwerbsgesellschaft. — Wirtschaftliche Aufgaben der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. — Faktoreien. — Karawanserei. — Handelsbetrieb. — Einführung Deutsch-Ostafrikanischer Münzen. — Anlage von Plantagen. — Die Plantage Derema. — Arbeiterverhältnisse. — Die Frage der Verkehrswege in Ost-Afrika. — Usambara-Eisenbahn. — Der Schiffsverkehr zwischen Deutschland und Ostafrika. — Die Ostafrikanische Plantagengesellschaft und ihre Plantage Lewa. — Die Pflanzer-Gesellschaft. — Emin-Plantage. — Die Plantage des Herrn von Saint-Paul-Illaire. — Die Ostafrikanische Seehandlung. — Kaufmännische Unternehmungen in Ostafrika. — Gravenreuths Projekt der Zentralafrikanischen Seen-Gesellschaft. — Die Magdeburger Faktorei. — Apotheke in Ostafrika. — In der Anlage begriffene Unternehmungen. — Der Pulverhandel. — Anregungen.
Es scheint geeignet, an dieser Stelle einen Blick auf die wirtschaftlichen Unternehmungen zu werfen, welche in Deutsch-Ostafrika vor und während des Aufstandes bestanden, und deren Weiterentwickelung kurz zu beleuchten.
Wirtschaftliche Unternehmungen bestanden vor Ausbruch des Aufstandes in Deutsch-Ostafrika drei, nämlich die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, die Ostafrikanische Plantagen-Gesellschaft und die Pflanzer-Gesellschaft. Von diesen ist die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft die bei weitem wichtigste. Durch die früher erwähnten Verträge mit dem Sultan und den vom Reich erteilten Schutzbrief war der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft eine Stellung zugewiesen, welche an die Charter der East-India-Company erinnert, und naturgemäß waren die[S. 277] Aufgaben, welche sich der Gesellschaft zuerst darboten, mehr administrativer als wirtschaftlicher Natur.
Die Umgestaltung des Zollwesens, die alleinige Übernahme desselben durch die Beamten der Gesellschaft nahm an sich so viel Kräfte in Berlin sowohl wie in Sansibar in Anspruch, daß eigentliche wirtschaftliche Unternehmungen vor der Hand wohl ins Auge gefaßt, aber nicht angefangen wurden. Zur Zeit, als der Aufstand ausbrach, besaß die Gesellschaft in Sansibar selbst vier Häuser, in welchen die Centralverwaltung untergebracht war und welche gleichzeitig zu Wohnzwecken für die Beamten dienten. Außerdem war ihr in unmittelbarer Nähe des Sultanpalastes eine ausgedehnte Zollstätte überwiesen, an welcher sämtliche vom Festlande kommenden Dhaus anlegen und löschen mußten.
Um die direkte Ausfuhr aus den Plätzen des Festlandes nach andern Orten als Sansibar in der Hand zu behalten, waren eigene Zollstätten, wie dies in einem früheren Kapitel bereits erwähnt ist, in Bagamoyo, Daressalam, Lindi, Kilwa, Tanga und Pangani bereits eingerichtet oder in der Anlage begriffen. Durch den Ausbruch des Aufstandes wurde die Lage der Gesellschaft gänzlich verändert. Bis auf Bagamoyo und Daressalam mußten alle Stationen aufgegeben werden, und auch in Bagamoyo selbst war von einer Zollerhebung nicht die Rede.
Mit der Errichtung des Reichskommissariats und der Ankunft Wißmanns verschob sich die Stellung der Ostafrikanischen Gesellschaft vollkommen. Von einer Ausübung der von ihr erworbenen Landes-Oberhoheit im Innern konnte ebenso wenig mehr die Rede sein, wie von der Entfaltung eines politischen Einflusses an der Küste. Das gesamte Ostafrikanische Gebiet unterstand allein dem Reichskommissar, welcher der Lage der Sache nach das Standrecht über das gesamte Gebiet verhängte. Die Rechte der Gesellschaft nach dem Vertrage vom 28. April 1888 blieben unverändert fortbestehen, aber unterlagen der durch militärische Rücksichten bedingten Einschränkung und zeitweiligen Suspension, bei welcher mit dem Standrecht alle Zivilbefugnisse auf das Militär übergingen.
Eine Einmischung in die geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft und namentlich in die Zollverwaltung sollte[S. 278] vermieden werden, dagegen wurde Wißmann die Ausübung der dem Reichskanzler statutenmäßig zustehenden Aufsicht über die Gesellschaft in Bezug auf ihre Thätigkeit auf dem Festlande übertragen, so daß der Reichskommissar in der Lage war, etwaige Verordnungen der Gesellschaft außer Kraft zu setzen. Es beschränkte sich die Thätigkeit der Ostafrikanischen Gesellschaft zu Anfang des Aufstandes lediglich auf die Zollerhebung in Sansibar selbst. Sobald jedoch die Küstenplätze wieder in unserer Gewalt waren, und sobald die Anlegung der befestigten Stationen eine Garantie für Sicherung der Verhältnisse bot, wurden auch die Zollstationen daselbst wieder errichtet, so in Bagamoyo selbst, ferner in Daressalam, in Pangani und Tanga schon vor Ablauf des Jahres 1889. Wenn auch das Kommissariat vorderhand als Provisorium angesehen werden mußte, so sah die Gesellschaft doch ein, daß sie selbst nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen niemals in der Lage sein würde, selbständig ihr Gebiet zu beherrschen, daß sie vielmehr hierfür der Anlehnung an das Reich bedürfe. Die Fortdauer des Kommissariats war nach den Leistungen Wißmanns der einhellige Wunsch der Ostafrikanischen Gesellschaft, wie aller Kolonialfreunde Deutschlands.
So ist in der That der ostafrikanische Aufstand die Ursache gewesen, daß das Reich thatkräftig und selbständig in die Kolonialpolitik eintrat. Die Aufrechterhaltung des Kommissariats, an welcher niemand zweifelte, veränderte für die Ostafrikanische Gesellschaft ihre gesamte Lage. Auch nach Fortfall des Standrechtes mußten mannigfache Befugnisse der Zivilverwaltung, welche eigentlich der Ostafrikanischen Gesellschaft zugefallen wären, in der Hand des Reichskommissars verbleiben. So kam es, daß der staatsrechtliche Charakter der Gesellschaft immer mehr hinter den rein wirtschaftlichen zurücktrat.
Blieb auch die Zollverwaltung vorläufig der Gesellschaft, so wurden doch Kapitalien und Kräfte in weitem Umfange frei für die eigentliche Kultur-Arbeit, die Förderung der Produktion und die eigene Plantagenthätigkeit, sowie für die Erschließung des Landes und die Entfaltung einer Handelsthätigkeit im großen Maßstabe. Kam es doch darauf an, an[S. 279] dem nicht unbedeutenden Ein- und Ausfuhr-Handel Ostafrikas, welcher bis jetzt ausschließlich in indisch-arabischen Händen lag, selbständigen, möglichst weiten Anteil zu bekommen.
Das Verdienst, nach der letzteren Richtung hin ungemein fördernd und anregend gewirkt zu haben, gebührt in erster Linie dem Direktor der Ostafrikanischen Gesellschaft, Konsul Vohsen. Derselbe begab sich Ende des Jahres 1889 selbst nach Ostafrika, einmal um durch den Augenschein ein klares Bild der Verwaltung zu gewinnen, und ferner, um die Vertragsverhältnisse mit dem Sultan neu zu regeln. Die letztere Thätigkeit zielte vor allem darauf ab, die Durchschnittssumme festzustellen, welche von der Gesellschaft aus dem Ertrage der Ausfuhrzölle an den Sultan zu zahlen sei, und verschaffte andrerseits der Gesellschaft verschiedene wichtige Vorteile.
Das Abkommen kam zu stande am 13. Januar 1890. Die für die wirtschaftlichen Unternehmungen maßgebenden Gesichtspunkte der Gesellschaft sollten in erster Linie sein: die Hebung der allgemeinen Landeskultur, die ausgedehnte Erschließung der natürlichen Hilfsquellen des Landes und dadurch eine Mehrung seiner Produktion, ferner die Einführung von Neukulturen, insbesondere Tabak, Baumwolle, Kaffee, Indigo etc. Unterstützt werden sollten diese wirtschaftlichen Unternehmungen durch Anlegung von Faktoreien, teils in Verbindung mit Zollstationen, teils ohne dieselben, ferner durch die Entsendung von Agenten, um einen Verkehr der Eingeborenen mit den Faktoreien herbeizuführen, endlich durch die Schaffung von Verkehrswegen, insbesondere durch den Bau einer Eisenbahn durch Usambara, welche später bis zum Kilimandscharo verlängert werden sollte. Die Faktoreien wurden sofort in Angriff genommen, zuerst in Pangani, dann in Bagamoyo, Tanga und Daressalam; für die letztgenannten 3 Faktoreien wurden fertige Häuser aus Europa mittelst Segelschiffs hinbefördert. Die wesentlichste Aufgabe fiel auch hier wieder bei dem dortigen ungeheuren Karawanenverkehr der Faktorei in Bagamoyo zu. Um an dieser Stelle möglichst selbständig in den Handel eingreifen zu können und gleichzeitig die aus dem Innern kommenden Träger vor der bisher üblichen, mitunter haarsträubenden Ausbeutung durch die kleinen indischen[S. 280] Kaufleute zu schützen, ging die Ostafrikanische Gesellschaft in Bagamoyo mit dem Bau einer großen Karawanserei vor. Diese Karawanserei sollte der Centralpunkt werden, an welchem alle ankommenden Karawanen ihre Lasten anhäufen, und von dem umgekehrt die nach dem Innern ziehenden Karawanen ausgehen sollten.
Zu letzterem Zweck mußte die Karawanserei also Waarenlager enthalten, aus denen die Karawanen sich mit den im Innern gangbaren Werten, wie Baumwollstoffen, Drähten, Perlen u. s. w., versehen konnten; endlich sollten die Träger hier für eine ungemein geringe Entschädigung geschützte Wohnräume für die Dauer ihres Aufenthalts erhalten.
Früher waren die Besitzenden unter den Eingeborenen, insbesondere die sogenannten Ndewas der Waniamuesi, bei den Indern untergebracht und hier vielen Betrügereien derselben ausgesetzt; ihnen hierin zu helfen und sie von der Abhängigkeit vom Inder zu befreien, war der Hauptzweck bei Anlage der Karawanserei, der auch erreicht ist. Der Inder muß sich jetzt in der Regel dorthin bemühen. Um die und in der Karawanserei herrscht jetzt ein Leben wie an einer Börse.
Bereits im Anfang des Jahres 1890, noch bevor die Faktoreien und die Karawanserei wirklich vorhanden waren, erhielten die Beamten der Gesellschaft, so weit sie nicht lediglich den Zolldienst zu versehen hatten, den Auftrag, von den zur Küste kommenden Karawanentransporten alles aufzukaufen, dessen sie habhaft werden könnten. Es ist dies bislang allerdings nicht viel gewesen. Die Waren, welche von den Karawanen mitgeführt wurden, gehörten den indischen Kaufleuten, schon ehe die Karawane im Innern aufgebrochen war. Die führenden Araber waren entweder durch die Inder ausgerüstet, oder denselben von alters her verschuldet, so daß alles, was sie aus dem Innern mitbrachten, dem Konto ihrer indischen Gläubiger zu Gute kam.
Erst allmählich wird es sich ermöglichen lassen, in diese überaus schwierigen Handelsverhältnisse einzudringen und deutscherseits an dem bestehenden Handel Anteil zu nehmen. Man kann neue Handelswege eröffnen, wir können unsererseits Karawanen ausrüsten und den direkten Verkehr mit dem[S. 281] Innern beleben, aber es sind dies Fragen, welche vorläufig in der Zukunft liegen. Jedenfalls bleibt immer festzuhalten, daß die hauptsächlichen Träger des Handelsverkehrs die Araber sind, daß diese aber ihrerseits, wenigstens zum großen Teil, nur als Dienstleute der indischen Großkaufleute betrachtet werden können.
Gleichzeitig mit der Anlage der Faktoreien wurde von der Gesellschaft einem andern Plane näher getreten, welcher mit dem eigentlichen Handelsverkehr in engster Beziehung stand und am meisten geeignet erschien, das deutsche Element in den Handelsverkehr hineinzubringen. Es war dies die Schaffung eines eigenen deutschen Münzsystems. Nach dem Vertrage mit dem Sultan stand der Gesellschaft das Recht der Notenausgabe im gesamten Gebiet des Sultans zu. In denjenigen Teilen des Landes, welche der Gesellschaft direkt unterstanden, mußte selbstverständlich das Recht der Geldprägung ein unumschränktes sein, sobald die deutsche Regierung sich damit einverstanden erklärte. Als Faktor zur Ausdehnung des deutschen Einflusses erschien diese Geldprägung dringend geboten, zumal unser Hauptmitbewerber, nämlich die englisch-ostafrikanische Gesellschaft, nach dieser Richtung hin bereits im Januar 1890 vorgegangen war.
Um der Münze einen leichteren Eingang zu verschaffen, wurde von dem Maria Theresia-Thaler, welcher allerdings bei den Arabern und Indern noch kursierte und einen Zahlwert darstellte, nach welchem aber nur noch selten gerechnet wurde, abgesehen und dafür die überall in Sansibar und an der Küste gangbare indische Münze eingeführt: die Rupie, eine Silbermünze in der Größe eines 2-Markstücks, ferner 1/2 und 1/4 Rupie in Silber, endlich für den Kleinhandel als Scheidemünze der Pesa (64 Pesas = 1 Rupie). Die in Indien sonst noch geltende Kupfermünze Anna (16 = 1 Rupie) hat in Ostafrika keinen Eingang gefunden. Man hat verschiedentlich den Gedanken angeregt, an Stelle dieser indischen Münze lieber die Reichswährung in unserm Schutzgebiet einzuführen, zumal die Silberwährung der Rupie zu außerordentlichen Schwankungen (bis zu 30 %) Anlaß giebt. Es ist dies jedoch, vor der Hand wenigstens, undurchführbar.[S. 282] Wie oben bemerkt, liegt der Schwerpunkt des Handels gegenwärtig immer noch in den Händen der Inder, und es würde die Einführung einer ganz neuen, ihnen unbekannten Münze um so schwerer sein, als sie sogar den Maria-Theresia-Thaler fast gänzlich verdrängt haben.
Aus der Münzenprägung ergeben sich selbstverständlich für die Gesellschaft wesentliche pekuniäre Vorteile, — Vorteile, welche bisher allein von den indischen Münzstätten oder aber vom Sultan, welcher in Indien prägen ließ, gezogen wurden.
Die weitere Absicht der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft, durch die Beförderung der Landeskultur und durch Anlegung eigener Plantagen auf die Rentabilität des Landes zu wirken, befindet sich auch heute noch in den ersten Anfängen. Die Produktion der Eingeborenen hat eine wesentliche Steigerung nach keiner Richtung hin erfahren. Das Vorbild europäischer Arbeit ist dazu bis jetzt viel zu gering, die Erziehung des Negers zu selbständiger Arbeit viel zu wenig vorgeschritten. Die eigene Produktion seitens der Gesellschaft in Plantagenthätigkeit hat, und das soll ja unumwunden anerkannt werden, mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Nichtsdestoweniger kann die Gesellschaft von dem Vorwurf nicht freigesprochen werden, daß sie gegenüber den großen Mitteln, welche ihr zu Gebote standen, viel zu vorsichtig vorgegangen ist.
Zum Beweise muß an dieser Stelle dem Gange der Ereignisse vorgegriffen werden. Nach dem Zustandekommen des deutsch-englischen Abkommens vom November 1890 standen der Gesellschaft, abgesehen von ihren früheren Mitteln, etwa 5-1/2 Million Mark zur Verfügung. Sie war außerdem aller Verwaltungspflichten entbunden; sie hatte lediglich die Aufgabe, sich wirtschaftlicher Thätigkeit zu widmen. Es ist aber thatsächlich ein wesentlicher Fortschritt gegen die Zeit vor dem deutsch-englischen Abkommen auch heute noch nicht zu bemerken. Kaum daß die bereits Anfang 1890 bestehenden Pläne teilweise zur Ausführung gekommen sind. Diese Pläne zielten darauf ab, einmal eine bereits früher in Angriff genommene und während des Aufstandes wieder aufgegebene Baumwollplantage bei Kikogwe in der Nähe von Pangani in erweitertem Umfang wieder in Betrieb zu setzen und ferner eine Art Versuchsplantage in[S. 283] großem Umfange in Usambara anzulegen. Auf der letzteren sollten Versuche mit dem Anbau von Kaffee, Baumwolle, Thee, Vanille und Indigo gemacht werden.
Für die Anlage und den Betrieb dieser Plantage war Dr. Hindorf ausersehen, welcher nach vollendeter wissenschaftlicher Ausbildung 2 Jahre lang für die Neu-Guinea-Gesellschaft in ihrer Kolonie praktisch thätig gewesen war. Bei aller Tüchtigkeit Hindorfs hatte die Gesellschaft jedoch nicht genügend berücksichtigt, daß seine im Tropendienst angegriffene Gesundheit der Aufgabe in Ostafrika in keinem Falle gewachsen sein konnte. Hindorf erkrankte schon auf der Ausreise und kehrte nach kurzem Aufenthalt in Ostafrika nach Hause zurück; als Ersatz für ihn ist Ende vorigen Jahres ein in den Tropen erfahrener Pflanzer herausgesandt. Die von Hindorf ausgesuchte Landstrecke für die Versuchsplantage befindet sich bei dem Orte Derema etwa 5° 8' s. Br. und 38° 38' ö. L. in 800 m Höhe.
Noch schwieriger als die Gewinnung des eigentlichen Leiters war die Beschaffung des geeigneten Arbeitermaterials. Gegenüber dem Vorwurf, welcher gewöhnlich dem ostafrikanischen Neger gemacht wird, daß er zur Arbeit untauglich und unlustig sei, kann der Verfasser mit Recht anführen, daß es auf den Militärstationen fast nie an einer genügenden Arbeiterzahl gefehlt hat, und zwar wurden die Leute nicht etwa zum Dienst gepreßt, sondern sie boten sich freiwillig, zuweilen in der Zahl von mehreren Hundert Köpfen, für einen verhältnismäßig geringen Lohn an. Allerdings handelt es sich hier um die Küstenbevölkerung, welche mehr oder weniger mit höheren Kulturzuständen in Berührung gekommen war und auch entwickeltere Bedürfnisse sich angewöhnt hatte, zu deren Befriedigung ihnen der Lohn der Arbeit diente. Über den Küstenstrich hinaus wird eine solche Heranziehung des Negers zur Arbeit, eine Gewöhnung an höhere Kultur erst einzuführen sein. Von einer absoluten Unlust der Leute ist aber auch hier, außer bei nomadisierenden Völkern, nirgends die Rede. Arbeiter sind meistens zu erlangen. Ausschlaggebend für die Stetigkeit ihrer Arbeit ist in jedem Falle die Person des Leiters. Richtige Behandlung, große Nachsicht in einem, Strenge im andern Fall bilden in Verbindung mit sichtbaren Erfolgen die Mittel,[S. 284] eine Arbeiterbevölkerung heranzuziehen. Um von vornherein wenigstens einigermaßen Stetigkeit in die Arbeit zu bringen und die genügende Zahl von Arbeitern zu erlangen, ist in jedem Fall die Vermittlung der Jumbes nützlich und sogar notwendig. Sobald es gelingt, die Dorfältesten für die Sache zu interessieren, kann man durch dieselben in viel höherem Grade auf die Bevölkerung wirken als durch persönlichen Einfluß oder gar Befehle.
Noch eine weitere Frage bedarf hier der Erwähnung. Von den verschiedensten Seiten her ist der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft und den andern Plantagengesellschaften empfohlen worden, um sofort eine nutzbringende, erfolgreiche Thätigkeit entfalten zu können, Arbeitermaterial von außen her nach Ostafrika einzuführen. Man versprach sich davon, abgesehen von dem direkten praktischen Erfolge, auch eine erziehliche Wirkung auf die eingeborene Bevölkerung und brachte für diese Aufgabe die Chinesen in Vorschlag.
Wir sehen keinen Grund, eine solche Einführung von Arbeitermaterial zu widerraten; die Befürchtung, die Chinesen möchten das eingeborene Element überwuchern, scheint für die Verhältnisse, wie sie in Ostafrika liegen, nicht zuzutreffen und wenn die Chinesen, wie dies ja bekannt ist, neben ihrer Plantagenthätigkeit die verschiedensten Gewerke betreiben, so würde uns dies nur als wesentlicher Vorzug erscheinen, denn eingeborene Handwerker sind nicht in einer den jetzigen Bedürfnissen entsprechenden Zahl da. Europäische Handwerker können kaum auf die Dauer selbständig als solche arbeiten. Als Kaufleute würden die Chinesen den Hindus der Küste gegenüber kaum in Betracht kommen. Die Bedürfnislosigkeit der Inder ist ungefähr dieselbe wie die der Chinesen. Sollte aus einer chinesischen Einwanderung sich ein neues kaufmännisches Element herausbilden, so würde uns dasselbe eher Dienste leisten als uns schädigen. Die einzige Gefahr, welche die chinesischen Arbeiter mit sich bringen könnten, wäre ein nachteiliger Einfluß auf die Eingeborenen, da der Chinese bei seiner ungleich höheren Kulturstufe den Neger ohne weiteres zu unterdrücken versuchen würde. Aber auch diese Gefahr kann nicht in Anschlag gebracht werden, denn es liegt in der[S. 285] Hand der Stationsleiter, solchen Übergriffen in geeigneter Weise vorzubeugen. Im Interesse der Sache, d. h. einer schnellen und erfolgreichen Ausbreitung der Plantagenthätigkeit kann daher eine solche Einfuhr von Arbeitermaterial in allen den Stellen, wo die einheimische Bevölkerung erfahrungsgemäß sich nicht zur Arbeit eignet, nur empfohlen werden.
Die gegenwärtige wirtschaftliche Thätigkeit der ostafrikanischen Gesellschaft umfaßt den Betrieb von Faktoreien in Bagamoyo, Pangani, Tanga, Daressalam, Lindi, Kilwa und Mikindani, ferner den Betrieb der Baumwollplantage Kikogwe und der Versuchsplantage Derema.
Von den weiter ins Auge gefaßten Aufgaben, welche der Erschließung des Landes zu gute kommen sollten, ist vorläufig nur eine einzige und auch diese nur in recht beschränktem Umfange in der Ausführung begriffen. Die Gesellschaft hat es sich bekanntlich zur Aufgabe gestellt, Verkehrswege zu schaffen. Welcher Art diese Verkehrswege sein sollen, darüber herrscht in diesem Augenblick noch nicht einmal völlige Klarheit.
Man hat von vielen Seiten her die Anlegung umfangreicher Eisenbahnnetze in Deutsch-Ostafrika in Vorschlag gebracht. Man hat dabei vor allem zwei große Routen im Auge gehabt, eine sogenannte Centralbahn von Daressalam über Mpapua nach Tabora mit einer Verlängerung bis zum Tanganjikasee und eventuell noch einer Abzweigung bis nach dem Viktoria Nyanza. Eine zweite Bahn sollte von Tanga nach dem Kilimandscharo gehen und auch diese sollte von dort aus nach dem Viktoriasee weitergeführt werden. Für beide Linien sowie für eine ganze Reihe andrer sind eine Unmenge von Projekten von berufenen und unberufenen Kräften mit und ohne Rentabilitätsberechnung ausgeführt und befürwortet worden. Schmalspurige und normalspurige Bahnen, Feldbahnen und Seilbahnen sind vorgeschlagen, begutachtet und verworfen worden.
Zweifellos ist die Anlegung von Verkehrswegen eine der allerbrennendsten Fragen, deren Lösung für die Ausnutzung unseres Gebietes von ausschlaggebender Bedeutung ist. Vorläufig sind Straßen nach unserem Sinne in Ostafrika überhaupt nicht vorhanden. Die einzigen Verkehrswege, zu denen[S. 286] in erster Linie die sogenannten großen Karawanenstraßen mitzurechnen sind, sind schmale Pfade von etwa 2 Fuß Breite. Zu beiden Seiten dieser Pfade befindet sich je nach der verschiedenen Bewachsung und der Jahreszeit mehr oder minder hohes Gras und dichter oder lichter Busch, meist mit Unterholz und Lianen durchwachsen.
Entstanden sind diese Pfade lediglich durch den Karawanenverkehr. Nicht die Rücksicht auf das Endziel hat ihnen ihre Richtung gegeben, sondern lediglich die Gewohnheit der Eingeborenen oder Karawanenführer, die Bequemlichkeit oder endlich die Rücksicht auf Wassertümpel in der Nähe der Lagerplätze. Die Entfernung wird durch diese Art Wege außerordentlich vergrößert.
Der Marsch auf dem Karawanenpfade ist mit großen Unzuträglichkeiten und Beschwerden verknüpft, denn die Schmalheit des Weges bedingt es, daß die ganze Karawane oder die Expedition sich im Gänsemarsch bewegen muß.
Sowohl in Rücksicht auf den Handelsverkehr als auch strategisch sind diese Wege zwar nicht gänzlich unbrauchbar, aber doch eben nur ein Notbehelf. Daß hier Wandel geschaffen werden muß und zwar so schnell als möglich, liegt auf der Hand. Es fragt sich nur, welcher Art die Verkehrswege sein sollen, die wir in Ostafrika anzulegen haben und wer dieses Verkehrsnetz schaffen soll.
Wenn die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft auch in ihrem Programm von 1890 die Schaffung von Verkehrswegen vorgesehen hat, so ist die Sache jetzt doch nach der Übernahme des Regiments durch das Reich in eine andere Phase gerückt worden. Eine Gesellschaft, welche gegenwärtig lediglich Erwerbszwecke im Auge hat, wird nicht mehr die moralische Verpflichtung fühlen, ein Verkehrsnetz, welches ihr zum geringen Teil zu gute kommt, anzulegen. Diese Verpflichtung ist vielmehr zum Teil auf das Gouvernement übergegangen.
Was die Art der Verkehrswege anlangt, so wird eine Bahn nur da in Frage kommen können, wo dieselbe eine direkte Aussicht auf pekuniären Nutzen in absehbarer Zeit gewährt. Vielleicht wird man sich darauf beschränken müssen, vorläufig einmal Straßen in der Art zu schaffen, wie sie die[S. 287] Engländer in mustergiltiger Weise in allen ihren Kolonien — und zwar als erste aller Aufgaben — anlegen; Straßen, auf denen man mit Wagen fahren kann. Die Herstellung solcher Straßen ist keineswegs mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft. Die wesentlichste Arbeit dabei ist die Planierung und die gründliche Ausrodung der Bodenbewachsung, so daß eine baldige Überwucherung, wie sie in den Tropen schnell eintritt, verhindert wird (durch Kiesbelag, Korallensand etc.). Durch die Anlage eines solchen Straßennetzes würde ein doppelter Zweck erreicht werden: Einmal die Erleichterung und Beförderung des Verkehrs, also die angestrebte Erschließung des Innern und ferner die wirkliche Sicherung des Landes. Man kann auf die Dauer unmöglich sich darauf beschränken, wie dies jetzt geschieht, nur an der Küste eine Herrschaft auszuüben und durch nur in geringem Umkreis wirksame Stationen im Inneren und gelegentliche Expeditionen den Eingeborenen gegenüber unsere Autorität aufrecht zu erhalten.
Für die dauernde Sicherung unseres Besitzes reichen die vorhandenen Stationen im Innern einschließlich der neu in der Anlage begriffenen nicht aus. Es kann eine wirkliche Machtausübung nur dann erfolgen, wenn eine Reihe von Stationen an leicht gangbaren oder zu befahrenden Straßen das Land in seinen Hauptverkehrsadern sichert.
Das Gros dieser Stationen braucht nur sehr klein und mit geringen Posten versehen zu sein. Der unter den einzelnen Posten leicht herzustellende Kontakt ist vollkommen ausreichend, um auch die kriegerischen Völker des Innern wenigstens den Verkehrswegen gegenüber fortgesetzt in Schach und Botmäßigkeit zu halten. Diese Stationen sind es aber gleichzeitig, welche durch ihr bloßes Vorhandensein einen genügenden Druck auf die Häuptlinge des Innern ausüben werden, um diese zur Instandhaltung der Straße zu zwingen. Keineswegs soll diese Instandhaltung ohne Entgelt geschehen. Und abgesehen von ihrer militärischen Bedeutung würden die erwähnten Stationen noch einem zweiten ebenso wichtigen Zwecke dienen können, nämlich Proviant- und Wasserstationen für die durchziehenden Karawanen zu bilden. Die Verpflegungs- und Wasserfrage bildet bekanntlich den bei weitem schwierigsten Punkt des ganzen Karawanenverkehrs.
[S. 288]
Mißernten in gewissen Teilen des Landes legen den Verkehr ohne weiteres lahm oder erfordern riesige Opfer an Menschenleben. Die Wasserplätze unterstehen an manchen Stellen mächtigen Häuptlingen. Um Wasser zu erlangen, haben die Karawanen den bekannten Hongo, den Durchgangszoll zu entrichten, häufig auch noch das Wasser zu erkaufen. Es ist dies etwas so Gewöhnliches, daß keine Karawane sich diesem Zoll entziehen kann. Wenn durch eine Straßenanlage der Verkehr geregelt, die Wasserplätze in Besitz der Station gebracht werden, so ist der Vorteil ein dreifacher. Einmal sind die Karawanen nicht mehr von der Laune der Häuptlinge abhängig; zweitens würden die betreffenden Völkerschaften durch die regelmäßige Lieferung von Nahrungsmitteln gegen festzusetzenden Entgelt einen dauernden Vorteil genießen; endlich würde das früher willkürliche Hongosystem der Häuptlinge in die Hände deutscher Organe (und dann wird es eine dem Neger verständliche Steuer, die kein böses Blut macht) übergehen und somit einmal einen wesentlichen Faktor für die Ausbreitung des deutschen Einflusses abgeben, andererseits aber auch noch pekuniäre Vorteile gewähren. Durch die Anlage solcher Stationen wird auch einer in den letzten Jahren vielfach vorgekommenen Vergewaltigung schwacher Eingeborener durch stärkere Karawanen vorgebeugt.
Endlich dürfte der Umstand nicht gering anzuschlagen sein, daß durch die vorhandenen Stationen ja von selbst gewisse Kulturfaktoren in die Landschaft hineingetragen werden und daß daraus sich dann allerdings für die Zukunft die Möglichkeit großer Bahnanlagen ergeben kann und wird: dann nämlich, wenn die Eingeborenen des Exports werte Produkte in genügender Menge produzieren. Ohne in Details hier weiter eingehen zu wollen, ist besonders notwendig eine Straße, welche im großen und ganzen den Karawanenweg von Bagamoyo und Mpapua bis Tabora festlegen sollte. Wenn der Weg gleich energisch in Angriff genommen würde, so könnte diese Straße von Daressalam aus über Kilossa gehen, dann sich im Allgemeinen im Anschluß an den alten Weg über Mpapua nach Tabora wenden, von wo aus dieselbe nach dem Nyanza und nach dem Tanganjika (Udschidschi) weiter geführt werden[S. 289] müßte. Weiterhin eine Straße von Tanga nach dem Kilimandscharo, ferner Verbindungen von Kilwa und Lindi mit dem Nyassa-See.
Von den genannten Verkehrsstraßen ist die eine, nämlich die von Tanga nach dem Kilimandscharo, bereits in den ersten Anfängen der Anlage begriffen, indem die Vorarbeiten für die Eisenbahn der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft schon gemacht werden und zwar besonders im Hinblick auf das üppige Hinterland von Tanga und Pangani, wo man für tropische Pflanzungen und europäische Ansiedelungen große Hoffnungen hegt. Die erste Strecke der Bahn soll von Tanga nach Korogwe am Rufu (Panganifluß) in südwestlicher Richtung führen, etwa 60 Kilometer. Sie durchschneidet einen der fruchtbarsten Teile der Landschaft Usambara; ihre Verlängerung nach dem Kilimandscharo und weiterhin nach dem Viktoriasee ist in Aussicht genommen.
Maßgebend für die Anlegung dieser Schienenstrecke war auch das Vorgehen der Engländer in ihrem Gebiet. Diese sind seit dem Jahre 1890 mit dem Bau einer Bahn beschäftigt, welche von Mombassa nach Taveta, einem stark besuchten Karawanenplatz am Fuße des Kilimandscharo, aber in Britisch-Ostafrika führen soll, einer Bahn, welche später ebenfalls bis an die Ufer des Viktoria-Nyanza verlängert werden soll, und die, wenn sie früher als die unsrige fertig wird, zweifellos unserm Handel großen Abbruch thut, bezw. denselben am Nyanza überhaupt lahm legt. Es ist daher der Entschluß der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, mit dem vorher erwähnten Schienenwege vorzugehen, dankbar zu begrüßen. Die Ausführung geschieht durch eine aus der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft heraus begründete Usambara-Eisenbahn-Gesellschaft.
Gegenwärtig ist Dr. Oskar Baumann, welcher seit Jahren in Diensten der Gesellschaft erfolgreich thätig ist und mustergiltige Vermessungen der gegenwärtigen Eisenbahnlinie sowie des ferneren Weges durch das Pare-Gebirge bis zum Kilimandscharo ausgeführt hat, damit beschäftigt, den weiteren Handelsweg für eine Straße oder Eisenbahn vom Kilimandscharo bis an den Viktoria festzulegen.
[S. 290]
Es mögen an dieser Stelle gleich einige Worte über die Verkehrsverhältnisse Platz finden, welche zwischen dem Mutterlande und der Kolonie sich entwickelt haben. Bei der Erwerbung der Kolonie und während des Aufstandes existierte eine deutsche Schifffahrtslinie nach Ostafrika noch nicht. Man war gezwungen, sich entweder der Schiffe der Messageries maritimes von Marseille oder der British-India-Linie von London über Neapel zu bedienen. Die Unzuträglichkeiten, welche diesen Zustand zu einem unhaltbaren machten, liegen auf der Hand. Der direkte deutsche Handel war entweder genötigt, sich zufälliger Gelegenheiten durch deutsche Segelschiffe zu bedienen, um direkt nach einem deutschen Hafen zu verschiffen, oder er mußte die Beförderung über Marseille oder London mit Umladung daselbst wählen. In beiden Fällen ergaben sich Schwierigkeiten, welche die Ausdehnung des Handels in hohem Grade beeinträchtigten.
Mit der Errichtung des Kommissariats, mit dem Eingreifen der Regierung in die ostafrikanischen Verhältnisse ergaben sich noch weit größere Unzuträglichkeiten. Für die Beförderung der Truppen und des Kriegsmaterials mußten entweder eigene Schiffe zu hohen Kosten gechartert werden, Schiffe, welche sich dann in vielen Fällen, — da man nehmen mußte, was gerade vorhanden war, — als Frachtfahrzeuge letzten Ranges erwiesen, oder man benutzte die regelmäßigen Linien und verschaffte denselben ganz bedeutende Mehreinnahmen auf unsere Kosten. Da von diesen Linien jedoch kein Hafen des Festlandes in Deutsch-Ostafrika angelaufen wurde, so mußte Kriegsbedarf und sonstiges Gut in Sansibar aus- und auf die Dampfer der Wißmann-Flotte oder aber auf arabische Dhaus umgeladen werden.
Um diese Mißstände aus der Welt zu schaffen, faßte die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, sobald das thatkräftige, dauernde Eingreifen der Regierung gesichert war, den Plan, durch eine direkte deutsche Dampferlinie, welche mit Staatsunterstützung fahren sollte, die bisher fehlende Verbindung zwischen Deutschland und der Kolonie herzustellen. Die Vorlage darüber kam Anfang 1890 vor den Reichstag, eine jährliche Unterstützung von 900000 Mk. wurde bewilligt, und bereits im Juli 1890 begannen die regelmäßigen Fahrten in[S. 291] vierwöchentlichen Zwischenräumen von Hamburg und Rotterdam — Neapel — Port Said — Suez — Aden nach Tanga — Daressalam — Sansibar — Lindi — Mozambique — Delagoabay und Natal. Im Anschluß an die Hauptlinie wurde eine Küstendampferlinie errichtet, welche Bagamoyo, Sadani, Pangani, Kilwa, Ibo, Quilimane, Chiloane, Inhambane und Beira anläuft. Es ist dadurch ein Seeverkehrsnetz geschaffen, welches den gegenwärtigen Anforderungen völlig entspricht.
Während die Hauptdampfer die drei besten Häfen an der Ostküste Deutsch-Ostafrikas sowie den großen Handelsmittelpunkt Sansibar und die Hauptpunkte der portugiesischen Küste sowie einen Hafen von Natal selbst anlaufen, besorgen die Küstendampfer den Verkehr mit allen denjenigen Stationen, deren Hafenverhältnisse das Anlaufen der Hauptdampfer verbieten. Das Frachtgut wird in Lindi, Daressalam oder Tanga (für unsere deutsch-ostafrikanische Küste), beziehungsweise in Sansibar gesammelt und dort auf die Hauptdampfer übergeführt und umgekehrt.
Die der Linie an der Küste selbst zukommenden Frachten sind bislang sehr gering, besonders an den Plätzen, die für den Dhauverkehr mit Sansibar geeignet sind, zum großen Teil aber auch wegen des unpraktischen Fahrplans der Dampfer, der ihnen meist einen genügenden Aufenthalt zum Nehmen und Löschen von Ladung nicht gestattet.
Gleichzeitig mit der Einrichtung der Dampferlinien geschah die Errichtung deutscher Postagenturen zunächst in Sansibar selbst, später nach Errichtung des Gouvernements in den Hauptplätzen Deutsch-Ostafrikas.
Es mag beiläufig hier bemerkt werden, daß vor dieser Zeit, entsprechend den bestehenden Verbindungen, alle Postsachen durch das französische oder englische Postbureau je nach der Nationalität des abgehenden Dampfers befördert werden mußten. Ein Postamt des Sultans von Sansibar gab es nicht.
Es ist das im vorigen Jahre verfügte Eingehen der deutschen Postagentur zu Sansibar, das nach der einen Angabe aus Gefälligkeit gegen unsere englischen Freunde, — die französische Postagentur zu Sansibar ist nicht eingegangen, — nach der anderen auf Antrag des Gouverneurs erfolgt ist, sehr[S. 292] zu beklagen; die Postagentur hatte gerade in Sansibar gute Einnahmen und war außerdem immerhin ein Mittel, uns der Bevölkerung zu nähern.
Endlich ist von den geschaffenen Verkehrserleichterungen zu erwähnen die Anlage einer Telegraphenlinie zuerst von Bagamoyo nach Daressalam mit geplanter Verlängerung über alle Hauptpunkte der Küste. Dieselbe ist wohl inzwischen im Norden durchgeführt. —
Nächst der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft kommt der Ostafrikanischen Plantagengesellschaft eine wesentliche Bedeutung zu. Diese Gesellschaft bildete sich bereits im Jahr 1888 zu dem Zwecke, in Deutsch-Ostafrika den Tabaksbau zu kultivieren. Ihr Thätigkeitsfeld befindet sich auf der Plantage Lewa, einige Kilometer von Tschogwe am Panganifluß.
Die Arbeiten auf der Plantage Lewa hatten bereits vor dem Aufstande einen bedeutenden Umfang angenommen. Sämtliche Gebäude für Verwaltungszwecke, ferner die Fermentierscheune war errichtet, die ungeheure Tabakspresse unter umständlichen Schwierigkeiten heraufgeschafft, ein Stamm von mehreren hundert Arbeitern herangezogen und thatsächlich zu einer dauernden Thätigkeit herangebildet worden. Die Plantage ließ die besten Erfolge erwarten, da kam der Aufstand und im November 1889 wurde die Plantage durch Buschiris Leute überfallen und verwüstet.
Bereits bei Ausbruch des Aufstandes hatten die Beamten der Plantagengesellschaft in Voraussicht des kommenden Unheils versucht, von der Ernte zu retten, was zu retten ging. Der Tabak wurde so schnell als möglich eingeerntet und ein Teil desselben auch, allerdings oberflächlich, fermentiert; ja, es gelang sogar, einen Teil der Ernte an die See zu bringen und nach Deutschland zu verschiffen. Nichtsdestoweniger waren natürlich die Verluste für die Gesellschaft sehr bedeutende, und sie hatte nach der Beruhigung des Nordens und nachdem Lewa durch einen Posten von 10 Mann gesichert war, ganz von vorn anzufangen. Die gesamte Plantage war überwuchert, die herangebildete Arbeiterbevölkerung in alle Winde zerstreut, und erst allmählich konnten die Arbeiten in vollem Umfange wieder aufgenommen werden.
[S. 293]
Ebenso wie die Plantagengesellschaft beschäftigt sich die Deutsche Pflanzergesellschaft in der Nähe von Tanga mit Tabaksbau. Erhebliche Erfolge sind seitens dieser Gesellschaft nicht erzielt worden, einmal weil die Leitung zu systematisch von Berlin aus betrieben wurde, wodurch jede freiere Entfaltung in Ostafrika lahm gelegt oder verzögert wurde; ferner aus Kapitalsmangel und endlich weil die in Ostafrika zur Verwendung kommenden europäischen Kräfte sich ihrer Aufgabe zum Teil nicht gewachsen zeigten; im letzten Jahr machte noch der Aufstand unter den Wadigo die nötigen Arbeiten größtenteils unmöglich.
Zu diesen älteren wirtschaftlichen Unternehmungen traten bald nach der Niederschlagung des Aufstandes noch einige andere. In erster Linie ist hier zu nennen die sogenannte Emin-Plantage. Den Grundstock derselben bildet eine früher dem Frhrn. v. Gravenreuth gehörige Schamba bei Bagamoyo, welche durch Ankäufe vergrößert wurde. Die Emin-Plantage beschäftigt sich vorwiegend unter der Leitung eines bewährten Fachmanns mit dem rationellen Anbau der Vanille.
In der Nähe von Tanga betreibt Herr von Saint-Paul-Illaire, der frühere Generalvertreter der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, eine eigene Plantage, auf welcher ebenfalls Vanille und Baumwolle kultiviert werden. In der Nähe von Tanga befindet sich ferner eine kleinere Plantage der ostafrikanischen Seehandlung (Wilhelm Perrot, Wiesbaden). Die ostafrikanische Seehandlung bildete sich 1890 zu dem Zwecke, in Ostafrika Handel mit den Eingeborenen zu treiben und eventuell sich mit selbständigem Plantagenbau zu beschäftigen. Die kleine Plantage der Gesellschaft kultiviert Baumwolle und hat vor kurzem eine nicht unbeträchtliche Sendung von Baumwolle in Bremen zum Verkauf gestellt.
Neben diesen wirtschaftlichen, dem Plantagenbau dienenden Unternehmungen müssen die rein kaufmännischen Unternehmungen Erwähnung finden.
Über die kaufmännischen Zwecke und Ziele der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft ist das Wesentliche oben gesagt worden. Eine Ergänzung zu dem Plane der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft, mit ihren Faktoreien in das Innere[S. 294] hinein vorzudringen, bildete ein Projekt des leider zu früh im Dienst des Vaterlandes gefallenen Freiherrn v. Gravenreuth, das Projekt, durch die Gründung einer deutschen Seengesellschaft an den Ufern der großen Seen, an welche unser Gebiet heranreicht, festen Fuß zu fassen und so dem deutschem Vorgehen von der Küste her von innen heraus entgegen zu arbeiten. Das zunächst ins Auge gefaßte Ziel war die Anlegung von zwei Handelsstationen am Viktoria und zwar an dessen Süd- und Westufer. An diesen beiden Stationen sollte der von Wißmann für den Viktoria geplante Dampfer die Produkte aus Uganda, Unioro, Karagwe, Kavirondo und den reichen Uferstaaten des Viktoria zusammenführen, von den Stationen aus jene Länder mit den nötigen Ausfuhrartikeln als Gegenwert versehen. Die Großartigkeit des Planes muß auf den ersten Blick einleuchten. Um so bedauerlicher ist es, daß der Plan aus Mangel an Beteiligung bisher nicht zur Ausführung gekommen ist, um so bedauerlicher deshalb, weil die beiden deutschen Stationen Bukoba und Muanza die Vorbedingungen für eine Sicherung eines solchen Handelsverkehrs gegeben hätten.
Als selbständige kaufmännische Unternehmung eröffnete ein Konsortium von drei patriotischen Magdeburger Herren im April 1890 in Tanga die kleine »Magdeburger Faktorei«. Eine wesentliche Bedeutung kann dem Unternehmen allerdings nicht zuerkannt werden. Der Rahmen ihres Geschäftsverkehrs — nämlich der Verkauf von Gebrauchsartikeln an Eingeborene und der gelegentliche Ankauf von Landesprodukten — ist dafür zu eng, aber immerhin bildet die Magdeburger Faktorei einen Beweis dafür, daß solche Unternehmungen im stande sind, sich, wenn auch zuerst vielleicht mit Opfern, allmählich zu bewähren.
Von größerer Bedeutung als dieses kleine selbständige Unternehmen ist die Errichtung von Küstenfilialen seitens der bereits seit langer Zeit in Sansibar bestehenden deutschen Handelshäuser Hansing & Cie. und der Elfenbeinfirma Meyer, da man von diesen bei der großen Erfahrung der genannten Häuser in Afrika eine weitere Ausbildung des Handelsverkehrs erwarten darf, wozu kleinere Unternehmungen in unbedeutenden Handelsplätzen etabliert, nicht im stande sind.
[S. 295]
In Daressalam ist seit einem Jahre eine deutsche Apotheke im Betrieb, welche jetzt durch den außerordentlich thätigen früheren Beamten der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft Richter, der Land und Leute genau kennt, übernommen worden ist. Filialen der Apotheke in allen Hauptplätzen sind in Aussicht genommen.
Schließlich möge hier noch ein Unternehmen Erwähnung finden, welches zwar noch nicht in Ostafrika seine Thätigkeit aufgenommen hat, für welches jedoch die Kapitalien vorhanden und die Rechtsformen gegeben sind. Es ist dies eine Bremer Handelsgesellschaft, welche unter stiller Beteiligung der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft mit einem Kapital von 300000 Mk. Handelsunternehmungen an der Küste betreiben wird und selbständige Karawanen nach dem Innern auszurüsten gedenkt. Auch der in nächster Zeit zur Ausführung gelangende Versuch der Begründung einer Ziegelei zu Tanga durch den in Ostafrika erfahrenen früheren Proviantmeister Jahnke finde hier Erwähnung.
Es braucht kaum gesagt zu werden, daß neben den genannten großen wirtschaftlichen Unternehmungen mit der fortschreitenden Sicherheit an der Küste und mit der Zunahme des europäischen Elements daselbst eine Menge kleinerer kaufmännischer Geschäfte wie Pilze aus der Erde schossen, kaufmännische Geschäfte, welche lediglich von dem Verkehr mit den Europäern, von dem Verkauf von Konserven und europäischen Bedürfnissen, Spirituosen und dergleichen mehr leben. Sie sind großenteils in Händen von Portugiesen, Griechen und allerlei Existenzen, welche von Sansibar aus des besseren Geschäfts wegen nach der Küste übersiedeln.
Allgemein bekannt ist ja, daß, wie seiner Zeit der Sultan von Sansibar das Pulvermonopol in Händen hatte, jetzt dieses Monopol in den Händen des Gouvernements und vordem in denen des Reichskommissariats sich befand. Über diese Maßregel ist von kaufmännischer Seite des öfteren geklagt worden, doch ist sie zweifellos notwendig, um die Einfuhr von Waffen und Munition ins Innere jederzeit kontrolieren und selbst in der Hand behalten zu können. Allerdings wäre es verkehrt, hier übermäßig vorsichtig vorzugehen und zu meinen, durch[S. 296] Erschwerungen der Pulver-Einfuhr könne Aufständen im Innern vorgebeugt werden, z. B. dadurch, daß man vielleicht das Pulver blos an zuverlässige Karawanen und Stämme abgäbe. Eine solche Maßregel wäre schon deswegen verkehrt, weil die Munition im Innern immer der gesuchteste, wertvollste Tauschartikel ist, für den insbesondere meist Elfenbein eingehandelt wird.
Auch ist andrerseits hervorzuheben, daß sowohl bei der geringen Besetzung der Küste wie bei den ausgedehnten Beziehungen, die die Stämme des Innern überall in unsern Grenzgebieten oder jenseits des Tanganjika anknüpfen können, eine solche Maßregel nicht absolut wirksam sein würde, solange wir nicht ganz bestimmte Abkommen, von denen wir überzeugt sind, daß sie auch gehalten werden, mit den andern europäischen Völkern getroffen haben.
Der Pulverhandel muß aber in jedem Falle in unserer Hand bleiben, da wir hierdurch in engerer Berührung mit den Karawanen und den eingeborenen Stämmen selbst uns befinden und gegebenen Falls die Einfuhr, wenn auch nicht ganz verhindern, so doch erschweren können.
Es sei zum Schluß ein zusammenfassendes Urteil über die Aussichten der deutschen Plantagen-Unternehmungen gestattet. Was zunächst die Baumwolle anlangt, so haben schon die Proben der in Deutsch-Ostafrika wild wachsenden Baumwolle den hohen Wert derselben gezeigt. Das Urteil der Fachleute läßt sich dahin zusammenfassen, daß bei einer rationellen Kultur die in Ostafrika gezogene Baumwolle der auf dem Weltmarkt am höchsten bewerteten gleichzuschätzen sein wird. Rücksichtlich des Tabaks ist ein abschließendes Urteil gegenwärtig kaum zu fällen. Die erste Ernte ist, wie bereits früher erwähnt, in verdorbenem Zustande in Deutschland angekommen. Sie hat nichtsdestoweniger ein Urteil dahin erlaubt, daß das gezogene Blatt in der Struktur dem besten Sumatra-Tabak als ähnlich sich erweist und als Deckblatt ausgedehnteste Verwendung finden kann, vorausgesetzt, daß durch Fachleute und vor allem im Bau des Tropentabaks bewanderte Pflanzer der Tabak an Ort und Stelle richtig behandelt wird. Versuche mit Kaffee sind bisher im Wesentlichen nur von den katholischen Missionen,[S. 297] besonders in Morogro und am Viktoria vorgenommen worden. Die Versuche haben ergeben, daß der dort gezogene Kaffee dem besten Mokka gleichwertig ist.
Wir möchten jedoch nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß eine große Menge von Naturprodukten gegenwärtig noch völlig unausgebeutet der Initiative des deutschen Kapitals harren. In allererster Linie handelt es sich dabei um die Ausnutzung der bedeutenden Kokosbestände der Küste, welche gegenwärtig nur in sehr geringem Maße stattfindet.
Kopra wird an der Küste nicht mehr gemacht, sondern die Nüsse gehen in natura nach Sansibar und in großen Quantitäten von dort zur Verarbeitung nach Indien. Bereits 1890 ist von Fachleuten auf die Bedeutung dieser Kokosbestände und auf die leichte Möglichkeit, sie ungemein nutzbringend an Ort und Stelle zur Fabrikation des Kokosöls zu verwerten, aufmerksam gemacht worden. Man ist indes dem seiner Zeit in vollkommen umfassender Form vorgelegten Plane bislang von kapitalkräftiger Seite trotz des auf der Hand liegenden Vorteils noch nicht näher getreten.
Aehnlich steht es mit dem Anbau oder der Gewinnung von Erdnüssen und Sesam, Handelsartikeln, die auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen.
Selbst die gewöhnlichen Negerbedürfnisse werden an den meisten Plätzen in lange nicht genügender Menge kultiviert und noch vielfach ist Einfuhr von Madagaskar und Indien nötig.
Die Kultur des Bodens und des Landes kann auf die mannigfachste Weise noch gefördert werden.
[S. 298]
Übernahme des Gouvernements. — Umwandlung der Schutztruppe. — Sodens erste Maßnahmen. — Starkes Beamtenpersonal. — Einteilung der Ressorts. — Einteilung der Küste in Bezirke. — Bezirkshauptleute und Stationschefs. — Verringerung des weißen Personals der Schutztruppe. — Verteilung der Truppe. — Doppelwirtschaft in der Unterstellung der Truppen unter Reichs-Marine-Amt und Auswärtiges Amt. — Einfall der Wahehe in Usagara. — Unterbrechung des Karawanen-Verkehrs. — Beschimpfung der deutschen Flagge im Innern. — Die Expedition des Kommandeurs von Zelewski und ihr Untergang. — Rückzug des Restes der Truppe. — Wirkung der Expedition auf die Wahehe; Wirkung an der Küste. — Verhandlungen des Gouverneurs durch Missionare mit den Wahehe gescheitert. — Die gefallenen Europäer und Farbigen in Uhehe noch unbeerdigt. — Schwierigkeiten auf afrikanischen Expeditionen; Sicherung auf denselben; afrikanisches Terrain. — Expedition des Verfassers durch Usegua, Nguru, Usagara wegen Unruhen der Wakuafi; Mitwirkung Bana Heris. — Expedition des Verfassers ins Mafitiland. — Rekognoszierungstour unter Lieutenant Prince nach Mpapua. — Erhebung der Wadigo bei Tanga. — Kämpfe am Kilimandscharo unter Dr. Peters. — Neuorganisation der Schutztruppe. — Der Gouverneur übernimmt das Kommando; der Verfasser als militärischer Beirat. — Ergänzung der Schutztruppe durch Wißmann in Egypten und durch von Perbandt in Massaua. — Korvetten-Kapitän Rüdiger wird Stellvertreter des Gouverneurs. — Rückkehr des Verfassers nach Deutschland. — Teilung der Schutztruppe in die eigentliche Schutztruppe und Polizeimacht. — Verteilung auf die Bezirksämter. — Beurteilung dieser Organisation. — Wirkungskreis der Stationen im Innern. — Prinzipien bei der Besetzung der Bezirksämter. — Die Bemühungen des Gouverneurs, Bagamoyo durch Daressalam zu ersetzen. — Die Postverbindung mit dem Innern. — Erlasse des Gouverneurs, Zolleinnahmen betreffend. — Verhältnis des Gouverneurs zu den Eingeborenen. — Berater des Gouverneurs. — Nachrichten vom Kilimandscharo.
Wir haben bereits erwähnt, daß während des Monats November 1890 der bisherige Gouverneur von Kamerun,[S. 299] Freiherr von Soden, sich in Sansibar und Ostafrika aufhielt, um sich über die dortigen Verhältnisse zu orientieren. Bei der Überleitung Deutsch-Ostafrikas in eine Kronkolonie war Major von Wißmann vom Reichskanzler nicht für den Gouverneursposten in Deutsch-Ostafrika in Aussicht genommen. Nachdem Soden Anfang Dezember von Sansibar wieder abgereist war, um in Deutschland die nötigen Vorbereitungen zu treffen und im Auswärtigen Amt seine Instruktionen entgegenzunehmen, ging er im März 1891 nach seiner Ernennung zum kaiserlichen Gouverneur (für die Dauer seiner Amtsthätigkeit mit dem Prädikat Excellenz) wiederum aus Berlin nach Ostafrika ab.
Nach seiner Ankunft besuchte er die Plätze Tanga, Bagamoyo und Daressalam; zu Bagamoyo fand die Übergabe durch den bisherigen kaiserlichen Reichskommissar statt. Bei der Neuordnung der Verhältnisse wurde durch Gesetz vom 22. März 1891 die Wißmann'sche Schutztruppe in eine kaiserliche umgewandelt, und zum Kommandeur derselben der bisherige Chef in der Schutztruppe Herr von Zelewski ernannt. Bezüglich der Verwendung der Schutztruppe in Ostafrika hatte der Gouverneur das Erforderliche zu bestimmen. Im Übrigen, auch im Civildienst waren die nötigen Organe ihm beigegeben worden.
Ursprünglich war beabsichtigt, für seinen Vertreter und sachkundigen Berater die Stellung eines Gouvernementsrates zu schaffen und diese dem früheren stellvertretenden Reichskommissar und Chef in der Schutztruppe Dr. Karl Wilhelm Schmidt zu übergeben. Es wäre dies sehr praktisch gewesen; die Ruhe und Besonnenheit des älteren, im Verwaltungsdienst des Auswärtigen Amtes erfahrenen Herrn von Soden hätte einen Anhalt an der Praxis und Sachkunde des durchaus objektiven, von Optimismus gänzlich freien und ebenfalls besonnenen und ruhigen Dr. Schmidt gefunden. Herr von Soden scheint sich jedoch mit allen Kräften dagegen gesträubt zu haben, einen wirklich an Ort und Stelle erfahrenen Herrn als Berater zu erhalten. Vielleicht besorgte er, dieser möchte zu viel Einfluß auf seine Amtsthätigkeit erlangen und am Ende das Heft gar selbst in die Hände bekommen. So setzte es denn Herr von Soden durch, daß die Stelle des Gouvernementsrates durch[S. 300] die eines Oberrichters ersetzt wurde, der das Richteramt zweiter Instanz im Schutzgebiet ausüben sollte. Diese Stelle wurde zunächst garnicht besetzt, und erst ein halbes Jahr später dem bisherigen Legationsrat im Auswärtigen Amt, Sonnenschein, der im Ausland früher als Kommissar der Marschalls-Inseln thätig gewesen war, übertragen. Da die Wahl wegen der mit diesem Amte verbundenen Funktionen auf einen Juristen fallen mußte und an Ort und Stelle erfahrene Juristen nicht vorhanden waren, kann die Wahl dieses ruhigen und unparteiischen Herrn nur als eine glückliche bezeichnet werden. Im Übrigen erhielt die Verwaltung der Finanzen einen Chef in dem bisherigen Intendantur-Assessor Dr. Kanzki, der zugleich Intendant der kaiserlichen Schutztruppe wurde. Seine Hauptstütze war der ihm unterstellte Land-Rentmeister, der ebenfalls an Ort und Stelle Erfahrungen nicht gesammelt hatte. Zu diesem Posten wurde zuerst ein früherer Marine-Zahlmeister, dann aber, da letzterer abgelöst werden mußte, ein früherer Post-Sekretair ausersehen. Dem letzteren war die in Ostafrika nötige Art der Verwaltung ebenso fremd wie dem Dr. Kanzki.
Obwohl daher am 1. April 1891 und in den folgenden Monaten in allen Zweigen der Verwaltung in Deutschland thätig gewesene Kassenbeamte nach Ostafrika hinausgeschickt wurden, und, wie wir bereits früher erwähnt, statt der paar Leute, die Wißmann für jene Verwaltungszwecke sich erst selbst hatte heranbilden müssen, ein wirklich umfangreiches Personal zur Verfügung stand, konnte doch die Verwaltung zunächst gar nicht recht in Gang kommen. Selbst heute, wo die Zahl der reinen Kassenbeamten und Schreiber ein viertel Hundert weit übersteigt, wird noch immer über Mangel an Bureaupersonal geklagt.
Eine geordnete Übergabe der Kassengeschäfte war durch die Thätigkeit der Revisions-Kommission in Ostafrika möglich gewesen. Von Seiten des Auswärtigen Amtes hatte man im Jahre 1890 zwei Revisoren nach Ostafrika geschickt, um sich einen genauen Einblick in die Kassenverwaltung des Reichskommissars zu verschaffen. Die Ursache dieser Maßregel war der Umstand, daß es dem Reichskommissar nicht gelungen war, bei den ungeordneten Verhältnissen und der Vielseitigkeit[S. 301] seiner sonstigen Thätigkeit, für alle ausgegebenen Summen die nötigen Belege der Legationskasse des Auswärtigen Amtes zu bringen. Die beiden Revisoren brachten nun alles ins rechte Geleis und stellten vor allen Dingen das Faktum fest, daß eine durchaus sachgemäße, den örtlichen Verhältnissen entsprechende Geldverwaltung vom Reichskommissar ausgeübt worden war.
Der ältere der beiden Revisoren war der bisherige Marine-Zahlmeister Sturz, der als Geschwader-Zahlmeister eine längere Erfahrung in Ostafrika hinter sich hatte und sich stets durch große Umsicht und Gewandtheit wie durch seinen praktischen Sinn ausgezeichnet hatte, auch besonders wegen der vorzüglichen ihm zur Seite stehenden Empfehlungen seines bisherigen Chefs, des Admirals Deinhard, für jenen schwierigen Posten als erster Revisor geeignet erschien. Er erfüllte seine Pflichten nicht nur mit der ihm eigenen Sachkunde, sondern auch mit großem Taktgefühl. Ihm zur Seite stand ein anderer Beamter der Marine Namens Selle. Leider ist der Versuch entweder nicht gelungen oder nicht gemacht worden, diese beiden Herren für den Verwaltungsdienst in Ost-Afrika zu gewinnen. Der Marine-Zahlmeister Sturz wäre jedenfalls eine im höchsten Grade geeignete Persönlichkeit für die Stelle des Chefs der Verwaltung in Ostafrika gewesen.
Andere Civil-Organe für den Gouverneur bildeten die Bezirks-Hauptleute, welche den Küstenbezirks-Ämtern vorstanden. Es wurde die Küste in 5 Bezirke, Tanga, Bagamoyo, Daressalam, Kilwa und Mgau eingeteilt. Für jeden dieser Bezirke wurde ein Bezirks-Amt, dem der betreffende Bezirkshauptmann vorstand, geschaffen. Diese Bezirkshauptleute hatten alle die Verwaltungs-Funktionen, welche die Stationschefs unter dem Reichskommissariat ausgeübt hatten. Da einige Bezirksämter mehrere Küsten-Stationen unter sich hatten, waren die Stationschefs der Neben-Stationen den Bezirkshauptleuten unterstellt.
Die Bezirkshauptleute wie die Stationschefs hatten auch wie früher die Gerichtsbarkeit in den Plätzen unter sich. Bei verwickelten Sachen, oder wo es sich um größere Objekte handelte, oder endlich wenn die eine der streitenden Parteien[S. 302] aus Europäern bestand, trat der zwei Monat vorher herausgeschickte, den ostafrikanischen Verhältnissen fremd gegenüberstehende Kanzler Eschke als Adlat des Gouverneurs in Thätigkeit.
Um die Verbindungen an der Küste zu unterhalten, verwandte man, wie zu Wißmanns Zeiten, die Flottille, nunmehr Gouvernements-Flottille genannt, die aus den kleinen Wißmann-Dampfern bestand und, wie wir bereits erwähnten, trotz vieler Mängel in den vergangenen Jahren gute Dienste geleistet hatte.
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Deutsch-Ostafrika, insbesondere zur Bekämpfung des Sklavenhandels diente, wie erwähnt, die kaiserliche Schutztruppe, bestehend aus 1500 farbigen Soldaten. Der Etat an für den eigentlichen Truppendienst in Betracht kommenden Europäern wurde jedoch mit dem 1. April 1891 erheblich verringert, und bestand nunmehr nur noch aus 24 Offizieren und 35 Unteroffizieren gegenüber 35 Offizieren, 16 Deckoffizieren und 107 Unteroffizieren zu Wißmanns Zeiten. Dazu traten noch für die kaiserliche Schutztruppe 10 Ärzte, gegenüber 5 unter Wißmann, ferner 15 Zahlmeister-Aspiranten, 16 Lazarettgehülfen und 2 Schreiber. Im ganzen jetzt 102 Europäer, früher 163. Viele der Europäer der Schutztruppe, besonders die Zahlmeister-Aspiranten und eine Reihe von Unteroffizieren waren gänzlich zum Gouvernementsdienst abkommandiert und gingen so der Truppe verloren.
Die Schutztruppe wurde auf Befehl von Berlin in 10 Kompagnien formiert, von denen 4 als Besatzungs-Kompagnien der Küste dienten, 4 Expeditions-Kompagnien und 2 Ersatz-Kompagnien für die Besetzungen des Innern und die Ablösungs-Mannschaften im Innern bildeten. Die 4 Besatzungs-Kompagnien waren auf die 5 Küsten-Bezirke derart verteilt, daß jeder Bezirk eine Kompagnie hatte, die Bezirke Bagamoyo und Daressalam dagegen zusammen eine Kompagnie mit dem Stabe in Bagamoyo. Die Kompagnieführer standen zugleich als Bezirks-Hauptleute den Bezirksämtern vor, hatten also doppelte Funktionen, und waren in civiler Hinsicht dem Gouverneur, in militärischer dem Kommandeur unterstellt. Es war dies ein bedeutender Mißstand, der zu Reibereien[S. 303] der betreffenden Behörden Veranlassung geben und die betreffenden Offiziere in Kollision mit den verschiedenen Pflichten bringen konnte. In gleicher Weise war dies beim Intendanten, der, wie erwähnt, ebenfalls den beiden Herren unterstellt war, beim Kanzler, der zugleich Auditeur der Schutztruppe war, endlich beim Landrentmeister der Fall.
Die Schutztruppe selbst unterstand, was Personalien und die militärische Verwaltung anlangte, jetzt dem Reichs-Marine-Amt, für ihre Verwendung und die ökonomische Verwaltung dagegen dem Gouverneur und der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, an deren Spitze der Dirigent derselben, Wirkliche Geheime Legations-Rath Dr. Kayser steht. In der Kolonial-Abteilung hatten wir in der Heimat eine Behörde, deren einzelne Beamten sich durch mehrjährige Thätigkeit in der Verwaltung der Kolonien sowohl in Berlin, wie teils auch an Ort und Stelle Erfahrungen erworben hatten, die, wie besonders der Dirigent derselben, den Kolonien nicht nur ein reges Interesse, sondern auch ein praktisches Verständnis entgegenbringen. Das Reichs-Marine-Amt dagegen bekam eigentlich in der Verwaltung der Schutztruppe ein Anhängsel: die Schutztruppe stand bis dahin der Marine vollkommen fremd gegenüber und dürfte wohl auch jetzt, wie dies ja auch erklärlich ist, als Stiefkind und unliebsames Anhängsel von der Marine angesehen werden. In keinem Falle kann die doppelte Unterstellung der Schutztruppe unter das Auswärtige Amt und das Reichs-Marine-Amt als vorteilhaft angesehen werden. Eine Vereinfachung hierin erscheint als dringendes Bedürfnis und man wird sich wohl auf die Dauer der Schaffung eines eigenen Kolonial-Amtes, in dem die betreffenden Behörden vereinigt und dem Leiter dieses Kolonial-Amtes unterstellt sein müßten, nicht entziehen können.
Bei der Überleitung des Reichskommissariats in das Gouvernement wurden die neu herausgesandten Beamten schon im Etat auffallend gut behandelt; weit weniger kümmerte man sich um viele der älteren Wißmann-Offiziere, für die der neue Etat geradezu eine bedeutende Verschlechterung bedeutete; ein Teil derselben wurde im Jahresgehalt um 2400 Mark heruntergesetzt. Junge Juristen, die Ostafrika im vorigen[S. 304] Jahre das erste Mal erblickten und vorher daheim Assessoren gewesen waren, erhielten für ihre wenig aufreibende Thätigkeit im reinen Küsten- und Verwaltungsdienst ein Gehalt, das den Jahre lang in Afrika unter allerlei Gefahren und Entbehrungen thätig gewesenen älteren Offizieren genommen wurde; und wenn auch von den letzteren wohl kein einziger allein aus materiellen Gründen draußen seine Thätigkeit fortsetzte, so bewirkte doch diese Behandlung immerhin den Anfang einer Verstimmung.
Nachdem die Besetzung des Küstengebietes nach der erwähnten Einteilung neu durchgeführt war, ging der Gouverneur daran, die Verwaltung in seinem Sinne einzurichten. Es gehört nicht in den Rahmen dieses Buches, ausführlich alles das, was nach der Uebergabe der Geschäfte durch von Soden geschehen ist, zu beschreiben; es sollen nur in kurzen Zügen die Ereignisse des letzten Jahres geschildert werden. Wißmanns Arbeit hatte dem Gouverneur eine Basis geschaffen, auf welcher der letztere seine Thätigkeit aufbauen konnte. —
Der in einem früheren Kapitel erwähnte Zug des Chefs Ramsay ins Mukondogua-Thal und sein Abkommen mit den Wahehe hatte diese bewogen, Gesandte nach der Küste zu schicken, die einen endgültigen Frieden mit dem Gouverneur abschließen sollten. In Bagamoyo angekommen, wurde den Leuten, da gerade damals das ganze Expeditionskorps in Bagamoyo sich befand, ein Begriff von unserer Stärke beigebracht. Man gab sich der Hoffnung hin, daß die Wahehe auf ihren Raubzügen jetzt etwas vorsichtiger sein würden und jedenfalls die Karawanenstraße und Usagara nicht mehr beunruhigen, sondern sich auf Kriege mit den Wagogo, Massai und Warori beschränken würden. Die Wahehe heuchelten in jeder Beziehung Unterwürfigkeit und versprachen alles, was von ihnen verlangt wurde. Befremdlich war es jedoch, daß, nachdem die Gesandtschaft entlassen und in ihr Land zurückgekehrt war, sogleich wieder ein neuer Einfall nach Usagara gemacht und dieses wichtige Land aufs empfindlichste von den Räuberhorden beunruhigt wurde.
Der Verkehr auf der nach Bagamoyo führenden Straße war vollständig unterbrochen, unsere Schutzbefohlenen aus[S. 305] Usagara klagten ihre Not nach Bagamoyo, sie meldeten, daß die deutsche Flagge in den Dörfern, die sie geführt hätten, von den Wahehe herunter gerissen worden sei und daß dieselben unsere Behörden verhöhnt hätten. Ein Eingriff der Schutztruppe in dem bedrohten Gebiet war demnach selbstverständlich. Der dem Gouverneur oder vielmehr, da dieser neu nach Ostafrika gekommen war, seinen Beratern, — und das waren diesem Falle wir, die ältesten Offiziere, speziell der Verfasser als Bezirks-Hauptmann von Bagamoyo, — gemachte Vorwurf, daß die gegen die Wahehe ausgerüstete Strafexpedition leichtsinnig und überflüssig gewesen wäre, ist durchaus unverständlich.
Die Frechheit der Wahehe, welche über unsere Leichtgläubigkeit und die ihnen bewiesene Nachsicht nur spotteten, mußte bestraft werden, die Bewohner der blühenden Ortschaften im Mukondoguathal durften nicht in ihrem Vertrauen auf uns getäuscht werden, die Ruhe an der Karawanenstraße mußte hergestellt werden: das waren doch wohl vollwichtige Gründe, aus denen der Verfasser beim Gouverneur die Ausrüstung einer Expedition, die schleunigst von Bagamoyo in die bedrohte Gegend marschieren sollte, beantragte. Die Führung derselben wurde auf seinen Vorschlag vom Gouverneur ursprünglich dem Verfasser zugedacht; Nachrichten indes, welche aus Kilwa nach Daressalam drangen und besagten, daß dort die Mafiti wie alljährlich einen Einfall in das Hinterland von Kilwa gemacht hätten und bis ganz dicht an die Stadt vorgedrungen wären, machten zunächst ein Einschreiten um Kilwa notwendig, da hier die Küstenbevölkerung selbst bedroht schien.
So ging denn der Kommandant der Schutztruppe von Zelewski mit dem gesamten Expeditionskorps von 4 Kompagnien nach Kilwa, um nach Beseitigung der Mafiti-Gefahr im Einverständnis mit dem Gouverneur durch das Hinterland über den Rufidji nach Usagara zu marschieren. Der Verfasser hat sich zu jener Zeit in Daressalam dahin ausgesprochen, daß dieser Marsch ihm nicht empfehlenswert erschien. Ein Eingreifen des Expeditionskorps war allerdings zunächst bei Kilwa absolut notwendig. Indes nach Beseitigung der Gefahr von Kilwa wäre die Überführung der für die Wahehe-Expedition[S. 306] notwendigen Truppen durch Dampfer nach Bagamoyo richtig gewesen, von wo aus dann die Expedition in Eilmärschen auf der Karawanenstraße nach Mpapua hätte vorgehen können. In Mpapua lag die Möglichkeit vor, aus den Reihen der Wagogo und Massai, den Feinden der Wahehe, für uns sehr wertvolle Bundesgenossen zu erhalten, durch diese mehr gesichert, von Mpapua aus nach Süden in Uhehe einzudringen und hier nach Osten auf Kondoa herumzugreifen. Der Zweck eines Marsches durch das Hinterland von Kilwa erschien aus militärischen und politischen Gründen verfehlt. Die Schwierigkeiten, die sich der Verpflegung einer großen Truppe entgegenstellen mußten, die Notwendigkeit, daß man nicht zu unterschätzende, räuberische Stämme zu passieren hatte, die uns einerseits immer ausweichen, andererseits aber in ungünstiger Gegend, auf Lagerplätzen und beim Marsch leicht gefährlich werden konnten, sprachen zu laut dagegen. Im besten Falle war dieser Marsch eine gute Sports-, vielleicht auch eine geographische Leistung, aber einen bedeutenden Erfolg konnte er nicht haben. Die Absicht, nach Mpapua zu gehen und von hier aus die Expedition durch Verbündete aus den Reihen der genannten Stämme zu verstärken, hatte der Kommandant ebenfalls, aber er wollte von Kilwa aus nach Mpapua gelangen; der Gouverneur genehmigte trotz der zur Sprache gekommenen Bedenken diesen Plan.
Um Zeit zu sparen, war Zelewski gezwungen, nach der Ankunft am Jombofluss von dem Marsch nach Mpapua Abstand zu nehmen und die Expedition von diesem Flusse aus direkt nach Uhehe zu führen. Auf dem bisherigen Marsche waren die Mafiti nirgends angetroffen worden, sondern überall der marschierenden Truppe ausgewichen; bei Kilwa selbst fand man auch nur ein verlassenes Lager der Mafiti vor. Das Land der nördlichen Mahenge wurde passiert und mit diesen ein durchaus friedlicher Verkehr gepflogen. Aber auch da zeigte sich die Unzuverlässigkeit gerade dieser Stämme. Nachdem das Expeditionskorps kaum ihr Land verlassen hatte, benutzten sie die Gelegenheit zu einem Einfall nach Usaramo, in der Annahme, daß nun an der Küste nicht mehr genügend starke Kräfte vorhanden seien, um ihnen entgegenzutreten.
[S. 307]
Nach der Überschreitung des Rufidji war eine Zulukompagnie vom Expeditionskorps nach Daressalam zurückgeschickt worden, um für etwa notwendige Unterstützungen hier zur Verfügung zu stehen, und wurde der Weitermarsch mit nur drei Kompagnien vorgenommen. Vom Jomboflusse aus ging es mehr südlich nach Uhehe hinein. Die Wahehe, die nirgends einen ernstlichen Widerstand leisteten, wurden überall vertrieben und ihnen, da sie eben allerorten zurückwichen, die einzig mögliche Strafe durch Niederbrennung ihrer Tembes (befestigte Ortschaften) und Plünderung ihres Eigentums zu Teil.
Am 17. August ereilte die Expedition ihr unglückliches Schicksal. Als die Kolonne in der Gegend von Lula das in Uhehe häufig sehr coupierte und stark bewachsene Terrain passierte, wurde sie in ihrer ganzen Länge gleichzeitig von den nach Tausenden zählenden Wahehe-Horden, die auf dem Marsche einen Hinterhalt gelegt hatten, plötzlich überfallen, und gleich im Anfang des sich entspinnenden Gefechtes die meisten Europäer der Truppe, an ihrer Spitze der Kommandeur, niedergemacht. Insgesamt bedeckten die Leichen von 10 Europäern, 250 farbigen Soldaten und etwa 100 Trägern das Schlachtfeld.
Es wurde gleich zuerst bekannt, daß auch die Wahehe ungeheure Verluste, wie sie solche bis dahin noch nie gehabt, erlitten hätten, doch wurde dies zuerst wenig geglaubt, weil die näheren Umstände, unter denen die Schutztruppe überfallen war, es höchst zweifelhaft erscheinen ließen. Indes scheint es doch nach den einstimmigen Angaben der Wahehe, als müsse man die Zahl der auf ihrer Seite Gefallenen auf annähernd 900 annehmen; dem Verfasser will auch heute noch die angegebene Zahl ganz unglaublich scheinen.
Die gefallenen Offiziere waren der Kommandeur von Zelewski, die Lieutenants von Zitzewitz, von Pirch, Arzt Dr. Buschow, die Unteroffiziere Herrich, von Tiedewitz, Schmidt, Tiedemann, Hemprich und Büchsenmacher Hengelhaupt: ein nicht nur durch die große Zahl der Gefallenen, sondern insbesondere durch den persönlichen Wert und die in Afrika erwiesene außerordentliche Tüchtigkeit der einzelnen außerordentlich schmerzlicher Verlust für die Truppe.
[S. 308]
Von den verschiedensten Seiten ist behauptet worden, Kommandeur v. Zelewski trage die alleinige Schuld an dem Unglück, das ihn und seine Truppe betroffen; seiner nicht zu entschuldigenden Sorglosigkeit sei die Herbeiführung der Katastrophe zuzuschreiben. Es hat diese Beurteilung ihres Kommandeurs die Offiziere der Schutztruppe auf das schmerzlichste berührt, da gerade Herr v. Zelewski ein durch seine Umsicht und Vorsicht bekannter Offizier war. Bei den schwierigen Terrainverhältnissen der Landschaft Uhehe kann nicht der bei uns für Marschsicherung etc. geltende Maßstab auf die Expedition angelegt werden.
Das tiefe Eindringen der Expedition in die Landschaft Uhehe ist aus der Absicht des Expeditions-Führers zu erklären, die vorher auf der Expedition erlangten Vorteile über den räuberischen Stamm militärisch gründlich auszunutzen. Ob indes das vom rein militärischen Gesichtspunkt richtige weite Vordringen ins Innere auch politisch zweckmäßig war, bleibe dahingestellt. Zweifellos muß zugegeben werden, daß von Zelewski den Charakter der Mafitistämme, mit denen er früher nicht in Berührung gekommen war, nicht ganz erkannt hat. v. Zelewski war ausschließlich Soldat, das aber mit Leib und Seele, ebenso ein tüchtiger Organisator, als welcher er Wißmann speziell bei der Organisation der Truppe stets helfend zur Seite stand.
Die Reste der Expedition wurden durch den Lieutenant von Tettenborn, der auf dem Marsche die Arrieregarde kommandierte, und der beim Überfall selbst in das Gefecht nicht verwickelt wurde, zunächst nach Kondoa und von dort nach der Küste zurückgeführt. An Europäern waren der Katastrophe entgangen mit Herrn von Tettenborn Lieutenant v. Heydebreck, der im Gefecht selbst verwundet worden war, der Feldwebel Kay und der Unteroffizier Wutzer, dazu 64 farbige Soldaten, darunter die Offiziere Murgan Effendi und Gaber Effendi.
Da Herr von Heydebreck gleich anfangs durch einen erhaltenen Keulenschlag besinnungslos geworden war, fällt jenen beiden schwarzen Offizieren, — die übrigen Europäer hatten sich im eigentlichen Gefecht nicht befunden, — das Verdienst[S. 309] zu, mit den noch vorhandenen Truppen einen sehr energischen Widerstand geleistet zu haben. Von den Wahehe wird angegeben, daß gerade bei diesem Gefecht die Zulus sich ungemein schneidig benommen haben, die Gefallenen der Zulus hätten ihr Leben sehr teuer verkauft.
Leider verboten die Umstände dem ältesten Offizier der Expedition, Lieutenant von Tettenborn, bis in das Terrain, wo der Überfall stattgefunden hatte, mit dem intakten Rest der Truppe vorzudringen. Er mußte, um nicht Alles aufs Spiel zu setzen, sich auf die Besetzung einer Tembe vor der Unglücksstätte beschränken, wo er den angreifenden Wahehe erfolgreich Widerstand leistete, und die aus dem Überfall entkommenen Truppen um sich sammelte. Tettenborn übernahm alsdann die Leitung des Rückzugs nach der Küste, nachdem die Europäer und Soldaten hatten mitansehen müssen, wie die teuren gefallenen Kameraden unbestattet vor ihren Augen durch Anzünden des Grases verbrannt wurden. Die Geschütze — 2 Maxim-Guns und 1 4,7 cm Geschütz, — wie die Mehrzahl der Gewehre und Munition hatte man in den Händen der Gegner zurücklassen müssen.
Nach den zu uns gelangten Berichten haben die Wahehe, wie bereits erwähnt, bedeutende Verluste gehabt und ihre besten Krieger, auch einen Teil der Unterhäuptlinge, im Kampfe mit der Expedition verloren; von den letzteren soll außerdem der Oberhäuptling der Wahehe mehrere haben hinrichten lassen. Der Oberhäuptling befand sich nach der Katastrophe in steter Furcht vor einer Racheexpedition unsererseits und soll überhaupt den Überfall der Expedition, von dem er selbst keine Kenntnis gehabt haben will, nicht gebilligt haben.
Die Katastrophe wirkte auf die Soldaten der Schutztruppe ungemein demoralisierend und machte auch die Bewohner an der Küste übermütig. Die letzteren waren dem Gouverneur von Soden so wie so nicht wohlgesinnt: einmal wegen seiner Steuermaßregeln und dann, weil er der Bevölkerung, insbesondere den Großen derselben, nicht die ihnen sonst immer zu Teil werdende Beachtung schenkte und sich über die im Orient nun einmal üblichen Umgangsformen und Äußerlichkeiten hinwegsetzte; auf der andern Seite lavierte der[S. 310] Gouverneur mit den Eingeborenen häufig gerade an der unrechten Stelle.
Hätte nach der Katastrophe ein Rachezug mit der nötigen Macht, mit intakten oder nicht entmutigten Truppen gemacht werden können, wäre dies für uns außerordentlich günstig gewesen, aber leider war dies ausgeschlossen; es mußte erst eine Rekrutierung in der Truppe abgewartet werden.
Die Wahehe knüpften durch die Araber in Kondoa Friedensverhandlungen mit dem Gouverneur an und boten die Auslieferung der erbeuteten Kanonen, Gewehre und Munition an, sowie Zahlung einer Strafe in Elephantenzähnen und Rindvieh. Es wurde von einer Strafexpedition abgesehen; die Verhandlungen mit den Wahehe, bei welchen der Gouverneur durch den pater superior der Mission in Longa vertreten war, kamen aber nicht recht in den Gang, sodaß inzwischen einige der Mauser-Gewehre mit Munition von den Wahehe nach den verschiedensten Plätzen verkauft wurden und sogar bis auf den Markt nach Tabora kamen. Inzwischen schwoll den Arabern und Belutschen von Kondoa, die von jeher nicht gerade von der besten Sorte waren, der Kamm.
Der in Afrika wohlbewährte Lieutenant Prince, welcher zur Unterdrückung von etwa in Kondoa vorkommenden Unruhen daselbst mit einer Truppe von ca. 100 Mann sich befand, hatte mit dem Geologen Dr. Lieder, den er dort getroffen, die Absicht, auf die Einleitung von Friedensunterhandlungen von Seiten der Wahehe hin, nach dem Schauplatz der Zelewskischen Katastrophe abzumarschieren. Lieder hatte hinreichend Gelegenheit gehabt, die Mafitistämme im Norden wie im Süden kennen zu lernen; er wie Prince hatten das sehr richtige Gefühl, es müßten die Überreste der auf dem Kampfplatz gefallenen und verbrannten Europäer und Soldaten beerdigt werden. Sie verlangten daher von den Wahehe Stellung von Geißeln, damit sie mit ihrer Truppe die Aussicht hätten, sicher hin- und zurückzukommen, ebenso Stellung von Begleitmannschaften.
Die Herren wurden jedoch durch einen Befehl des Gouverneurs, der durch die Missionare zu verhandeln wünschte, an der Ausführung ihrer Absicht gehindert. Die Verhandlungen,[S. 311] welche der Gouverneur mit den Wahehe dann durch die Missionare angeknüpft hat, sind jetzt als gescheitert und wir als die Getäuschten zu betrachten. Es wird zwar angegeben, der Oberhäuptling der Wahehe wünsche ehrlich Frieden mit uns Deutschen zu halten, doch besteht das Faktum, daß er die geraubten Geschütze und Gewehre wie Munition zur Zeit noch nicht ausgeliefert hat. Es ist bei solchen Räuberstämmen, wie die Wahehe sind, überhaupt von vornherein falsch, zuviel auf Besprechungen und Betheuerungen zu geben. Die Grundlage, auf der die Herren Prince und Lieder verhandeln wollten, nämlich nach Stellung von Geißeln, war die einzig richtige. So aber ist unsere Würde bei den Verhandlungen nicht gewahrt worden, auch haben unsere braven Gefallenen in Uhehe noch kein christliches Grab erhalten!
Die Massai, die Erbfeinde der Wahehe, mit denen zuletzt der Stationschef von Mpapua, Lieutenant von Elpons, ein gutes Verhältnis erhalten hatte, baten diesen nach der Katastrophe um die Erlaubnis, nun ihrerseits über die Wahehe herfallen zu dürfen; von Elpons mußte ihnen jedoch seiner dringenden Instruktion vom Gouverneur gemäß diese Bitte abschlagen. —
Es sei gestattet, bei dieser Gelegenheit einiges über die Schwierigkeiten, die sich auf Expeditionen häufig darbieten, zu sagen. Wesentlich von Belang ist der Zweck der Expedition und das Verhältnis derselben gegenüber den Eingeborenen: ob diese die Expedition von vornherein als feindlich ansehen oder nicht. Bei den Expeditionen der Schutztruppe, soweit diese Straf-Expeditionen sind, oder zur Ausdehnung der Macht an Stellen dienen sollen, wo sich die eingeborene Bevölkerung selbständig zu halten sucht, tritt natürlich das Ziel der Expedition den Eingeborenen selbst als ein ihnen direkt feindliches vor Augen, und werden sie einer solchen Expedition nach Möglichkeit Schwierigkeiten im Vordringen entgegensetzen.
Anders ist es bei Expeditionen einfacher Reisender, die blos den Zweck haben, durch das Land zu marschieren, in demselben aber keinerlei Hoheitsrechte auszuüben. Für solche Expeditionen kann man sagen, daß je klarer den Eingeborenen[S. 312] das friedliche Ziel derselben vor Augen tritt, desto leichter das Vorwärtskommen der Expedition sein wird. Es kommt also oft vor, daß das Mitnehmen von einer geringen Menge von Soldaten oder überhaupt gar keiner Soldaten die Expedition ungemein erleichtert. So ist es auch erklärlich, daß Missions-Expeditionen und wissenschaftliche Expeditionen mit viel geringeren Mitteln als die Expeditionen unserer Schutztruppe ausgeführt werden können, da deren friedliche Bestrebungen im allgemeinen bekannt sind, wenngleich auch hier natürlich Ausnahmen von der Regel vorkommen. Denn auch solche Expeditionen leiden zuweilen unter der Raubsucht einzelner Häuptlinge oder deren Rachgier für irgend welche früheren Ereignisse.
Befassen wir uns hier indes nur mit den Expeditionen, wie sie von Seiten der Schutztruppe häufig nötig werden. Die Expeditionen richten sich zum Teil gegen Völkerstämme, die mit Gewehren, bei Beginn der Niederwerfung des Aufstandes sogar mit allen möglichen Hinterladergewehren und deren Munition reichlich versehen sind, zum Teil gegen Stämme, welche nur die einheimischen Waffen führen. Diese Waffen sind entweder Speere, nämlich ein großer Stoßspeer und mehrere kleine Wurfspeere, oder Bogen und Pfeile nebst Keulen, zuweilen beide Arten der Bewaffnung bei demselben Gegner, aber nie in der Hand eines Einzelnen vereinigt.
Es wird häufig angenommen, daß allein die Bewaffnung unserer Gegner mit Gewehren für uns nachteilig sei. Dies ist nicht immer der Fall, denn gerade die ausschließlich mit Speeren kämpfenden Völkerstämme sind in ganz Ostafrika unter den Eingeborenen die bei weitem gefürchtetsten. Sie verlassen sich nicht, wie die übrigen Eingeborenen, auf die Überlegenheit der Feuerwaffen, sondern ganz allein auf die Wucht ihres Angriffs und die Überlegenheit ihrer im Nahkampfe hervortretenden Persönlichkeit, wie sie auch stets durch größeren Mut vor andern Völkerstämmen ausgezeichnet sind. Auch sind gerade diese Stämme diejenigen, welche durch die Benutzung von Hinterhalten, durch Überfälle jeder Art bei Tag und bei Nacht, ihrem Gegner gefährlich zu werden suchen, und welche die größten Marsch- und sonstigen körperlichen Leistungen verrichten.
[S. 313]
Es soll damit nicht gesagt sein, daß es unter den Gewehrkriegern nicht auch vorzüglich organisierte Scharen gäbe. Solche sind z. B. im Süden die Wahiyao Maschembas und andere, die während des Aufstandes durch die fortwährenden Kämpfe mit uns klug geworden sind und namentlich, wie früher Bana Heri mit seinen Leuten, die Ausnutzung des Terrains uns gegenüber gelernt haben. Sie haben mit der Zeit erfahren, daß sie auch in gut befestigten Stellungen uns auf die Dauer nicht zu widerstehen vermögen, sondern daß ihre Stärke uns gegenüber gerade der dichte afrikanische Busch ist. In diesem Busch liegt für uns die Hauptgefahr, wofern er nicht überall so undurchdringlich ist, daß auch unsern leichter beweglichen Gegnern die Benutzung desselben zu unserm Nachteil unmöglich gemacht wird. Auf den Märschen unserer Expeditionen können ja bekanntlich nur die schmalen Fußstege benutzt werden, von denen die hauptsächlichsten die Karawanenstraßen sind.
Das Terrain zu den Seiten dieser Wege ist je nach der Jahreszeit und der Örtlichkeit mit mehr oder weniger hohem und dichtem, trocknem oder grünem, zuweilen doppelt mannshohem Grase bewachsen, teils von dem afrikanischen Busch durchzogen, mit Mimosen und Lianen bestanden, und bietet so ein recht bedeutendes Bewegungshindernis wenigstens für uns und für unsere mit Gepäck versehenen, mit Munition, Ausrüstungs- und Montierungsstücken belasteten Soldaten.
Eine andere Art der Bewachsung, wie solche sich fast überall im nördlichen Mahenge, in Uhehe, Ugogo und im größten Teil des Hinterlandes unseres südlichen Küstengebietes befindet, besteht aus völlig undurchdringlichem Dickicht. Zuweilen sind dann selbst die schmalen Fußpfade sehr schwer, besonders von Lastträgern, zu passieren. Man muß sich ohne Gepäck entweder bücken, oder sogar kriechen, nur um überhaupt fortzukommen. Die Fußpfade schlängeln sich von rechts nach links, vorwärts und wieder rückwärts, so daß es in solchem Terrain ungeheuer schwer ist, nur die allgemeine Marschrichtung im Auge zu behalten. Hier ist eine Sicherung natürlich gänzlich ausgeschlossen; doch bietet uns da die Eigenart des Terrains selbst einen natürlichen Schutz. Von speerkämpfenden Stämmen droht uns auf dem Marsche durch solches Gebiet[S. 314] keine Gefahr, unter Umständen dagegen von Büchsenkämpfern. Diesen ist natürlich immer ihr Land mit allen seinen Seitenpfaden besser bekannt als uns, sie können etwaige in diesem Terrain vorhandene Blößen geschickt benutzen, wie sie dies auch thatsächlich verstanden haben. Sie setzten des öfteren durch ein plötzliches, unerwartetes Schnellfeuer die Truppe in Verwirrung und brachten ihr Verluste bei.
Auf solchen sich lang hinziehenden Märschen hat der Führer selbst wenig Gelegenheit und Möglichkeit einzugreifen, es liegt dann alles in der Hand der Unterführer, speziell der einzelnen Zugführer. Man wird dann häufig gut thun, das Feuer, wenn es kein ernstlich anhaltendes ist, ganz zu ignorieren, um nicht unnütz gegen einen unsichtbaren Feind Munition zu verschwenden; ist man indes genötigt, ein anhaltendes Feuer zu erwidern, so kann gerade in solchem Terrain auf den unregelmäßig sich dahinziehenden Pfaden die eigene Truppe durch eine abgegebene Salve stark gefährdet werden. Man wird, wie erwähnt, die Marschrichtung in vielen Fällen nicht genau kennen, und unter Umständen einen davor oder dahinter marschierenden Teil der Truppe, der sich im Holze in einer Wegekrümmung gerade in der Schußlinie befindet, durch das Schießen in Gefahr bringen. Im übrigen findet eine Sicherung auf dem Marsch unserer Expeditionen stets durch die Voraussendung einer Spitze oder mehr oder minder großen Avantgarde je nach den Verhältnissen statt. Nach vorn ist unter allen Umständen eine Sicherung möglich.
Ein weiteres bedeutendes Sicherungsmittel erblickt der Verfasser in der Mitnahme eines Maxim-Guns, vorausgesetzt, daß zur Bedienung desselben, — welches ja für Ostafrika den entschiedenen Nachteil der Komplikation in seinem System hat, — ein Techniker zur Verfügung steht. Wenn das Maxim-Gun ziemlich an der Tête der Kolonne, gedeckt etwa durch einen Trupp von 20 vor demselben marschierenden Leuten, getragen wird, so ist es im Augenblick zusammenzusetzen, und gestattet dann eine recht schnelle und intensive Feuerwirkung. Nach vorn hin auf dem einfachen schmalen Fußstege, wo die Entfaltung einer breiten Front unmöglich ist, ersetzt es reichlich die Feuerwirkung einer Kompagnie und vermag ebenso auch[S. 315] nach allen Seiten ein intensives Feuer abzugeben. Bezüglich der sonst mitzuführenden Artillerie schlägt der Verfasser 3,7 cm Geschütze wegen des geringen Gewichts, der Leichtigkeit des Transportes und der genügenden Feuerwirkung vor.
Zu bedenken ist, daß bei größeren Expeditionen der Mitnahme von Patronen wegen der großen Zahl der erforderlichen Träger doch ein Maß gesetzt ist, obgleich ja unsere Soldaten je nach den Verhältnissen immerhin 100-150 Patronen, teils eingenäht in ihre Patronentaschen, teils im Tornister oder Brotbeutel bei sich tragen. Es muß einem leichtsinnigen Patronenverbrauch auf Expeditionen aufs entschiedenste vorgebeugt werden und sind die Soldaten hierin aufs Strengste zu kontrolieren. Eine Sicherung, wie sie von einer Seite vorgeschlagen worden ist: daß man in unübersichtliches coupiertes Terrain der Kontrolle halber Salven hereinschießen läßt, ist schon aus diesem Grunde ausgeschlossen.
Eine weitere Sicherung wird zwar — außer in der erwähnten dritten, besonders coupierten und bewachsenen Art des Terrains — möglich, aber fast immer schwierig sein, nämlich eine Sicherung durch Seitenpatrouillen. Abseits des Weges ergeben sich für die seitlich detachierten Truppen oder die Seitenpatrouillen weit bedeutendere Hindernisse, als für das den Weg benutzende Gros. Man kommt daher, wenn die Seiten-Detachements oder -Patrouillen nicht seitlich hinter der Truppe zurückbleiben und somit ganz ihren Zweck verfehlen sollen, in die Notwendigkeit, das Marschtempo der Truppe bedeutend zu verkürzen. Hierdurch verzögert sich der Marsch einer Expedition sehr erheblich, das Seitendetachement wird stark ermüdet, der Marsch von Expeditionen, die sonst die Dauer einiger Wochen in Anspruch nehmen, erfordert eine unendlich längere Zeit für ihre Durchführung, und kosten die Expeditionen demgemäß viel mehr Geld und Anstrengung. Es ergiebt sich hieraus als praktisch, diese Seitensicherung in solchem Terrain nur dann eintreten zu lassen, wenn sie unbedingt nötig erscheint. Da unsere Expeditionen sich übrigens häufig durch Gegenden bewegen, wo man absolut vor Überfällen sicher ist, wäre es eine Zeit- und Geldvergeudung, mit solchen komplizierten Sicherheitsmaßregeln zu marschieren.
[S. 316]
Natürlich ist, besonders in Feindesland und in unsicheren Gegenden, jeder sich seiner Verantwortung bewußte Führer verpflichtet, alle möglichen Vorsichtsmaßregeln anzuwenden. Beurteilen zu können, wo und wann diese Vorsichtsmaßregeln nötig sind, muß unbedingt vom Führer einer Expedition verlangt werden. Er wird auch stets dazu in der Lage sein, namentlich wenn er es versteht, sich geeignete Vertrauensleute zu halten, welche Fühlung mit den Bewohnern der von ihm durchzogenen Gebiete haben. Hat der Führer solche Leute zur Hand, und das muß er haben, so hat er durch sie eine ganz wesentliche Garantie für die Sicherheit des Marsches.
Eine ebenfalls große Sicherheit bieten irreguläre Truppen aus den Eingeborenen selbst, welche die Expedition begleiten. Solche werden bei den ostafrikanischen Verhältnissen, speziell bei der zwischen den einzelnen Stämmen bestehenden Feindschaft, in der Regel zu haben sein. Sie sind besonders gut am Tage zum Aufklärungs-und Patrouillendienst jeder Art zu verwenden, auch zu detachieren, und kommen hervorragend gegen die Mafiti in Betracht, welche besonders, wie schon erwähnt, durch ihre ungeheure Elastizität, große Beweglichkeit und ihre Marschleistungen uns gefährlich werden. Die Mafiti sind, soweit dem Verfasser bekannt ist, in Ostafrika die einzigen Krieger, welche das leicht bewachsene Terrain seitwärts der Wege ohne Rücksicht auf diese in breiter Kolonne, häufig im Laufschritt, durchschreiten und so in der Lage sind, plötzlich und mit großer Wucht in Frontbreite aufzutreten. Beim Bivouak kann eine große Zahl Irregulärer dadurch wesentlich zur Sicherung unseres kostbaren Soldatenmaterials beitragen, daß man um das in der Regel im Kreise oder sonst in einer dem Terrain angepaßten Form errichtete Lager der eigentlichen regulären Expeditionstruppen in weiterem Umkreise die irregulären ein Lager beziehen läßt, gewissermaßen als dichte nächste Postenkette; dieses Lager wird wiederum in noch weiterem Umkreise durch mehr oder weniger dichte Vorposten der Truppe gesichert.
Das Alarmieren bei Nacht wird selbstverständlich für solche Zwecke besonders eingeübt. Ein Feuergefecht aus dem Lager heraus zur Nachtzeit ist indes, soweit angängig, zu[S. 317] vermeiden und namentlich nicht auf das Schießen einzelner Gegner, die keinen oder wenig Schaden anrichten, allgemein aufzunehmen.
Für eine marschierende Truppe liegt ferner ein großer Nachteil in der Unzuverlässigkeit der angenommenen Träger, die häufig ihre Lasten wegwerfen und durch Flucht Unordnung und Bestürzung in die Expedition bringen. Bei der Notwendigkeit, häufiger Expeditionen zu unternehmen, würde die Ausbildung ordentlicher bewaffneter Trägerkolonnen, die auch zugleich als Arbeiter auf den Stationen dienen könnten, nützlich sein.
Ein von Herrn von Zelewski gemachter Versuch, die Träger zum Teil wenigstens durch Lasttiere zu ersetzen, nämlich für den Transport des für Kriegszwecke notwendigsten Materiales an Geschützteilen und Munition für die Geschütze, das Maxim-Gun und Gewehrmunition, ist als gescheitert zu betrachten. Zwar kann man rechnen, daß ein Esel zwei Trägerlasten bei entsprechender praktischer Verpackung auf sich nimmt, doch erfordern, wenn die Expedition nicht gar zu sehr aufgehalten und die Ordnung gewahrt sein soll, immerhin zwei Esel einen Treiber, und erweist sich, wie man bei der Zelewskischen Katastrophe gesehen hat, im kritischen Moment diese Art als unpraktisch, da die Tiere scheu werden, durcheinander rennen und Unordnung in die Kolonne bringen. —
Es mögen nun noch die anderen unter dem Gouvernement im Jahre 1891 unternommenen Expeditionen kurz Erwähnung finden.
Im nördlichen Nguru vorgekommene Unruhen und Belästigungen der Eingeborenen durch Wakuafi und Massai machten ein Einschreiten von unserer Seite notwendig. Der Verfasser unternahm daher im Juni vorigen Jahres, da das in Frage kommende Gebiet zum Hinterlande seines Bezirkes gehörte, eine Expedition durch Usegua, Nguru und Usagara, durch welche es gelang, ein vollkommen friedliches Verhältnis mit den Eingeborenen herzustellen und auch die räuberischen Wakuafi zur Vernunft zu bringen. Ebenso wurde die vorher bedroht erscheinende französische Missionsstation in Nguru, Mhonda, vollkommen sicher gestellt.
[S. 318]
Nicht von geringem Nutzen war bei dieser Expedition die Hülfe Bana Heris, dessen Einfluß auf die Eingeborenen sich der Verfasser zu nutze gemacht hatte, und dessen Sohn Abdallah ebenso wie der des öfteren erwähnte Jumbe Makanda von Bagamoyo auf der Expedition mitgenommen wurden. Der früher bereits öfters angeführte Jehasi war bei den Streitigkeiten der Wanguru mit den Wakuafi bei Einnahme einer Wakuafi-Tembe gefallen.
Bereits im Juli war der Verfasser von dieser Expedition nach Bagamoyo zurückgekehrt und führte in dieser Zeit teils die Bezirksgeschäfte in Bagamoyo, teils vertrat er den auf der Wahehe-Expedition sich befindenden Kommandeur v. Zelewski in Daressalam. Da machte sich durch inzwischen erfolgte Einfälle der nördlichen Mafiti nach Usaramo die Unternehmung einer Expedition gegen diese zur Sicherung der gefährdeten Wasaramo notwendig. Alle an der Küste noch disponiblen Truppen wurden vereinigt, die vom Kommandeur zurückgeschickte Zulu-Kompagnie, sowie aus Pangani, Bagamoyo und Daressalam herausgenommene Truppen wurden in Bagamoyo als Expeditionskorps zusammengezogen, und der Verfasser unternahm mit den Offizieren, Kompagnieführer End und Lieutenant Prince, wie dem Arzt Dr. Kanzki die erwähnte Expedition. Dieselbe durchzog zunächst Usaramo in südwestlicher Richtung nach Tununguo hin, wo fast alle Dörfer aus Furcht vor den Mafiti verlassen waren, außerdem beredte Zeugnisse für die Grausamkeiten der Mafiti, wie sie in diesem Buche gelegentlich der Erwähnung des Mafiti-Einfalls im Jahre 1889 bereits geschildert sind, gefunden wurden. Sodann wurde der Kingani bei Mafiti überschritten und nach der Missions-Station Tununguo marschiert. Von dort aus richtete sich der Marsch direkt ins Land der nördlichen Mahenge, welche große Komplexe von Kutu occupiert haben und die Wakutu in großer Abhängigkeit von sich halten. Die Bestrafung der Mafiti war für die Expedition nicht so bequem wie vor zwei Jahren, wo das Eingreifen Gravenreuths nur 5 Stunden von Bagamoyo nothwendig war. In ihrem Lande wurden die Mafiti nur im Dorfe Korongo angetroffen, doch räumten sie auch diesen Ort nach dem vollständig überraschenden[S. 319] Eintreffen der Expedition bald nach Eröffnung des Feuers. Im übrigen zogen es die Mafiti vor, uns überall auszuweichen. Für die Expedition lag die Gefahr nahe, daß das ungemein coupierte, für uns selbst auf den schmalen Fußstegen nur schwer zu passierende Terrain von den gewandten leichtfüßigen Mafitis zu einem Überfall gegen uns benutzt werden könnte. Wir mußten uns daher, so gut es ging, gegen Überraschungen sichern.
In Hongo fanden wir eine Anzahl der von den Mafiti gefangenen Wasaramo noch vor und setzten dieselben in Freiheit. Im übrigen beschränkte sich der Verfasser darauf, den Mahenge in ihrem Lande, wo sie ebenfalls überall zurückwichen, die einzig mögliche Strafe zu teil werden zu lassen, nämlich sie an ihrem Hab und Gut nach Kräften zu schädigen. Es wurden alle Ortschaften niedergebrannt, die überaus reichlich daselbst vorgefundenen Vorräte, soweit wir sie nicht aufbrauchen und mit uns führen konnten, den Flammen preisgegeben, und die reichen, wohlbestellten Felder der Eingeborenen, soweit es in der kurzen Zeit möglich war, durch uns und die eingeborenen Hülfsvölker, — welche besonders der Häuptling Kingo von Morogro und einzelne andere mächtige Häuptlinge in der Zahl von mehreren Hundert Mann der Expedition gestellt hatten, — verwüstet.
Diese grausame Art der Bestrafung ist bei eingeborenen Gegnern, die man auf andere Weise nicht fassen kann, leider notwendig, und sie ist den Eingeborenen auf die Dauer fühlbarer, als selbst erhebliche, ihnen im offenen Kampfe beigebrachte Verluste an Menschenleben, die sie mit der Zeit viel eher verschmerzen. Aber auch der Vermögensverlust übt einen sehr lange anhaltenden Einfluß bei einem so gewohnheitsmäßigen Räubergesindel, wie die Mafiti sind, nicht aus. Es wurde daher vom Verfasser bereits als wirksames Mittel die Anlage einer Station in der Landschaft Kisaki vorgeschlagen, die jetzt in Angriff genommen ist.
Es sei hier bemerkt, daß vielleicht in späterer Zeit gerade das jetzt verrufene Mafitiland für unsere Kolonie eine größere Rolle spielen wird. Wir haben im Kutuland einen der fruchtbarsten und bestbewässertsten Distrikte unseres Gebietes, der[S. 320] in jeder Hinsicht die reichsten Ernten liefert. Dann aber lehnen sich hier die Sedimentärformationen an den Gneis der Uruguruberge an. Dort ist nach dem Urteil des Herrn Dr. Lieder, der einen großen Teil der Gebiete Deutsch-Ostafrikas geologisch erforscht hat und den der Verfasser damals in Uruguru (Teil von Kutu, an das Mafitiland grenzend) traf, das Vorkommen von nutzbaren Mineralien im höchsten Grade wahrscheinlich, deren Transport zur Küste keine Schwierigkeiten machen würde. —
Von der Expedition nach Bagamoyo zurückgekehrt, erfuhr der Verfasser die Trauernachricht von der Katastrophe in Uhehe. Abgesehen von einer nach der Katastrophe abgesandten Rekognoszierungs-Expedition nach Mpapua unter Lieutenant Prince fanden keine weiteren Expeditionen der Schutztruppe ins Innere im Bezirk von Bagamoyo und den weiter südlichen Bezirken statt, im Hinterland von Tanga dagegen wurde das Einschreiten des Bezirkshauptmanns Krenzler durch eine unter den Wadigo vorgekommene Erhebung notwendig.
Gerade der Umstand, daß unter einem bisher so wenig kriegerischen, geradezu für erbärmlich geltenden Stamme, wie die Wadigo, eine Erhebung gegen die deutsche Herrschaft vorgekommen war, war kein günstiges Zeichen und machte ein schleuniges Einschreiten notwendig. Die erste zu diesem Zweck vom Bezirkshauptmann Krenzler unternommene Expedition verlief ungünstig, da sich die Expedition wieder nach der Station Tanga zurückziehen mußte. Eine zweite stärkere, ebenfalls von dem bald darauf am perniziösen Fieber verstorbenen, um die Entwickelung von Tanga hoch verdienten Hauptmann Krenzler geführte Expedition bewirkte die Wiederunterwerfung der Wadigo.
Andere Kämpfe hatte am Kilimandscharo der dortige Reichskommissar zur Verfügung des Gouverneurs, Dr. Karl Peters, der als Wirkungskreis das Kilimandscharo-Gebiet erhalten hatte, zu bestehen. Nachdem Peters zunächst die Station Moschi mit der 9. Kompagnie der Schutztruppe unter Kompagnieführer Johannes erreicht hatte, ging er von dort aus weiter nach Osten, um hier eine neue nach seiner Ansicht notwendigere Stations-Anlage zu schaffen. Hierfür wurde Marangu, der Sitz des unbedeutenden Sultans Mareale, ausgesucht und[S. 321] der daselbst von Peters gegründeten Station der Name Kilimandscharo-Station beigelegt. Bei einer von dort mit einem Teil der Besatzungs-Kompagnie gegen die Warombo unternommenen Expedition fiel der Sergeant Schubert von der Schutztruppe, doch gelang es Peters, den Stamm, der sich nicht unterwerfen wollte, zu strafen und unter die deutsche Herrschaft zu bringen. — In späterer Zeit fand Dr. Peters Verwendung als deutscher Kommissar bei der an unserer nördlichen Grenze vorgenommenen Grenzregulierung gegen das englische Gebiet.
Nach der Katastrophe in Uhehe und der Rückkehr der Reste der Expedition unter Tettenborn war durch die großen Verluste der Schutztruppe eine vorläufige Umänderung in der Organisation derselben geboten. Auf telegraphischem Wege gelangte eine Allerhöchste Kabinets-Ordre nach Ostafrika, nach welcher der Gouverneur zugleich das Kommando der Schutztruppe bis auf weiteres übernehmen sollte. Da der Gouverneur jedoch nicht selbst Offizier war und daher eines sachkundigen Beistandes bedurfte, wählte er hierzu den Verfasser, der als militärischer Beirat nach Daressalam überzusiedeln hatte. Die Maßregeln, welche vom Gouverneur teils mit, teils ohne Einverständnis mit dem militärischen Beirat getroffen wurden, sind mehr innerer Natur und bereiteten die spätere Änderung in der Organisation der Truppe vor. In der äußeren Organisation wurden, — abgesehen von einer durch den Verfasser vorbereiteten Umgestaltung der Expeditions-Artillerie, die dann wieder fallen gelassen wurde, — die Reste der 6., 7. und 9. Kompagnie mit denen der 5., 8. und 10. vereinigt, so daß die Schutztruppe nur noch 7 Kompagnien aufzuweisen hatte, die durch Rekrutierung zu ergänzen waren. Diese Ergänzung wurde noch besonders nötig, da auch ein Teil der alten sudanesischen Soldaten sich entweder nicht mehr als dienstfähig erwies oder die Erlaubnis zur Rückkehr nach Egypten erbat, und da auch die Zulus erklärten, nach Ablauf ihres dreijährigen Kontrakt-Verhältnisses nicht mehr im Dienst bleiben zu wollen.
Die Neuergänzungen sind von Major v. Wißmann in Egypten und Kompagnieführer von Perbandt um Massaua herum, endlich im Gebiet der Zulus von Inhambane aus vorgenommen worden, aber man erhielt nicht die erwünschte Zahl,[S. 322] da die Rekrutierung bei den Zulus, auf deren Gelingen man bestimmt gerechnet hatte, vollkommen scheiterte. Die Zulus, wird ferner gesagt, würden sich entschieden weigern, über ihre Verpflichtung hinaus, in der Schutztruppe zu verbleiben; es thut daher auf das dringendste not, sich nach anderem Material umzusehen.
Sehr zu wünschen wäre die endliche definitive Herbeiführung einer Organisation der Artillerie, so zwar, daß unsere hiesigen Feldgeschütze als Positionsgeschütze auf den Küstenstationen, die 4,7 cm für die Stationen des Innern, und 3,7 cm und Maxim-Guns für die Expeditions-Artillerie dienen. Vor der Hand hat man darin noch gar keine Organisation.
Der älteste Offizier der Kaiserlichen Schutztruppe, der des öfteren in den früheren Kapiteln erwähnt worden ist, zuletzt als Stellvertreter des Kaiserlichen Reichskommissars, Dr. Karl Wilhelm Schmidt, hatte die Oberführerstelle in der Truppe, d. i. die zweite Stabsoffizierstelle erhalten. Man hatte in der Truppe geglaubt, daß entweder der Oberführer, dessen Rückkehr nach längerem Urlaub in Deutschland im Oktober vorigen Jahres erfolgte, zum Kommandeur der Kaiserlichen Schutztruppe ernannt werden, oder daß ein hierzu geeigneter deutscher Stabsoffizier als Kommandeur herausgesandt werden würde. Das letztere wäre wohl möglich gewesen, da die Stelle des Kommandeurs der Schutztruppe eigentlich der Hauptsache nach eine Verwaltungs-Stellung ist und ihm die Fürsorge für das Offizier-Korps obliegt. Andererseits konnte sich ja zur Ausübung des praktisch-afrikanischen Dienstes der Kommandeur an die erfahrenen Wißmannschen Offiziere halten. Die Heraussendung eines Stabsoffiziers hätte also, wenn man dem Dr. Schmidt trotz seiner zweifellos auch großen militärischen Verdienste, — wir erwähnen bloß die Gefangennahme Buschiris, — das Kommando der Schutztruppe etwa prinzipiell nicht übertragen wollte, eine Enttäuschung im Offizierkorps nicht veranlaßt. Die Stelle des Verfassers als militärischer Beirat des Gouverneurs war von vornherein eine durchaus unhaltbare, da derselbe zwar mit dem Kommando der Schutztruppe im Namen des Gouverneurs beauftragt war, er der Anciennität nach aber im Offizier-Korps der Schutztruppe erst[S. 323] der viertälteste Offizier war. Dazu kam noch die Verschiedenartigkeit der Ansichten des Gouverneurs und des Verfassers. Der zwischen beiden hervortretende prinzipielle Gegensatz veranlaßte denn auch bald eine Änderung, so daß nach einem zwischen Daressalam und Berlin gepflogenen Depeschenwechsel der Kommandant des Kreuzers »Schwalbe«, Korvettenkapitän Rüdiger von dem Kommando der »Schwalbe« entbunden und zum Stellvertreter des Gouverneurs ernannt wurde. Von diesem erhielt Rüdiger insbesondere auch seine, des Gouverneurs Vertretung im Kommando der Schutztruppe, und die Geschäfte wurden vom Verfasser dem Herrn Kapitän Rüdiger übergeben. Rüdiger war zwar in afrikanischen Festlandsangelegenheiten gänzlich unerfahren, brachte aber ein großes Interesse unserer Kolonie entgegen und hat sich mit größtem Eifer seinem neuen Amt gewidmet.
Der Verfasser, der als Beirat mit dem Gouverneur nur dann ersprießlich zusammenwirken konnte, wenn Übereinstimmung in den Ansichten herrschte, kehrte zunächst als Bezirkshauptmann nach Bagamoyo zurück, aber sein Gesundheits-Zustand, besonders die seit der letzten Expedition immer wiederkehrenden heftigen Erkrankungen an Malaria boten neben den inneren Gründen die äußere Veranlagung für eine zweimonatliche Beurlaubung nach Egypten zur Erholung. Dort angekommen wurde dem Verfasser nach dem Tode Gravenreuths in Kamerun die Übernahme der Gravenreuthschen Expedition telegraphisch angeboten. Er nahm dieselbe an und wurde telegraphisch nach Berlin befohlen. Hier machten jedoch wiederum Gesundheitsrücksichten seine Abreise nach Kamerun unmöglich, sodaß der ebenfalls nach Deutschland beurlaubte Kompagnie-Führer Ramsay die Führung der Expedition erhielt, während der Verfasser im Februar 1892 nach Ablauf seines Kommandos bei der Schutztruppe auf den beim Reichskanzler eingebrachten Antrag des Gouverneurs aus der Schutztruppe ausschied.
Das letzte Jahr riß auch außerdem große Lücken in den Reihen der früheren Offiziere Wißmanns; von den im Frühjahr 1889 herausgegangenen Offizieren gehören zur Zeit nur noch folgende Herren der Schutztruppe an:
[S. 324]
Frhr. v. Eberstein, Leue, Johannes, von Perbandt, von Sivers (dieser war als Fachmann unter Wißmann stets nur zur See verwandt worden); von den später eingetretenen Offizieren der früheren Wißmannschen Schutztruppe sind noch im Verbande der Kaiserlichen Schutztruppe die Herren Fischer, Langheld, Herrmann, Scherner, Podlech, von Elpons, Prince.
Von den Ressortchefs ist einer an der Spitze seines Ressorts verblieben, Oberarzt Dr. Becker, der Chef des Sanitätswesens in Ostafrika.
Die Oberführerstelle in der Kaiserlichen Schutztruppe ist in neuerer Zeit auf den seit einem Jahr in Ostafrika an anderer Stelle thätig gewesenen Major Frhr. v. Manteuffel übergegangen.
Es mögen noch die Veränderungen in der Organisation der Schutztruppe Erwähnung finden, welche innerhalb der letzten Zeit stattgefunden haben und mit dem 1. März in Kraft traten.
Die Kaiserliche Schutztruppe wurde in die eigentliche Schutztruppe und eine Polizeitruppe geteilt, von denen die erstere zur Besetzung der Stationen im Innern und zur Begründung neuer Stationen, ferner zu Expeditionszwecken, die letztere zur Besetzung und Aufrechterhaltung der Ordnung an der Küste dient.
Der Etat für die Kaiserliche Schutztruppe bezog sich nicht auf diese allein, sondern auch auf die Polizeitruppe, einschließlich des europäischen Personals derselben, soweit dies aus der Kaiserlichen Schutztruppe entnommen war. Die Stärke der Polizeitruppe, deren Mannschaften aus der Kaiserlichen Schutztruppe entnommen wurden, betrug 405 Mann, die sich auf die Bezirke nunmehr in folgender Weise verteilten: Bezirksamt Tanga mit dem Bezirks-Nebenamt Pangani 100 Mann; Bagamoyo, dessen Nebenamt Sadani in gleicher Weise wie im Süden Mikindani vom Gouverneur aufgehoben und in eine einfache Zollstation verwandelt war, 95; Daressalam 45; Kilwa 85; Mgau 80 Mann.
Die den Bezirksämtern vorstehenden Bezirkshauptleute und der Vorsteher des Nebenamtes Pangani sollten ursprünglich aus dem Offizierbestande der kaiserlichen Schutztruppe entnommen[S. 325] werden und ebenso wie die ihnen beigegebenen europäischen Unteroffiziere als zur Übernahme einer Zivilstelle abkommandierte Militärpersonen gelten. Sie sollten in disciplinarer Beziehung aus dem militärischen Befehlsbereich der kaiserlichen Schutztruppe ausscheiden und allein dem kaiserlichen Gouverneur unterstehen. Diese Anordnung ist zweifellos als ein Fortschritt zu bezeichnen, da hiermit der vorher erwähnte Mißstand der doppelten Unterordnung derselben Personen wenigstens in den meisten Beziehungen aufhört.
Für notwendige kriegerische Operationen an der Küste, für die die Polizeitruppe zu schwach ist, wurden Bestimmungen über das Zusammenarbeiten der kaiserlichen Schutztruppe und der Polizeitruppe getroffen. Aber gerade wegen der zur Zeit noch lange nicht genügenden Stabilität in den ostafrikanischen Verhältnissen, selbst an der Küste, erscheint dem Verfasser eine derartige Vermischung der civilen mit der militärischen Ordnung noch verfrüht. Gewiß würde eine rein militärische Organisation vorzuziehen sein, wie sie zu Wißmanns Zeiten bestand, wo allerdings nicht nur gediente Militärs, sondern auch örtlich erfahrene, brauchbare Personen als Offiziere, Unteroffiziere und Beamte in die Schutztruppe eingestellt wurden. Letzteres mag den für eine kaiserliche Truppe geltenden Normen widersprechen, aber es ist in Ostafrika, wo außergewöhnliche Verhältnisse herrschen, zur Zeit angebracht.
Die eigentliche Schutztruppe wurde durch die erwähnte Verfügung nach Ausscheidung der Polizeitruppe in 6 Kompagnien eingeteilt, hierunter 2 Zulukompagnien (die Entladung sämtlicher Zulus nach Ablauf ihres Kontraktes steht wohl nahe bevor) und 4 Sudanesen-Kompagnien. In die letzteren wurden zum Teil auch eingeborene Soldaten mit eingestellt. Die erste dieser Sudanesen-Kompagnien dient für die Besatzung des Kilimandscharo-Gebietes und der nördlichen Karawanenstraße bis Masinde. Diese Kompagnie soll eine neue Station bei Gonja begründen und das Gros derselben soll daselbst garnisoniert werden. Die zweite Kompagnie hat ihren Stamm in Bagamoyo und giebt die Besatzung für Tabora und die Stationen am Viktoriasee ab. Die erwähnten Stationen des Innern sollten sich nebenbei durch Anwerbung von Eingeborenen[S. 326] verstärken. Die dritte Kompagnie (Zulukompagnie) dient für die Besatzung der neu begründeten Station Kilossa und der Station Mpapua mit dem Stabe in Kilossa; die vierte Kompagnie (Sudanesen-Kompagnie) besetzt die neubegründete Station Kisaki; die fünfte Kompagnie dient als Bereitschafts-Kompagnie für den Süden mit dem Stabsquartier in Kilwa und einem Unteroffizier-Posten in Lindi; die sechste Kompagnie (Zulukompagnie) als Bereitschafts-Kompagnie im Norden mit dem Stabsquartier in Daressalam.
Ferner sind noch 50 Mann der Schutztruppe unter Lieutenant Graf von Hessenstein nach Ugogo abmarschiert, um dort am Sitz des Oberhäuptlings eine Station zu gründen; von Kilossa und Kisaki aus will man noch Nebenstationen begründen. Die Besetzung resp. die Neubesetzung von Stationen im Innern ist, zunächst im allgemeinen betrachtet, sehr erwünscht und trägt, wenn die Stationen stark besetzt sind, einem entschiedenen Bedürfnis Rechnung. Die Stationen sind an grade für den Verkehr höchst wichtigen Plätze angelegt und dienen, — aber immer unter der Voraussetzung, daß sie genügend stark sind, — alsdann gegen die erfahrungsgemäß fast alljährlich wiederkehrenden kriegerischen Einfälle der Räuberstämme.
Trotzdem erscheint uns unter den bestehenden Verhältnissen diese Verteilung der Schutztruppe und die Begründung so vieler Stationen im Innern zur Zeit nicht angebracht; denn durch die Einrichtung eines Stationsgürtels im Innern ist allerdings der Lieblingsgedanke des Gouverneurs, die Schutztruppe nach Möglichkeit von sich zu entfernen, durchgeführt worden, aber man ist nicht mehr so wie früher in der Lage, ein starkes Expeditionskorps schnell zu formieren, um es an bedrohter Stelle einzusetzen.
Der Gouverneur von Soden ist der Ansicht, daß 4 Kompagnien farbiger Soldaten, die auf einzelne Plätze des Innern verteilt sind, eine Macht darstellen, welche die über 90 deutsche Meilen lange Küste oder wenigstens deren nördliche Hälfte sichern kann. Die älteren Offiziere der Schutztruppe haben sich bewogen gefühlt, auf die Gefahr einer solchen Zersplitterung der Kräfte, wie sie das neue System mit sich brachte, hinzuweisen, doch ihre Bedenken sind ungehört[S. 327] geblieben; im Gegenteil, man dürfte es ihnen zum Teil vielleicht verargt haben und sie es haben empfinden lassen, daß sie als subalterne Offiziere ihre Überzeugung frei ausgesprochen haben, im Interesse einer Sache, für die sie Leben und Gesundheit einsetzten.
Bei der geringen Stärke der Besatzungen unserer neuangelegten Stationen reicht die Macht derselben, gerade wenn man den Charakter der Mafiti- und Massai-Stämme in Rechnung zieht, nicht weit. Wenn wir Kisaki als Beispiel nehmen, so kann im günstigen Falle durch diese Station die östlich gelegene Missionsstation Tununguo, auch allenfalls die Karawanenstraße am Gerengere gesichert werden. Doch sind immerhin noch Einfälle der Mafiti von der andern Rufidji-Seite her ins südliche Usaramo möglich, von wo aus sie weiter nach der Küste hin vordringen können. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den andern Stationen in Kilossa und am Kilimandscharo, und dann ist, wenn Beunruhigungen an der Küste durch die erwähnten Stämme in größerem Maße stattfinden, das zur Verfügung stehende Expeditionskorps aus den beiden Bereitschafts-Kompagnien unter Umständen viel zu schwach, um namentlich, wenn es sich um ein Eingreifen in entferntere Gegenden handelt, mit Nachdruck aufzutreten; auch sind ja Niederlagen im Innern gerade bei der schwachen Besatzung der Stationen nicht ausgeschlossen; und jede etwaige Niederlage erfordert einen ganz bedeutenden Mehraufwand an Kräften, um sie wieder wett zu machen. Das Zusammenbringen eines starken Expeditionskorps wird nach der jetzigen Dislokation der Schutztruppe ohne totale Entblößung der Küste und der erreichbaren Stationen nicht möglich sein.
Die neue Dislokation der Truppen hätte der Ansicht des Verfassers nach zur Vorbedingung eine Vermehrung der Schutztruppe um mehrere hundert Soldaten haben müssen; dann allerdings hätte man die Neuordnung mit Freuden als großen Fortschritt begrüßen können, wie ja auch — aber immer unter dieser Voraussetzung — von uns die Begründung mehrerer Stationen gewünscht worden war.
In den Bestimmungen über die Polizeitruppe ist vorgesehen, daß die Bezirks-Hauptleute dem Etat an Offizieren[S. 328] der Kaiserlichen Schutztruppe entnommen werden sollen. In Wirklichkeit scheint indes der jetzige Gouverneur danach zu streben, diese Posten allmählich mit Juristen zu besetzen. Darauf weist die Verwendung des Kanzlers als Bezirkshauptmann des durch seinen Handel und Verkehr wichtigsten Küstenplatzes Bagamoyo hin, ebenso die im letzten halben Jahr nach Ostafrika erfolgte Heraussendung von Juristen. Eine solche Maßnahme kann dem Verfasser bei der wie gesagt noch nicht genügend erscheinenden Stabilität der Verhältnisse nur als unzeitgemäß erscheinen. Etwas anders ist es, wenn sich die eingeborene Bevölkerung etwas mehr an die seit vorigem Jahre erfolgte Neuordnung der Dinge in Ostafrika gewöhnt haben wird. Aber auch dann müssen die Juristen an Ort und Stelle praktischer erzogen werden, wie es bis jetzt geschieht, wo sie zum Teil mit ziemlich bedeutenden gesellschaftlichen Ansprüchen nach Ostafrika hinkommen und dort lediglich mit ihrer Kenntnis der Jurisprudenz und mit dem Strafgesetzbuch alle Schwierigkeiten bewältigen zu können glauben. Giebt man ihnen Gelegenheit, unter einem erfahrenen Stationschef in jeder Weise thätig zu sein und mit den Eingeborenen in Fühlung zu bleiben, überträgt man ihnen z. B. auf den großen Handelsplätzen, wie Bagamoyo, die Kontrolle bei den Karawanen, die bisher von vielen der Herren nur zum Zweck der Bereicherung ihrer ethnographischen Sammlungen betrachtet wurden und mit denen von einzelnen nur ein Verkehr vom Standpunkt der vornehmen Überlegenheit gepflogen wurde, so wird, wenn hierdurch die Neulinge Gelegenheit haben, auch die örtlichen Verhältnisse besser kennen zu lernen, die gewonnene Kenntnis der Volksanschauung im Verein mit ihrer Fachbildung sie zu äußerst wertvollen Beamten machen.
Ähnliches ist, nebenbei bemerkt, über die Ausbildung der neu nach Ostafrika gesandten Offiziere zu sagen. Je mehr diesen Gelegenheit geboten wird, möglichst mit der Bevölkerung dienstlich in Berührung zu kommen (Beiwohnen beim Schauri, Beaufsichtigung der Karawanen, Überwachung des Arbeitsdienstes, wie besonders Anlage neuer Stationen, Verkehr auf Expeditionen), besonders wenn sie selbst schaffend thätig sein können und nicht nur schablonenmäßig die Truppe in einer[S. 329] fertigen Station exerzieren, desto mehr werden sie nicht nur in militärischer Hinsicht, sondern auch im allgemeinen brauchbare Beamte werden, man kann sagen um so mehr, in je unfertigeren Verhältnissen sie in Ostafrika aufgewachsen sind.
Die übrigen im Laufe des vergangenen Jahres von Herrn v. Soden getroffenen Maßnahmen beziehen sich zunächst auf die Verlegung des Schwerpunktes der Regierung von Bagamoyo nach Daressalam. Begründet war dies durch die äußerst ungünstige Rhede von Bagamoyo, wo ein Anlaufen der Hauptdampfer ausgeschlossen war.
Es war in der letzten Zeit von Wißmann das Auskunftsmittel gewählt worden, Bagamoyo als Hauptsitz des Kommissariats zu halten, dagegen Daressalam als Hauptdepot und als Hauptplatz für die Flottille zu belassen. Wißmann selbst hatte deswegen den Schwerpunkt nach Bagamoyo verlegt, weil er, nachdem wir leider auf Sansibar verzichten mußten, von Bagamoyo aus noch am besten die Verhältnisse in der Hand behalten konnte. Hier laufen ja von den beiden großen Seen, vom Nyanza und dem Tanganjika, sowie aus dem Hinterlande unseres Gebietes alle Fäden zusammen, hier stand also der Reichskommissar persönlich mitten im gesamten afrikanischen Verkehr, wie er in gleichem Maße an keinem andern Platze der gesamten Ostküste Afrikas stattfindet. Der Ansicht des Verfassers nach ist es notwendig, in Bagamoyo zu residieren, wenn man den Schwerpunkt seiner Aufgabe in der Kolonie selbst sucht.
Wenn man hingegen meint, der Verbindung nach Europa, dem Verkehr mit der deutschen vorgesetzten Behörde die größere Rücksicht schuldig zu sein, dann ist allerdings wegen der regen Verbindung mit der Heimat Daressalam der rechte Platz, und liegt dann naturgemäß die Handhabung des Verkehrs mit dem Innern in den Händen des Bezirks-Hauptmanns von Bagamoyo. Daß nun gerade das letztere der Gouverneur nicht wünschte, sondern daß er sich alle mögliche Mühe gab, den Verkehr nach Daressalam zu ziehen auf Kosten von Bagamoyo, um als äußerst rühriger, thätiger Mann, der er ist, selbst alles in die Hand zu bekommen, ist ja begreiflich, aber unpraktisch. Der inner-afrikanische Verkehr[S. 330] kann nach Daressalam nur auf zweierlei Weise gezogen werden: entweder durch Einrichtung eines direkten Verkehrsweges von Daressalam bis weit ins Innere hinein, wie wir in einem der früheren Kapitel erwähnten, oder durch Gewalt. Ob letztere, selbst den Fall angenommen, daß wir immer in der Lage wären, sie faktisch anwenden zu können, ratsam ist und nicht vielleicht dazu dient, den Verkehr von unserer Küste überhaupt abzulenken, erscheint zum mindesten recht zweifelhaft.
Solche kleinen Abstecher, wie sie der Gouverneur z. B. voriges Jahr in das für den Verkehr höchst unbedeutende Usaramo mit seinen geradezu erbärmlichen Bewohnern, den Wasaramo, gemacht hat, einige Meilen weit bis an den Kingani, können hierfür nicht das geringste zu Wege bringen. Sie geben nur falsche Vorstellungen in Europa, besonders wenn lange, im Mißverhältnis zur Wichtigkeit stehende Berichte darüber veröffentlicht werden, fördern den Verkehr jedoch nicht im mindesten. So lange die Inder entweder in Bagamoyo, oder wie es meistens der Fall ist, in Sansibar selbst den Handel mit den Karawanen in der Hand haben, sind die Leute auf Bagamoyo angewiesen, von wo aus die Verschiffung ihrer Waren auf der allerdings miserablen, aber für den Dhau-Verkehr wegen der geringen Entfernung von Sansibar höchst bequemen Rhede vorteilhaft ist.
Auch die in den letzten Monaten viel erwähnte, angeblich vom Gouverneur erst geschaffene Postverbindung von Daressalam nach dem Innern erweckt hier in der Heimat falsche Vorstellungen. Eine Postverbindung hat auch früher meistens, in den letzten Jahren immer, bestanden. Entweder die französische Mission zu Bagamoyo oder der Inder Sewa Hadji beförderten die Postsachen in regelmäßigen Zeiträumen nach dem Innern, oder es war wie in den letzten Jahren Aufgabe des Bezirkshauptmanns von Bagamoyo, einen regelmäßigen Postverkehr aufrecht zu erhalten. Der letztere hatte hierzu in Bagamoyo die beste Gelegenheit, da eben hier, wie erwähnt, alle Karawanen hinkamen und so wie so ein lebhafter Verkehr zwischen diesem Küstenplatz und dem Innern bestand. Jetzt ist die Besorgung der Posten einer ziemlich neuen Firma in Daressalam übertragen. Aber die Angestellten dieser[S. 331] Firma haben nicht die Beziehungen zu den Leuten, wie sie z. B. die französische Mission und die dortigen Inder, oder wie sie in erster Linie der Bezirkshauptmann von Bagamoyo hat. Es sind also in die Zuverlässigkeit dieser Art der Postverbindung starke Zweifel zu setzen. Der Umstand, daß die Briefträger uniformiert und so äußerlich kenntlich sein sollen, thut wenig zur Sache, ist unter Umständen sogar, wenn, wie häufig, im Innern nicht überall völlige Ruhe herrscht, nachteilig.
Besondere Erwähnung mag noch die rege, in Daressalam seit Einrichtung des Gouvernements naturgemäß entfaltete Bauthätigkeit finden, durch die, wie durch eine für diesen Platz vom Gouverneur vorgeschriebene Bauordnung Daressalam auch äußerlich ein gutes Aussehen erlangt hat. Man kann sagen, der Ort macht heute den Eindruck einer kleinen europäischen Villenstadt.
Auf eine Reihe von Erlassen des Kaiserlichen Gouverneurs muß fernerhin an dieser Stelle hingedeutet werden, welche den löblichen Zweck hatten, die Einnahmen der Kolonie zu vermehren. Neben der Übernahme des Zolles, der aus den Händen der ostafrikanischen Gesellschaft an das Gouvernement überging, und der natürlich nach wie vor, da ja die Inder, Araber und Eingeborenen daran gewöhnt sind, willig bezahlt wurde, den man sogar leicht, ohne auf großen Widerstand zu stoßen, zum Zwecke der Vermehrung der Einnahmen hätte erhöhen können, waren es Steuer-Verordnungen, die der Gouverneur im vorigen Jahre erließ. Diese Verordnungen, die in großer Eile den Organen des Gouverneurs an den verschiedenen Küstenplätzen zu publizieren befohlen wurde, zeigten sich als durchaus unangebracht. Sie riefen eine große Mißstimmung unter der davon betroffenen Bevölkerung hervor, weil sie neben einer zu großen, sehr in die Augen fallenden Belastung einzelner Personen den bestehenden Verkehr in manchen Beziehungen bedeutend erschwerten.
Die Verordnungen bezogen sich auf die Ausschreibung einer Hafengebühr für Dhaus, auf Einführung einer nach dem Umsatz, nicht nach dem Ertrag berechneten Handelssteuer, einer Schankgebühr, welche letztere wir allerdings als vollkommen[S. 332] berechtigt anerkennen möchten und einer Gebühr für das Schlagen von Bauhölzern. Da indes zum großen Teil diese Projekte als undurchführbar wieder fallen gelassen sind, so sei nicht weiter hierauf eingegangen. Bezüglich des Handels suchte uns der Kongostaat dadurch Konkurrenz zu machen, daß von seinen Beamten an unserer Westgrenze, Zölle für die in unser Gebiet eingeführten Waaren, besonders das Elfenbein, erhoben wurden. Dies machte sehr viel böses Blut bei den Arabern gegen den Kongostaat; die Araber zu Bagamoyo trugen ihre Beschwerden dem Verfasser vor, der, da dieselben ihm gegen internationale Abmachungen zu verstoßen schienen, sie weitergab; doch scheint darauf hin nichts weiter von unserer Seite erfolgt zu sein.
Die Bestrebungen des Gouverneurs zielen natürlich nur auf das Beste der Kolonie ab, es fehlt ihm aber nach der Ansicht des Verfassers die nötige Vorkenntnis der speziellen ostafrikanischen Verhältnisse.
Eine größere Rücksichtnahme auf die mächtigen, einflußreichen Faktoren in der Bevölkerung, wie die Araber, würden wir dringend wünschen, denn man kann sich, namentlich wenn man nicht über einen großen Geldsack und über große Kräfte zu verfügen hat, nicht so ohne weiteres über sie hinwegsetzen, sondern muß mit ihnen, die Einfluß im Lande haben, wie mit den größeren mächtigen Häuptlingen und mit den kommerziellen Regenten, den Indern, rechnen. Der Handel ist ihnen nicht mit Redensarten zu entziehen, (außer wenn man ihn überhaupt zurückbringen will,) und man kann sich gerade, wie uns dies Wißmann gezeigt hat, durch solche Rücksichtnahme manche Opfer ersparen und viele Erfolge erringen. Daß der Gouverneur selbst bei den Machthabern des Landes, den Arabern und den Häuptlingen, gar nicht beliebt ist, muß sehr bedauert werden, denn nirgends kommt es so sehr wie in Afrika auf das Renommee der Persönlichkeit an.
Der Gouverneur selbst arbeitet mit ungeheurer Rührigkeit, aber allein, und weist jede Hülfe erfahrener Leute von der Hand, hält jede Beeinflussung durch solche mißtrauisch fern und von den an Ort und Stelle erfahrenen Beamten holt Herr von Soden nur dann Rat ein, wenn er annimmt, daß[S. 333] die Ratschläge in seinem Sinne ausfallen; auch weiß er die wirklichen Kenner des Landes von den partiellen Kennern nicht zu unterscheiden; er, wie auch in Deutschland die Leute, scheeren so oft alle, die längere Zeit in Ostafrika waren, betreffs ihrer Urteilsfähigkeit über einen Kamm. Es kann jedoch jemand lange Jahre an einem toten, vom großartigen afrikanischen Handel abgeschlossenen Küstenplatz oder an einem fern den Hauptkarawanenstraßen gelegenen Platz im Lande gesessen haben, ohne in den Besitz einer Kenntnis der allgemeinen afrikanischen Verhältnisse gelangt zu sein. Solche Leute gehören zu den Theoretikern, die in ihrem Urteil erfahrungsmäßig fast stets von den Praktikern abweichen. —
Schon hatte der Verfasser das Manuskript zu diesem Buche abgeschlossen, da trafen so wichtige Nachrichten aus unserem ostafrikanischen Schutzgebiet ein, daß er Veranlassung nimmt, die Vorgänge noch mit wenigen Zeilen zu streifen.
Am Kilimandscharo sind die Herren Kompagnieführer Freiherr von Bülow und Lieutenant Wolfrum den Heldentod gestorben. Der erstere war ein wegen seiner Tapferkeit, Pflichttreue und siebenjähriger afrikanischer Erfahrung hochgeschätzter, an den verschiedensten Plätzen bewährter Offizier, der letztere wurde, zwar bedeutend jünger im afrikanischen Dienst, von allen gleichgeschätzt, als Offizier, Kamerad und Mensch; beider Tod ist ein empfindlicher Verlust für die Schutztruppe. Leider fielen beide in einem für uns recht unglücklichen Gefecht bei Moschi am 10. Juni: Wolfrum während desselben, Bülow erlag den im Gefecht erhaltenen Verwundungen am Tage darauf.
Zu Moschi war im November v. J. Meli seinem Vater Mandara nach dessen Tode in der Herrschaft gefolgt. Während Mandara stets ein zuverlässiger Freund der Deutschen gewesen war, der fremden Einfluß nicht aufkommen ließ, scheint sich sein Sohn ganz in die Hände der englischen Missionare gegeben zu haben; nach der Gründung der Station Marangu lebte Meli auch nicht mehr derartig unter den Augen der Deutschen, daß einer Schwenkung in seiner politischen Haltung hätte rechtzeitig vorgebeugt werden können.
Aus Gründen, welche zur Zeit hier noch nicht genügend aufgeklärt sind, sah sich Herr von Bülow veranlaßt, gegen Meli[S. 334] vorzugehen. Da seine Kompagnie aber sehr verteilt war und da er wohl keine Aussicht hatte, vom Gouverneur von der Küste Verstärkungen zu erhalten, wagte er das Vorgehen gegen die kriegerischen Wadschagga zu Moschi anscheinend mit etwas geringen Mitteln. Auch scheint es, daß den Wadschagga Hinterladergewehre mit Munition durch die Engländer, vielleicht gar durch Vermittlung der englischen Mission, geliefert sind. Jedenfalls war das Gefecht bei Moschi ein für uns unglückliches; nach harten Verlusten mußten sich die Unsrigen zurückziehen, selbst die von Peters begründete Kilimandscharo-Station mußte aufgegeben werden; unsere Position am Kilimandscharo ist damit zur Zeit verloren. Man hat alles an Kräften, was man an der Küste noch zusammenbringen konnte, vereint, wie es scheint, ist die Küste sogar sehr von Truppen entblößt worden. — Es sind zwei Expeditionen, die eine unter dem an Ort und Stelle sehr erfahrenen, in Afrika wohl bewährten Kompagnieführer Johannes voran, die zweite unter dem neuen Oberführer der Schutztruppe, von Manteuffel, nachfolgend, von Tanga abgesandt, um den unzuverlässigen Häuptlingen die Lust zu weiteren Ausschreitungen zu benehmen und unsere Position im Innern wieder zu befestigen. Hoffentlich reichen die zusammengebrachten Kräfte dazu aus, den Kampf gegen Meli mit begründeter Aussicht auf Erfolg aufzunehmen und unser Ansehen wiederherzustellen.
[S. 335]
Gewinnung Emins für deutsche Dienste. — Charakter Emins. — Zwecke der Expedition. — Abmarsch. — Ankunft in Mpapua. — Kämpfe gegen die Wahumba. — Begegnung mit Dr. Peters. — Abmarsch von Mpapua mit v. Bülow. — Die Expedition schwenkt nach Tabora ab. — Vorverhandlungen daselbst durch den Belutschen Ismael. — Der Häuptling Sikke. — Vertrag Emins. — Seef ben Saad zum Wali gewählt. — v. Bülow geht nach Urambo. — Kämpfe Bülows und Langhelds mit den Wangoni. — Uramboleute als Hilfstruppen. — Langheld in Usongo. — Emin am Viktoria. — Aufbruch nach dem Westufer. — Gründung von Bukoba. — Stokes kommt mit Sigl nach Usongo. — Unglückliches Gefecht zu Tinde. — Langheld holt vom Viktoria Verstärkung. — Kämpfe gegen die Waniamuesi und Wangoni. — Stimmung der Araber zu Tabora. — Sigls Erfolge daselbst. — Marsch Langhelds nach Bukoba. — Langheld übernimmt die Stationen Bukoba und Muanza. — Emins und Stuhlmanns Weitermarsch nach dem Albert-Eduardsee und Momphu. — Sein Rückmarsch. — Schluß.
Bei der chronologischen Entwicklung der Ereignisse während und nach dem Aufstande, wie sie das vorliegende Buch darbietet, ist bisher eine Episode gänzlich außer Acht gelassen worden, eine Episode, welche gleichwohl in ihren Folgezuständen einen der wichtigsten Faktoren für die Weiterentwickelung der Kolonie darstellt und welche besonders auf die Maßnahmen des Gouvernements von wesentlich bestimmendem Einfluß gewesen ist: wir meinen die Expedition Dr. Emin Paschas.
Schon früher ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, daß bei der Ankunft an der Küste der Pascha selbstverständlich, falls er nicht gänzlich auf seine Thätigkeit in Afrika zu verzichten wünschte, die von Seiten Englands ihm gemachten Vorschläge anzunehmen geneigt schien. Mußte doch England[S. 336] für ihn als die einzige in Afrika wirklich interessierte Macht gelten, war er selbst doch im Dienst Gordons seiner erfolgreichen Thätigkeit in der Äquatorialprovinz zugeführt worden. Aber diese Neigung zu England erlitt einen Stoß schon bei der Ankunft Emins in Mpapua. Hier trat ihm plötzlich eine neue Kolonialmacht entgegen; hier wehte die deutsche Flagge 300 km von der Küste entfernt; deutsche Offiziere und Unteroffiziere, schwarze Truppen in deutschen Diensten empfingen ihn. Auf unserm Marsch zur Küste hinunter war Gelegenheit genug, dem Pascha in eingehenden Gesprächen die Entwicklung unserer deutsch-ostafrikanischen Kolonie darzulegen, ihn zu überzeugen, daß sein eigentliches Vaterland als stärkster Nebenbuhler Englands auf dem afrikanischen Kontinent mit Erfolg erschienen sei.
Für uns selbst mußte natürlich ein Name wie der Emin Paschas als eine überaus wichtige Erwerbung erscheinen. Die ganze zivilisierte Welt kannte ihn, die in Afrika beteiligten Mächte, der Kongostaat wie England, legten übereinstimmend einen überaus großen Wert auf seine Dienste. Was war da naheliegender, als daß wir unsererseits versuchten, den besten Kenner Innerafrikas, den in der Behandlung der Schwarzen und Araber äußerst gewandten Mann für uns zu gewinnen? Die beste Gelegenheit hierzu bot das Krankenlager Emins. Sein Zustand verbot von selbst die von englischen Freunden so überaus dringend gewünschte Überführung in ihre Hände. Vor den Augen des Genesenden entwickelte sich das gerade damals großartige Bild militärischen Lebens und beginnender Kulturarbeit auf unsrer größten afrikanischen Station.
Dazu kam der wesentliche Einfluß einer Persönlichkeit wie Wißmann, mit dessen Charaktereigenschaften sich in diesem Falle noch die Bedeutung des selbständigen, erfolgreichen Afrikaforschers verband. So war die Überleitung der Gesinnung Emins von der englischen Seite zur deutschen gleichzeitig das Werk der Ereignisse und des Einflusses der Personen, welche ihn umgaben, nicht aber ohne weiteres ein freiwilliges Zurückkehren seinerseits zu seinem angestammten Vaterland. Eine bloße Übernahme des Pascha in den Dienst des Kommissariats[S. 337] war durch die Bedeutung seiner Persönlichkeit ausgeschlossen. Wenn er uns seine Dienste widmen sollte, so konnte dies nur geschehen durch eine direkte Genehmigung oder auf einen ausgesprochenen Wunsch des Auswärtigen Amtes in einer Stellung, welche ihn nicht, wie uns andre, dem persönlichen Dienst des Reichskommissars zuteilte. Wißmann wandte sich daher, wie bekannt, an die leitende Stelle in Berlin und erhielt von dieser die telegraphische Antwort: »Emin Paschas Dienste sind uns angenehm.«
Es ist die Ansicht sehr verbreitet, als hätte Wißmann danach gestrebt, Dr. Emin Pascha in seinen Befehlsbereich, also zu seinem Untergebenen zu bekommen. Diese Ansicht ist irrig: Wißmann wünschte eine direkte Unterstellung des Pascha unter das Auswärtige Amt; Dr. Emin hingegen erbat wiederholt und dringend von Wißmann eine direkte Unterstellung seiner Person unter die Wißmanns, auch für spätere Zeit, und zwar begründete der Pascha dies in seiner mitunter kokett erscheinenden Bescheidenheit mit den größeren persönlichen Verdiensten Wißmanns. Es möge dies Faktum Erwähnung finden, um einer ungerechten Beurteilung Wißmanns vorzubeugen.
Die Aufgabe, welche Wißmann durch den Pascha gelöst wissen wollte, basiert auf den eigentümlichen, man kann wohl sagen politischen Verhältnissen unserer Kolonie. Die Küste war in unsern Besitz zurückgebracht. Der große Karawanen-Knotenpunkt, welcher als äußerste Grenze der Küste betrachtet werden kann, war von uns besetzt. Aber diese Thatsachen konnten für die wirkliche Beherrschung der Kolonie durch uns immer noch nicht als allein ausschlaggebend angesehen werden, besonders dann nicht, wenn wir unsre Hauptaufgabe erfüllen, d. h. die handelspolitischen Fäden Inner-Afrikas in unsrer Hand vereinigen wollten. Diese Fäden liefen im Innern zusammen in den großen arabischen Handelscentren, wo hunderte mächtiger Kaufleute, ja, man kann sagen arabischer Herrscher ungeheure Gebiete in unserm eigenen Lande in ihrer Hand vereinigt hatten. Es schien sehr denkbar, daß die Araber des Innern durch die Beeinträchtigung des Sklavenhandels oder aus Furcht vor unserm Vorgehen an der Küste[S. 338] ihren Handel von nun an in andere Bahnen lenken würden, auch lag die Möglichkeit nahe, daß diese arabischen Centren im Innern, wenn wir nicht in einen direkten Verkehr mit ihnen traten, auf endlose Zeit hinaus die Quellen neuer Aufstände und Beunruhigungen sein würden. Ein militärischer Vorstoß nach diesen Punkten im Innern konnte gar nicht in Frage kommen. Zudem ließen es auch die bestehenden Verhältnisse als wahrscheinlich erscheinen, daß eine diplomatische Expedition, wenn dieselbe unter der Entfaltung einer immerhin in die Augen fallenden Macht auftrat, noch besser zum Ziele führen würde. Für eine solche Aufgabe war die Person Emin Paschas so geeignet, wie keine zweite. Als ganz erstrebenswerte Folge ergab sich außerdem, daß durch eine solche Expedition notwendig im Innern Interessen geschaffen werden mußten, welche von der Reichsregierung später in keinem Falle aufgegeben oder verleugnet werden konnten. Auf diesen Grundlagen baute sich die Aufgabe, welche Emin lösen sollte, auf.
Der Entschluß, seine Dienste der deutschen Reichsregierung anzubieten, war von Dr. Emin noch auf seinem Krankenlager in Bagamoyo gefaßt worden. Nachdem die prinzipielle Genehmigung zur Expedition von Berlin erwirkt und die Mittel für dieselbe bewilligt waren, wurde mit Eifer an die Zusammenstellung der Expedition gegangen. Zwar hatte es nach der Genesung des Pascha den Anschein, als gewännen andere Einflüsse auf ihn wieder die Oberhand, zwar erklärte er mir nach erfolgter Zusammenstellung der Expedition zuletzt noch in Bagamoyo, er wolle diese mir, der ich ursprünglich als militärischer Führer für dieselbe in Aussicht genommen war, überlassen und selbst noch in Sansibar und Bagamoyo verweilen, schließlich aber willigte er doch ein, selbst die Expedition zu führen. Und dazu hatte Wißmann seinen ganzen Einfluß eingesetzt, denn es war klar, daß nur im Vertrauen auf den Pascha, seine Vergangenheit und seine außerordentliche Leistungsfähigkeit, die Genehmigung des Reichskanzlers zu dieser für damalige Verhältnisse weitausschauenden Expedition erteilt war.
Es möge an dieser Stelle gestattet sein, den Charakter Emins, wie sich uns derselbe in mehrmonatlichem Verkehr[S. 339] offenbarte, einige Worte zu widmen. Unbestritten ist von vornherein sein wissenschaftlicher Eifer und Ruhm. Ebenso unbestritten das organisatorische Talent, welches er während der dreizehn Verwaltungsjahre in der Äquatorialprovinz genügend bekundet hat. Uns Offizieren jedoch mußte ein Charakter wie der seine zunächst durchaus fremd gegenübertreten. Mag es nun in seinem langen Verkehr mit Arabern oder in angeborenen Charaktereigentümlichkeiten liegen, er zeigte in jedem Falle ein für unser Gefühl viel zu starkes Eingehen auf Wünsche aller Art, gleichviel von welcher Seite dieselben immer ausgesprochen wurden. Die übertriebene Höflichkeit und die vollkommene Unterordnung seines eigenen Willens unter den Ideengang viel jüngerer Männer, nicht nur Wißmanns, sondern auch weniger bedeutender Leute, kamen uns wie eine Art Schlaffheit, wie mangelndes Selbstbewußtsein vor. Dazu kam eine übergroße Reizbarkeit; der Charakter Emins ist dermaßen erregbar, daß unter Umständen ein verkehrtes Wort ihn dazu veranlassen konnte, daß er sich wie eine Schnecke in ihr Haus zurückzog. Leicht bezog er auch ein der Sache geltendes Urteil auf seine Person. Besonders in letzterer Hinsicht war der Verkehr mit ihm nicht ganz angenehm, denn Emin pflegte derartige Meinungsverschiedenheiten nicht so leicht zu vergessen. Das hier gefällte Urteil ist ja ein persönliches, aber es bringt das Empfinden zum Ausdruck, welches wir bis zum Abmarsch des Pascha fast ausnahmslos hatten.
Eins aber muß ganz unbedingt von allen anerkannt werden: das ist die Thatsache, daß schließlich Dr. Emin trotz seiner schweren vorhergegangenen Krankheit, trotz seines 16jährigen Aufenthalts in Afrika sich schließlich, ohne die Heimat oder Egypten wiederzusehen, in den Dienst der deutschen Sache stellte, für die er nach kaum fünfmonatlichem Verweilen an der Küste den Marsch ins Innere wieder antrat, ohne doch durch eine Verpflichtung dazu genötigt gewesen zu sein. Und in der That ist die Expedition Dr. Emins von der einschneidendsten Bedeutung für die weitere Entwickelung Deutsch-Ostafrikas geworden. Das Verdienst, unser Ansehen im Seengebiet ausgebreitet zu haben, kommt der Expedition Emin Paschas zu.
[S. 340]
Der geeignetste Zeitpunkt für eine solche Expedition und ihre Aufgaben war die verhältnismäßig stille Zeit, welche nach der Beruhigung des Nordens und vor Wiedereroberung des Südens sich eingestellt hatte. Die Verhandlungen zwischen Wißmann und Emin führten zu dem Resultat, daß der Pascha Ende April mit den Offizieren Langheld und Dr. Stuhlmann, dem Feldwebel Kühne und dem Sergeant Krause, 100 Soldaten (Sudanesen, Zulus und Askaris), ferner 400 mit Vorderladern bewaffneten Trägern und einem kleinen 3,7 cm Geschütz von Bagamoyo aufbrechen sollte. Lieutenant Langheld war als Führer der Soldaten an Stelle des Verfassers getreten, da zwischen dem Pascha und diesem Meinungsverschiedenheiten Platz gegriffen hatten. Lieutenant Dr. Stuhlmann war dem Pascha als wissenschaftliche Stütze beigegeben. Beiläufig erwähnt, machte die Anwerbung der Träger sehr große Schwierigkeit. Sobald unsere englischen Freunde in Sansibar, denen wir bis zum letzten Augenblick die Zwecke und Personen der Expedition verborgen gehalten hatten, über die Sachlage im Klaren waren, setzten sie alles daran, die Expedition zu hintertreiben.
Am 26. April 1890 marschierte die Expedition von Bagamoyo ab und traf in Mpapua mit der aus dem Innern kommenden deutschen Emin Pascha-Expedition unter Dr. Peters zusammen. Wegen der schlechten Jahreszeit — die Kingani- und Makataebene waren nach der großen Regenzeit ebenso wie das Mukondoguathal überschwemmt — hatten die Expeditionsmitglieder wie die Soldaten und Träger schon auf dem erstem Teil des Marsches viel unter klimatischen Krankheiten zu leiden und waren auch einige Verluste durch Tod zu verzeichnen. In Mpapua wurde von Seiten des dortigen Stationschefs Freiherrn von Bülow und Lieutenant Langheld mit den vereinigten Stations- und Expeditions-Truppen ein Zug gegen die Wahumba unternommen, die bei Kitangi geschlagen wurden.
Am 19. Juni erfolgte zu Mpapua das Zusammentreffen mit Peters; am 21. Juni marschierte nach erfolgter Reorganisation die Expedition, die in Mpapua drei Wochen geweilt hatte, nach Westen weiter. Der bisher in Mpapua stationierte Feldwebel Hoffmann ging von hier aus als Expeditionsmitglied[S. 341] mit, sollte aber leider nicht wieder aus dem Innern zurückkehren, da er später in Muanza verstarb. Ebenso schloß sich Herr von Bülow mit 25 Mann der Mpapuabesatzung an, um die Wagogo mit Hülfe Langhelds zu züchtigen; die Wagogo, besonders der gefürchtete Häuptling Makenge zu Uniamwira, waren in letzter Zeit besonders frech gewesen; Dr. Peters speziell hatte Kämpfe mit ihnen gehabt, in denen er siegreich gewesen war. Nun wurden sie ebenfalls von Bülow und Langheld wieder geschlagen; Bülow, der ursprünglich nur bis Uniamwira mitmarschieren wollte, wurde dort durch Krankheit an der Rückkehr nach Mpapua verhindert und verblieb in der Behandlung des Pascha, indem er zunächst in der Expedition weiter getragen wurde.
Wenn, wie in Ugogo, Abteilungen der Expedition detachiert wurden für kriegerische Aktionen, zeigte es sich, daß die Sudanesen nie bei der Hauptexpedition des Pascha zurückbleiben, sondern stets Lieutenant Langheld, ihrem militärischen Führer, folgen wollten, trotzdem doch der egyptische Pascha und Gouverneur der Äquatorialprovinz ihnen näher stehen konnte; es war das Gleiche schon in Bagamoyo im Verhältnis der Sudanesen zum Pascha einerseits und zum Verfasser andererseits hervorgetreten. Es ist dies ein Zeichen der guten Disziplin unserer Sudanesen und der Anhänglichkeit an ihre militärischen Führer.
Von Mpapua an traten bereits Verhältnisse ein, welche auf den weiteren Verlauf der Expedition bestimmend einwirkten und derselben eine ursprünglich nicht beabsichtigte Richtung gaben. Bei der Feststellung der Grundzüge für die Expedition hatte Wißmann dem Pascha gegenüber ausdrücklich den Wunsch ausgesprochen, daß Tabora, jenes wichtigste arabische Centrum im Innern, nicht berührt werden solle. Wißmann setzte dabei voraus, daß das Erscheinen einer so geringen Macht, wie sie dem Pascha zur Verfügung stand, doch niemals von einem nachhaltigen Erfolge auf die arabische Macht daselbst sein könne und daß daher nur unangenehme Weiterungen aus einer Besetzung Taboras entstehen würden. Der Reichskommissar selbst war auf keinen Fall in der Lage, bei irgend welchen Verwicklungen thatkräftig einzugreifen; auch konnte[S. 342] solch ein weiter militärischer Vorstoß nach dem Innern vorderhand gar nicht als Aufgabe des Kommissariats angesehen werden.
Die Macht der Verhältnisse hat es schließlich anders gefügt. Emin, welcher ursprünglich nördlich von Tabora direkt nach dem Viktoriasee zu gehen beabsichtigte, wurde durch Trägermangel und notwendige Ergänzung der Tauschwaren gezwungen, von seiner Route abzubiegen und Tabora aufzusuchen. Da nun hier die politischen Verhältnisse, besonders die Stimmung der Araber, sich einer Verhandlung günstig zeigte, betrachtete es Emin als seine Aufgabe, in Tabora die deutsche Flagge aufzuhissen und einen förmlichen Vertrag abschließen. Hierbei hatte ein Abgesandter Wißmanns, der Belutsche Ismael aus Bagamoyo, dem Pascha die Wege geebnet. Dieser hatte große Handelsverbindungen in Tabora und war mit allen dortigen Arabern und Belutschen aufs Engste liirt. Er erschien daher als der geeignete Mann, so lange wir größere Machtmittel im Innern nicht aufwenden konnten, für uns zu wirken und es war Wißmann, der teils persönlich, teils durch Hauptmann Richelmann und den Verfasser mit ihm unterhandelt hatte, gelungen, Ismael zu gewinnen. Derselbe ging gerade mit einer Handelsexpedition nach Tabora hinauf und übernahm dabei die Aufgabe, die Araber zur Hissung der deutschen Flagge und zur Unterwerfung unter die deutsche Herrschaft zu bewegen; Ismael machte den Leuten klar, daß ihr eigenes Interesse auf unserer Seite läge, da sie doch kommerziell von der Küste abhängig wären, und sie da auch eventuell, wie der in einem früheren Kapitel erwähnte Fall Mohammed ben Kassim zeigte, gefaßt werden könnten. Die Araber waren durchaus geneigt, die deutsche Herrschaft ohne Rückhalt anzuerkennen, nicht so aber der von jeher aufs übelste berüchtigte Waniamuesihäuptling Sikke. Doch gelang es schließlich der Einwirkung der Araber und Ismaels, auch Sikke geneigter zu machen.
Da Ismael bekannt wurde, daß die Expedition des Paschas sich Tabora näherte, bewirkte er, daß von den Arabern schließlich im Einverständnis mit Sikke, der zuerst gegen die Expedition getobt hatte, ein Einladungsschreiben an Emin[S. 343] Pascha abgesandt wurde, selbst nach Tabora zu kommen und dort die deutsche Flagge zu hissen; der Pascha, der bei den Arabern als Mohammedaner galt, hatte natürlich einen sehr guten Namen unter diesen.
Ismael selbst ging dem Pascha entgegen, überbrachte ihm die Aufforderung der Araber und schilderte ihm die Lage der Dinge in Unianiembe. Der Pascha marschierte darauf nach Tabora und schloß daselbst am 1. August 1890 einen Vertrag mit den Arabern, in welchem diese die deutsche Oberhoheit in Unianiembe anerkannten und das Recht erhielten, selbständig einen Wali zu wählen. Falls später eine Station in Tabora angelegt würde, sollte der Wali wie in den Küstenstationen unter dem Befehl des Stationschefs stehen. Sklavenhandel und Sklavenjagden wurden ausdrücklich verboten. Der Sultan Sikke von Unianiembe zahlte eine Summe in Elfenbein und lieferte dem Pascha eine Mitrailleuse und ein Broncegeschütz aus. Die erstere hatte Sikke früher den Belgiern abgenommen, während das Broncegeschütz ein Geschenk Said Bargaschs an ihn war.
Als Wali wurde in Tabora Seef ben Saad gewählt, der sich bis zum gegenwärtigen Augenblick als außerordentlich tüchtig und zuverlässig bewährt hat.
Während des Aufenthaltes der Expedition zu Tabora, wo wieder eine Reorganisation derselben erfolgte, bedrängten die Wangoni stark die Uramboleute; es wurde daher der noch immer kranke Chef v. Bülow mit seinen aus Mpapua mitgenommenen 25 Mann nach Urambo abgesandt, zugleich auch in der Absicht, daß ihm dort in gesünderer Gegend Gelegenheit geboten würde, sich zu erholen. Die Wangoni drängten indes auch nach der Ankunft Bülows in Urambo immer mehr nach und berichtete Bülow an den Pascha, daß die ganzen Wangoni im Kriege gegen Urambo liegen. In Folge dessen sandte am 25. August Dr. Emin Pascha den Lieutenant Langheld mit Feldwebel Kühne und 70 Mann und den beiden von Sikke ausgelieferten Geschützen ab, um den Uramboleuten im Verein mit Bülow zu helfen. Es war verabredet worden, daß der Pascha mit Dr. Stuhlmann und dem anderen Teil der Expedition alsdann Langheld folgen wollte und sich die gesamte Expedition weiterhin in Usongo vereinigen sollte.
[S. 344]
Bülow und Langheld versuchten die Zwistigkeiten der Uramboleute und Wangoni im guten auszugleichen, doch vergeblich; nach vielen fruchtlosen Verhandlungen marschierten sie mit über 2000 Uramboleuten den Wangoni entgegen, die in den Tagen vom 9.-12. September vollständig geschlagen wurden. Die große Zahl der Uramboleute, welche sich in den Kämpfen vorzüglich benahmen, erwies sich als ein ausgezeichnetes Sicherungsmittel.
Am 15. September traf die Expedition in Usongo ein. Der Pascha war indes Langheld nicht gefolgt, sondern war auf eine Bitte der französischen Mission in Bukumbi am 30. August von Tabora dorthin abgerückt, ohne irgendwelche Instruktion für eine Wiedervereinigung der Expedition zu erteilen; die von der Missionsstation erbetene Hülfe erwies sich zudem als nicht dringend. Der Pascha erreichte mit Stuhlmann den See Ende September in Bussisi gegenüber Bukumbi und brach von dort Ende Oktober, nachdem ein Einschreiten daselbst nicht notwendig gewesen war, nach dem Westufer des Sees auf; er selbst benutzte den Wasserweg, Stuhlmann den Landweg.
Der Aufbruch beider war wiederum erfolgt, ohne eine Vereinigung der Expedition abzuwarten; Emin sandte nur Boten mit der Nachricht an Langheld zurück, daß die Expedition nach dem Westufer abmarschiert wäre, ohne jedoch eine Instruktion hinzuzufügen; auch hatte er für eine stetige rückwärtige Verbindung keine Sorge getragen; die Nachricht von den glücklichen Gefechten Bülows und Langhelds gegen die Wangoni hatte der Pascha erhalten. Am Westufer des Sees befaßte er sich mit Stuhlmann bis zum späteren Eintreffen Langhelds mit der Begründung der Station Bukoba.
Inzwischen hatte Langheld den Feldwebel Kühne mit 40 Mann zum Pascha entsendet, da die Soldaten in Uniamuesi vor der Hand nicht notwendig waren. Langheld selbst wartete das Eintreffen des Irländers Stokes ab. Dieser, welcher im Inneren einen großen Elfenbeinhandel betrieb und der Schwiegersohn des Sultans Mtinginia von Usongo war, war von Wißmann in die Dienste des Reichskommissariats übernommen, um seinen bedeutenden Einfluß im Inneren für uns auszunutzen.
[S. 345]
Mit Stokes marschierte Lieutenant Sigl mit dem Sergeant Bauer, 17 Soldaten und einem 4,7 cm Geschütz. Sigl war ursprünglich für die Begründung einer Station in Usongo ausersehen, da gerade durch den starken Rückhalt, den die Station an Mtinginia haben mußte, und die dadurch bewirkte Erweiterung der deutschen Interessen am besten die spätere Besetzung Taboras vorbereitet wurde.
Die durch Emins Vertragsabschluß und Aufenthalt in Tabora veränderten Verhältnisse führten indes zur Begründung der Station Tabora durch Lieutenant Sigl. Stokes hielt es nach seiner Ankunft für notwendig, eine Ortschaft in der Nähe Usongos, Namens Tinde, zu züchtigen; er requirirte dazu die Hülfe Langhelds. Trotzdem Stokes jahrelang in Usongo seinen Wohnsitz hatte, war er über die nächsten Verhältnisse der benachbarten Ortschaften so wenig orientiert, daß er den in Tinde zu findenden Widerstand bedeutend unterschätzte. Langheld und Sigl marschierten mit nur 35 Mann dorthin, trafen auf stark befestigte Dörfer und sehr großen Widerstand und mußten sich mit einem Verlust von 10 Mann unter Mitnahme der Toten und Verwundeten in Folge Patronenmangels zurückziehen. Sigl selbst hatte einen Streifschuß am Kopf erhalten. Jetzt war die Lage kritisch geworden.
In Urambo saß Frhr. von Bülow mit geringer Macht, in Usongo Langheld und Sigl mit einer in Folge des unglücklichen Gefechts verminderten Soldatenzahl. Instruktionen vom Pascha lagen, wie erwähnt, nicht vor.
Nach reiflicher Erwägung mit Stokes und Sigl beschloß nun Langheld die Verbindung mit dem Pascha herzustellen. Er brach mit 20 der besten Schützen und reichlicher Munition von Usongo auf und marschierte durch das feindliche Gebiet zum See ab. Beim Eintreffen am See sandte er sofort Meldung an den Pascha, der daraufhin 50 Mann zur Unterstützung der südlichen Abteilung von Bukoba absandte.
Die Abteilung stand unter der Führung eines farbigen Offiziers, da die beiden Unteroffiziere Hoffmann und Krause krank waren und daher beim Pascha und Stuhlmann zu Bukoba zurückbleiben mußten. Langheld marschierte nach dem Eintreffen der Verstärkung in Eilmärschen nach Usongo zurück.
[S. 346]
Am 5. Dezember traf er bei Stokes und Sigl ein und warf am 9. Dezember mit dem letzteren gemeinsam unter Verlust von 13 Toten und Verwundeten die vereinigten Wangoni und Waniamuesi nieder. In den nächsten Tagen wurde der Sieg durch weiteres Vorgehen gegen die Feinde noch ausgenutzt, die aber, nachdem ihr stärkstes Bollwerk gefallen war, nicht mehr Stand zu halten wagten.
Es erfolgte nun die Begründung der Station Tabora durch Sigl und zwar zunächst unter wenig günstigen Vorzeichen. Denn es war gerade damals die Nachricht von einem sehr scharfen Vorgehen des Dr. Emin Pascha gegen einige Araber, die kurz vor seiner Ankunft am See sein Lager besuchten, aus Usukuma nach Tabora gedrungen.
Die Angelegenheit ist zur Zeit noch nicht genügend aufgeklärt. Thatsache ist, daß das Vorgehen des Pascha gegen ihm bis dahin freundlich gesinnte Araber einen vollständigen Umschlag der Stimmung zu Tabora und sogar an der Küste gegen ihn und zeitweilig gegen uns alle bewirkte. Nichtsdestoweniger gelang es Sigl in Tabora durch sein äußerst geschicktes Verhalten und klugen Takt uns eine gute Position zu gründen; eine Stütze hatte er zuerst in dem Sergeant Bauer, der ihm daselbst beigegeben war. Zu statten kam Sigl der Waffenerfolg, den er und Langheld über die Waniamuesi und Wangoni errungen hatte; die Waniamuesi-Chefs wurden dadurch zur Annahme der deutschen Flagge bewogen und zur Anerkennung der deutschen Herrschaft. In den 1-1/4 Jahren seines Aufenthalts zu Tabora hat es dann Sigl verstanden, niemals wesentliche Differenzen mit den Machthabern von Unianiembe aufkommen zu lassen. Er hielt sich dabei zunächst an den entschieden anständigeren Teil der Bevölkerung Unianiembes, die Araber, deren Sitten und Gebräuche er respektierte, die er durch taktvollen Verkehr ganz auf seine Seite zu ziehen und trotz seines notwendigen Lavierens doch in großem Respekt vor sich zu halten verstand.
Die Araber repräsentieren — entgegen der Meinung der meisten Laien und Humanitätsfanatiker — zweifellos, wie erwähnt, den anständigeren Teil der Bevölkerung Unianiembes; denn die Waniamuesi betreiben, wogegen Europa ja besonders[S. 347] ankämpft, in viel größerem und grausamerem Maße den Sklavenhandel, führen fortwährende Kriege und stehen lange nicht auf dem kulturellen Standpunkt der Araber. Trotzdem verstand es auch Sigl, weitergehende Differenzen mit den Waniamuesi zu vermeiden; er hielt sich an den am meisten einflußreichen, freilich übelberüchtigten Häuptling Sikke zu Tabora und hat trotz der lächerlich geringen Stärke der Station diesen und die Waniamuesi stets im Schach zu halten gewußt.
Nunmehr allerdings — die Drucklegung dieses Buches hatte schon begonnen — nach der Ablösung Sigls wissen wir, daß Kämpfe gegen den erwähnten Häuptling Sikke notwendig wurden und daß diese glücklich gewesen sind, da durch zufällig in Tabora anwesende Expeditionen des Ausführungskomitees der deutschen Antisklaverei-Lotterie die Stationstruppen erheblich verstärkt wurden. Nur durch diese wurde mit harter Mühe und Opfern der Sieg über Sikke erreicht. Die notwendigen Kämpfe führen uns aber unsere Schwäche in dem wichtigen Unianiembe vor Augen, sie zeigen, wie vorsorglich Wißmann war, als er ein vorzeitiges Engagement zu Tabora nicht wünschte. Die Ereignisse in Tabora mahnen uns dringend, unsere Position an den Seen zu verstärken, um die bislang erreichten Erfolge nicht zu verlieren. —
Wenden wir uns nun wieder zur Expedition des Dr. Emin Pascha. Nach der vorerwähnten Bestrafung der Wangoni und Waniamuesi marschierte Lieutenant Langheld wieder zum See, woselbst er am 26. Januar 1891 sich mit dem Pascha und Stuhlmann vereinigte. Langheld erhielt die Leitung der vom Pascha angelegten Stationen Bukoba und Muanza, welche wichtige Verkehrscentren am See bilden.
Am 12. Februar erfolgte der Abmarsch des Pascha und Dr. Stuhlmanns nach Westen hin mit ca. 40 Mann, dem 3,7 cm-Geschütz und einer entsprechenden Anzahl von Trägern. Lieutenant Langheld lehnte die Aufforderung des Dr. Emin Pascha, mit der Expedition weiter zu ziehen, ab mit der Begründung, daß ihm dies als deutschem Offizier unmöglich sei, da ein Vorgehen über den ersten Grad südlicher Breite verboten war.
[S. 348]
Wie Sigl zu Tabora, so hat es auch Langheld am Viktoriasee verstanden, trotz seiner geringen Macht, eine respektable Stellung durch Benutzung der Autorität der dortigen Häuptlinge, welche größeren, man kann sagen Staatswesen vorstehen, zu schaffen; das richtige Taktgefühl Langhelds zeigte sich außerdem besonders in seinem Auftreten den Franzosen und Engländern gegenüber; gelegentlich des letzten traurigen Religionskrieges in Uganda wurde Langhelds geschicktes Benehmen und sein gerechter Takt überall anerkannt, desgleichen der seines Untergebenen, des Feldwebel Kühne, der nach dem Tode des Feldwebel Hoffmann der Station Muanza vorstand.
Dr. Emin Pascha marschierte über Karagwe zum Albert-Eduardsee; von dort aus ist in der That ein Durchzug nach Kamerun geplant gewesen; derselbe scheiterte indes an der Meuterei der Träger, die wegen der Hungersnot in Momphu sich weiter zu gehen weigerten; die Landschaft Momphu ist das äußerste von der Expedition erreichte Gebiet. Emin wußte nicht, daß er sich dort in allernächster Nähe von schon vorhandenen belgischen Stationen befand, die ihm den Weitermarsch erleichtert hätten.
Der Pascha marschierte mit Stuhlmann bis zum Albertsee zurück. Dann schickte er, als eine Pockenepidemie ausbrach, Stuhlmann mit den gesunden Leuten nach Bukoba voraus, wohin er langsam folgen wollte.
Die von der Expedition erreichten politischen Erfolge sind dank auch der Thätigkeit der Stationschefs zu Tabora und Bukoba und dank der militärischen guten Führung, recht bedeutende und stehen in keinem Verhältnis zu der geringen Stärke der Expedition. Groß auch sind die Erfolge, besonders für die Wissenschaft, für die Dr. Emin schon so vieles in stiller, entbehrungsreicher Arbeit that. Möchte bald die Mitwelt Kunde von seinem weiteren Herannahen erfahren! —
Major v. Wißmann ist heute nicht mehr der Leiter unserer afrikanischen Kolonie, aber die Pläne, welche ihn bei dem weiteren Ausbau unserer Macht daselbst geleitet haben und heute noch leiten, sind durch die Errungenschaften der Eminschen Expedition in ihrem Keim wenigstens dort angelegt. Wißmann[S. 349] hat es stets als Hauptaufgabe betrachtet, die Hilfsquellen des Landes, besonders den bestehenden Handel dauernd in unsere Hände zu bringen. Der Schwerpunkt dieses Handels aber liegt nicht an der Küste, sondern im Gebiet der Seen. Wenn wir diese zu beherrschen in der Lage sind, folgt der Handel an der Küste von selbst nach, und wir sind gleichzeitig in der Lage, unsere humanitären Aufgaben zu erfüllen und den Sklavenjagden im Innern allmählich ein Ende zu bereiten. Für die praktische Durchführung dieser Pläne und Absichten hat Wißmann sein Dampferprojekt entworfen. Ein deutscher Dampfer auf dem Viktoria würde in Verbindung mit einer genügenden Landmacht den thatsächlichen Einfluß unsererseits an den Ufern dieses Binnenmeeres, in den so reichen und hochkultivierten Ufer-Staaten desselben dauernd zu festigen im stande sein. Eine gute Schiffsverbindung würde uns die Mittel in die Hand geben, die Handelsbeziehungen um den See herum in unseren Stationen zu vereinigen.
Wenn man dazu den Plan Gravenreuths, die Gründung einer deutschen Seengesellschaft mit lediglich handelspolitischer Tendenz sich vergegenwärtigt, so kann es jedem Freunde unserer Kolonie nur schmerzlich sein, daß ein Verständnis für die Großartigkeit des entworfenen Planes und für die zweifellose Durchführbarkeit desselben sich nur in geringem Maße gefunden hat.
Der von Major v. Wißmann geplante Dampfer geht nun einen andern Weg. Über den Schire und Zambesi aufwärts soll er über den Nyassa und dann auf dem Landwege auf der berühmten von den Engländern für sich frei gehaltenen, aber leider nicht existierenden Stephensonroad zum Tanganjika gebracht werden. Ob es gelingen wird, die Schwierigkeiten dieses Transportes, besonders des Landweges zu überwinden, mag dahingestellt bleiben. Aber, mag der Dampfer nun auf dem Nyassa oder Tanganjika die deutsche Flagge zeigen, einen wesentlichen Vorteil wird er uns immer bieten. Er wird uns zwingen, endlich auch an diesen beiden so überaus wichtigen zentralafrikanischen Seen, deren Bedeutung jedem anderen Volke, besonders unseren Wettbewerbern, klar ist, unsere Macht zum Ausdruck zu bringen. Ein deutscher Dampferverkehr auf diesen Seen hat aber nur dann einen Zweck,[S. 350] wenn Landstationen dafür den Stützpunkt bilden. Man scheint dieser Überzeugung in amtlichen Kreisen bereits zugänglich geworden zu sein; denn der Vorsitzende des Antisklaverei-Komitees, unter dessen Ägide der Wißmann-Dampfer seinen Weg angetreten hat, ist der Leiter unserer Kolonialabteilung, der mit warmem Herzen und klarem Verständnis unsere afrikanischen Interessen vertritt.
Hoffen wir, daß dann auch der Mann, welchem wir die Wiedergewinnung Deutsch-Ostafrikas und die thatsächliche Errichtung unserer Macht verdanken, daß Wißmann dann wieder amtlich einen Wirkungskreis findet, wie er ihm durch seine bisherigen großen Erfolge und seine bedeutende Erfahrung zukommt.
Uns allen aber, die wir längere Zeit in unserer ostafrikanischen Kolonie thätig gewesen sind, die wir an ihrer Begründung und ihrem Aufbau mitgeholfen haben, uns wird ja immer ein hohes, inniges Interesse an dieselbe knüpfen, auch dann, wenn sie, wie der Verfasser, nach mehreren schweren, im Kampf für die Sache erhaltenen Verwundungen ausgeschieden sind.
Es bleibt uns nur zu wünschen übrig, daß auch auf dem neuerdings eingeschlagenen Wege dem jetzigen Gouverneur die Förderung unserer kolonialen Interessen, die Ausbreitung unserer Macht im Innern von Ostafrika möglich sei, zur Ehre und zum Wohle unseres deutschen Vaterlandes!

[S. 351]

(D.-O.-A. G. = Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.)
Im Verlage der Königlichen Hofbuchdruckerei Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. d. Oder ist ferner erschienen:
Meine zweite
Durchquerung Aequatorial-Afrikas
vom Congo zum Zambesi
von
Hermann von Wißmann.
Ein Band. Groß-Oktavformat. Mit 4 Karten und 92 Abbildungen.
Preis in eleganter Ausstattung 12 Mark.

Dieses neueste Werk Wißmanns, das schon bei seinem Erscheinen im vorigen Jahre besonders durch die Schilderungen der arabischen Sklavenjagden großes Aufsehen machte, ist jetzt doppelt interessant, weil Major von Wißmann in ihm genau dieselbe Straße beschreibt vom Tanganjika zum Nyassa, Schire, Zambesi, Quilimane, die er jetzt in umgekehrter Richtung zum Transporte seines Dampfers gewählt hat.
Das Militär-Wochenblatt schreibt über das Werk: Wir empfehlen das Studium dieses interessanten Reisewerkes allen deutschen Kameraden, weil sie in demselben erkennen, welche Erfahrungen unser Deutscher Afrikaner gesammelt hatte, bevor er von Seiner Majestät dem Kaiser zur Niederwerfung des Aufstandes an der Deutschen Ostküste berufen ward, zugleich um sich davon zu überzeugen, wie sehr der schlichte Vortrag der eigenen Erlebnisse Major von Wißmann vorteilhaft vor den Verfassern anderer Afrikanischer Reisewerke auszeichnet. Die Ausstattung des vorliegenden Bandes mit Karten und Bildern ist eine vorzügliche und wahrhaft künstlerische.

Im Verlage der Königlichen Hofbuchdruckerei Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. d. Oder ist ferner erschienen:
Prachtwerk ersten Ranges!
Prinz Friedrich Karl im Morgenlande.
Nach Tagebüchern und Handzeichnungen
dargestellt
von seinen Reisebegleitern
Prof. Dr. Brugsch-Pascha und Major Fr. X. v. Garnier.

Mit 12 Vollbildern und 58 Textillustrationen.
Folio-Format 62 Bogen in eleganter Ausstattung.

Preis in feinstem gepreßten Kalbsleder-Einband 30 Mark. Das Werk kann auch
nach und nach in 10 Lieferungen bezogen werden.
Das Werk wurde von der gesamten Presse auf das Günstigste aufgenommen. So sagt unter anderen der
»Hannover'scher Courier« .... ein sehr lehrreiches Werk. ... Die Illustrationen sind vortrefflich und gereichen dem interessanten Texte zur höchsten Zierde. Das schöne Werk kann nur dringend empfohlen werden.
»Illustrierte Zeitung« schreibt: .... Wenig fürstliche Reisen dürften wohl so glänzend ausgestattete Tagebücher als bleibende Spuren hinterlassen, wie obiges Prachtwerk .... wir können das sich im eleganten Gewande darstellende Tagebuch warm empfehlen.
»Vossische Zeitung« schreibt: .... Wir haben des Oefteren auf den fesselnden Inhalt des Werkes, auf die prächtigen Land und Leute charakterisierenden Bilder, wie auf die gediegene Ausstattung hingewiesen; es vereinigen sich hier alle Faktoren, ein ebenso originelles wie vornehmes Prachtwerk zu gestalten.
